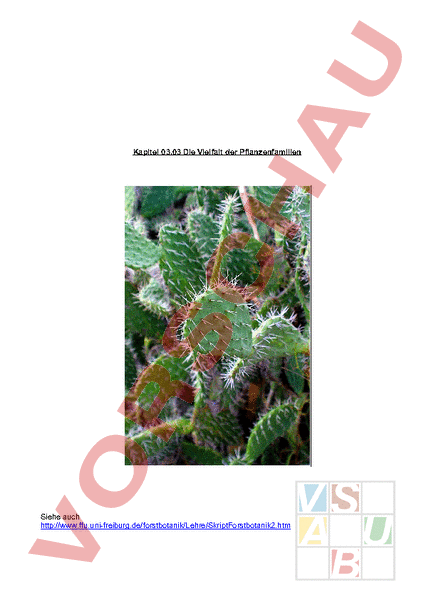Arbeitsblatt: Vielfalt der Pflanzenfamilien
Material-Details
Ordnung und Beschreibung typ. Vertreter von Pflanzenfamilien
Biologie
Pflanzen / Botanik
7. Schuljahr
29 Seiten
Statistik
100748
1529
13
02.07.2012
Autor/in
Simon Zehnder
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien Siehe auch Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 2 Inhalt Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien1 Inhalt2 Verwandtschaft von Blütenpflanzen.3 Eine mögliche Einteilung der Landpflanzen.3 Die Einordnung in Pflanzenfamilien.4 Die Familie der Lippenblütler (Lamiaceae)9 Allgemeine Baumerkmale:9 Blütendiagramm der Taubnessel:.9 Kriechender Günsel eine Laminaceae.10 Weiße Taubnessel.11 Die Familie der Kreuzblütengewächse.13 Allgemeine Baumerkmale.13 Blütendiagramm:13 Die Familie der Korbblütler (Asteracea).14 Blütendiagramm:14 Habichtskraut.16 Fotos von Korbblütlern.17 Die Kamillen18 Wie erklärst Du die Unterschiede der „Blüten?19 Die Familie der Rosengewächse (Rosaceae)20 Verschiedene Rosen aus dem Garten.21 Die Familie Hülsenfrüchtler (Fabaceae).23 Die für die Ernährung wichtigsten Hülsenfrüchte (Angaben in %):23 Die Familie der Hahnenfussgewächse (Ranunculaceae).25 Die Familie der Doldenblütler (Apiaceae, Umbelliferae).26 Allgemeine Baumerkmale.26 Fotos von Doldenblütern27 Der Wiesenkerbel ein Doldenblütler:28 Die Familie der Kakteengewächse (Cactaceae)29 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 3 Verwandtschaft von Blütenpflanzen Pflanzen lassen sich anhand gemeinsamer Merkmale und ähnlichem Aussehen in Gruppen einteilen. Diese Gruppen nennen Botaniker Pflanzenfamilien. Oft bestimmt dabei die Form der Blüte den Familiennamen. Zusatzinformationen: Aktuelle, seit 2003 gültige Einordnung der Pflanzenverwandschaft: Eine mögliche Einteilung der Landpflanzen • Landpflanzen (Embryophyta) • Moose • Abteilung Hornmoose (Anthocerotophyta) • Abteilung Moospflanzen (Bryophyta) • Unterabteilung Lebermoose (Hepaticophytina) • Klasse Marchantiopsida • Klasse Blasiopsida • Klasse Treubiopsida • Klasse Fossombroniopsida • Klasse Haplomitriopsida • Klasse Jungermanniopsida • Unterabteilung Laubmoose i.w.S. (Bryophytina) • Klasse Torfmoose (Sphagnopsida) • Klasse Klaffmoose (Andreaeopsida) • Klasse Takakiopsida • Klasse Laubmoose i.e.S. (Bryopsida) • Gefäßpflanzen (Tracheobionta) • Gefäßsporenpflanzen (Pteridophyta) • Klasse Urfarne (Psilophytopsida) • Klasse Bärlapppflanzen (Lycopodiopsida) • Klasse Psilotopsida[2] • Klasse Schachtelhalme (Equisetopsida)[2] • Klasse Marattiopsida[2] • Klasse Echte Farne (Polypodiopsida)[2] • Samenpflanzen (Spermatophyta)[3] • Palmfarne (Cycadophyta) • Ginkgopflanzen (Ginkgophyta) • Nadelholzgewächse (Pinophyta) • Gnetophyta • Bedecktsamer (Magnoliophyta) 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 4 Die Einordnung in Pflanzenfamilien Carl von Linné war ein bedeutender Biologe. Er hat versucht das Tier und Pflanzenreich zu „ordnen. Lebewesen mit ähnlich Eigenschaften ordnete er in Reiche, Ordnungen, Familien, Gattungen, Arten und Rassen an. In der Botanik fasst man auch heute noch viele Pflanzen in gemeinsame Familien zusammen. Dies erleichtert das Lernen und Bestimmen von Pflanzen. Allerdings versucht man heute Lebewesen v.a. nach genetischer Verwandschaft zusammenzufügen. Alle Rosen gehören z.B. in die Gruppe der Rosaceae (die Familienbezeichnung endet immer -aceae). Familienname (Latein) Familienname (deutsch) Beispielpflanzen Apiaceae (auch Umbelliferae)1 Doldenblütler Ammoniacum (Dorema ammoniacum) Engelwurz (Angelica archangelica) Anis (Pimpinella anisum) Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylum) Dill (Anethum graveolens) Fenchel (Foeniculum vulgare) Giersch (Aegopodium podagraria) Kerbel (Anthriscus cerefolium) Kreuzkümmel (Cuminum cyminum) Kümmel (Carum carvi) Liebstöckel (Levisticum officinale Meisterwurz (Peucedanum ostruthium) Mutterkümmel (Cuminum cyminum) Petersilie (Petroselinum hortense) Rossfenchel (Phellandrium aquaticum) Schierling (Conium macalatum) Schwarzkümmel (Nigella sativa) Sellerie (Apium graveolens) Süssdolde (Myrrhis odorata) Wasserfenchel (Oenanthe aquatica) Arecaceae (auch Palmae) Palmengewächse Aronstab (Arum maculatum) Kalmus (Acorus calamus) Articulatae Schachtelhalme Agavaceae Agavengewächse Asteraceae Korbblüter (auch Compositae) 1 Agave (Agave americana) Alant (Inula helenium Alpendost (Adenostyles alliariae) Beifuss (Artemisia vulgaris) Berg-Aster (Aster amellus) Berg-Flockenblume (Centaurea montana) Bertram (Anacyclus pyrethrum) Eberraute (Artemisia abrotanum) Estragon (Artemisia dracunculus) Fuchskreuzkraut (Senecio fuchsii) Gänseblümchen (Bellis perennis) Gänsedistel (Sonchus oleraceus, Sonchus asper Huflattich (Tussilago farfara) Kamille (Matricaria chamomilla) Kanadisches Berufkraut (Erigeron canadensis) Für einige Familien gibt es sogar zwei Familiennamen. Artikel 18.5 des ICBN legt fest, dass acht abweichende Familiennamen als gültig publiziert anzusehen sind 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 5 Kreuzkraut (Senecio vulgaris) Löwenzahn (Taraxacum officinale) Mutterkraut (Tanacetum Parthenium, Chrysanthemum Parthenium, Matricaria odorata, Matricaria Parthenium, Pyrethrum Parthenium Ringelblume (Calendula officinalis) Saatwucherblume (Chrysanthemum segetum, Glebionis segetum) Schafgarbe (Achillea millefolium) Sonnenblume (Helianthus annuus) Strahlenlose Kamille (Chamomilla suaveolens) Wegwarte (Cichorium intybus) Zitwer Zitwerblüte (Artemisia cina) Boraginaceae Rauhblattgewächse Beinwell (Symphytum officinale) Boretsch (Borago officinalis) Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) Natternkopf (Echium vulgare Purpurblauer Steinsame (Lithospermum purpurocaeruleum) Brassicaceae (auch Cruciferae) Kreuzblüter Ackerhellerkraut (Thlaspi arvense) Ackerschotendotter (Erysimum cheiranthoides) Ackersenf (Sinapis arvensis) Barbarakraut (Barbarea intermedia) Behaartes Schaumkraut (Cardamine hirsuta) Gartenkresse (Lepidium sativum Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris) Meerrettich (Cochlearia armoracia) Rettich (Raphanus sativus) Senf, Schwarzer (Brassica nigra) Wegrauke (Sisymbrium officinale) Weißkohl (Brassica capitata) Balsaminaceae Balsaminengewächse Balsamine (Impatiens balsamina Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera Campanulaceae Glockenblumengewächse Caprifoliaceae Geißblattgewächse Caryophyllaceae Nelkengewächse Clusiaceae (auch Guttiferae) Johanniskrautgewächse Cyperaceae Sauergräser/ Riedgrasgewächse Cucurbitaceae Kürbisgewächse Euphorbiaceae Wolfsmilchgewächse Fabaceae (auch Leguminosae) Hülsenfrüchtler Acker-Glockenblume (Campanula rapunculoides) Acker-Hornkraut (Cerastium arvense) Alpen-Hornkraut (Cerastium alpinum) Kornrade (Agrostemma githago) Seifenkraut (Saponaria officinalis) Vogelmiere (Stellaria media) Gurke (Cucumis sativa) Kürbis (Cucurbita pepo) Zaunrübe (Bryonia dioca) Honigklee Steinklee (Melilotus officinalis) Klee (Trifolium pratense) Linsen (Lens esculenta) 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 6 Mäuseklee (Trifolium arvense) Wiesenklee (Trifolium pratense) Wundklee (Anthyllis vulneraria) Filicatae Farne Fumariaceae Erdrauchgewächse Geraniaceae Storchschnabelgewächse Juncaceae Binsengewächse Lamiaceae (auch Labiatae) Lippenblüter Ackerminze (Mentha arvensis) Andorn (Marrubium vulgare Aufrechter Ziest (Stachys recta) Basilikum (Ocimum basilicum Braunelle (Prunella vulgaris) Goldmelisse (Monarda didyma) Gundermann (Glechoma hederacea) Heil-Ziest (Stachys officinalis) Katzenminze (Nepeta cataria) Kretischer Oregano (Origanum heracleoticum) Kriechender Günsel (Ajuga reptans) Lavendel (Lavendula officinalis) Majoran (Origanum majorana, Majorana hortensis) Melisse (Melissa officinalis) Muskateller-Salbei (Salvia sclarea) Pfefferminze (Mentha piperita) Quendel (Thymus serpyllum Rosmarin (Rosmarinus officinalis) Salbei (Salvia officinalis) Salbeigamander (Teucrium scorodonia) Taubnessel (Lamium album) Thymian (Thymus vulgaris) Wasserminze (Mentha aquatica) Wiesensalbei (Salvia pratensis Ysop (Hyssopus officinalis) Liliaceae Liliengewächse Ackerlauch (Allium ampeloprasum) Aloe (Aloe vera und viele andere Aloe-Arten Astlose Graslilie (Anthericum liliago) Einbeere (Paris quadrifolia Lauch (Allium porum) Lilie (Lilium candidum) Doldiger Milchstern (Ornithogalum umbellatum Lycopodiaceae Bärlappgewächse Bärlapp (Lycopodium clavatum) Magnoliaceae Magnoliengewächse Onagraceae Nachtkerzengewächse Papaveraceae Mohngewächse Pinaceae Kieferngewächse Poaceae (auch Gramineae) Süßgräser Polygonaceae Knöterichgewächse Kleinblütiges Weidenröschen (Epilobium parviflorum) Nachtkerze (Oenothera biennis) Alpenampfer (Rumex alpinus) Ampfer (Rumex acetosa) Ampfer-Knöterich (Polygonum lapathifolium) 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 7 Schlangenknöterich (Polygonum bistorta) Vogelknöterich (Polygonum aviculare) Primulaceae Primelgewächse Pteridophyta Farnpflanzen Ranunculaceae Hahnenfußgewächse Adonisröschen (Adonis vernalis) Akelei (Aquilegia vulgaris) Eisenhut (Aconitum napellus) Eisenhut, gelb (Aconitum vulparia) Hahnenfuss (Ranunculus acris) Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris) Nieswurz (Helleborus niger, Helleborus viridis) Rittersporn (Delphinium consolida) Scharbockskraut (Ranunculus ficaria) Sumpfdotterblume (Caltha palustris) Waldrebe (Clematis vitalba Rosaceae Rosengewächse Apfelbaum (Pirus malus) Essigrose (Rosa gallica) Gänsefingerkraut (Potentilla anserina, Argentina vulgaris, ragaria anserina) Hagebutte (Rosa canina) Kirschbaum (Cerasus vulgaris, Prunus cerasus, Cerasus vium, Prunus avium) Rose (Rosa centifolia, Rosa gallica) Zwetschge (Prunus domestica) Rubiaceae Rötegewächse Scrophulariaceae Rachenblütler Scrophulariaceae Braunwurzgewächse Augentrost (Euphrasia officinalis) Bachbunge (Veronica beccabunga) Braunwurz (Scrophularia nodosa) Ehrenpreis (Veronica officinalis) Fingerhut (Digitalis purpurea) Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys) Königskerze (Verbascum thapsiforme) Solanaceae Nachtschattengewächse Alraune (Mandragora officinalis) Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) Judenkirsche (Physalis alkekengi) Kartoffel (Solanum tuberosum) Paprika (Capsicum annum Tabak (Nicotiana tabacum) Tollkirsche (Atropa belladonna) Tomate (Solanum lycopersicum) Taxaceae Eibengewächse Valerianaceae Baldrian (Valeriana officinale) Baldriangewächse Violaceae Veilchengewächse Acker-Stiefmütterchen (Viola arvensis Stiefmütterchen, Wildes (Viola tricolor) Veilchen (Viola odorata) Parmeliaceae Bartflechtengewächse Bartflechte (Usnea barbata 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 8 Berberidaceae Berberitzengewächse Podophyllum (Podophyllum peltatum) Berberitze (Berberis vulgaris) Urticaceae Brenneseelgewächse Aufrechtes Glaskraut (Parietaria officinalis) Brennessel (Urtica dioica) Cannabaceae Hanfgewächse Hopfen (Humulus lupulus) Ericaceae Heidekrautgewächse Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi) Orchidaceae Orchideengewächse Affen-Knabenkraut (Orchis simia) Berg-Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha) Knabenkraut (Orchis morio) Rutaceae Rautengewächse Angosturabaum (Galipea officinalis, Cusparia febrifuga) Bergamotte (Citrus aurantium ssp. bergamia) Diptam (Dictamnus albus) Weinraute (Ruta graveolens) Zitrone (Citrus limon) Faboideae Schmetterlingsblütler Blasenstrauch (Colutea arborescens) Bockshornklee (Trigonella foenum-graecum Bohnen (Phaseolus vulgaris) Erbsen (Pisum sativum) Soja (Glycine max) Zusatzinformationen: Umfangreiche Übersichten über die Pflanzenfamilien: 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 9 Die Familie der Lippenblütler (Lamiaceae) Zu den Lippblütlern gehören ca. 7000 Arten, welche in in ca. 230 Gattungen anzutreffen sind. Lippenblütler sind weltweit in allen Klimazonen zu finden. Das Bekannteste Merkmal ist die besondere Form der Blüte mit der großen „Unterlippe. Bekannte Vertreter sind: Salbei, Lavendel Thymian Rosmarin Majoran, Buntnessel, Katzenminze, kriechender Günsel, Gundermann. Allgemeine Baumerkmale: Stängel: vierkantig und hohl Blätter: Blätter sind gekreuzt gegenständig Blüte: die fünf Kelchblätter sind verwachsen die fünf Blütenblätter sind unten zu einer Röhre verwachsen nach oben werden zwei unterschiedlich geformte Lippen gebildet Fruchtknoten zerfällt in vier Teilfrüchte (Nüsse) Samen: Gattung: Taubnessel Gattung: Salbei Gattung: Günsel Oberlippe helmförmig 4 Staubblätter Kelch mit 5 gleichen Zähnen Oberlippe helmförmig 2 Staubblätter Kelch zweilippig Oberlippe sehr klein Haarring in der Blütenröhre 4 Staubblätter Art: Weiße Taubnessel Art: Salbei Art: Kriechender Günsel Blütendiagramm der Taubnessel: Quelle Bild: public domain by Wikicommonsuser Griensteidl Strasburger, Noll, Schenck, Schimper: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 4. Auflage, Gustav Fischer, Jena 1900 thank you; 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 10 Kriechender Günsel eine Laminaceae 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 11 Weiße Taubnessel 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 12 Rote Taubnessel Goldnessel Basilikumblüte Zusatzinformationen: 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 13 Die Familie der Kreuzblütengewächse Schau Dir mal eine Rapspflanze genauer an: 1) Betrachte sie dazu von oben. 2) Sieh dir an, wie viele Kelchblätter und Blütenblätter die Blüte besitzt. 3) wie sind Kelch- und Blütenblätter angeordnet? 4) wie viele Staubgefäße besitzt die Blüte? Wie sind sie angeordnet. 5) fertige ein Legebild der Blüte an. Die Kreuzblütler sind eine sehr umfangreiche Familie, mit mehr als 3700 Pflanzenarten. Sie haben eine große Wirtschaftliche Bedeutung, da einige von Ihnen wichtige Nutzpflanzen für den Menschen sind. Bekannte Nutzpflanzen aus dieser Familie sind: Weißkohl, Rotkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Pak Choi, Kohlrabi, Kohlrübe, Radieschen, Raps, Senf, Meerrettich und Kresse. Allgemeine Baumerkmale Blüte: Früchte: vier Kelchblätter vier Blütenblätter auf Lücke 6 Staubblätter (außen 2 kürzere, innen 4 längere) Schoten oder Schötchen Gattung: Kohl Gattung: Senf Gattung: Rettich Raps Gemüsekohl Ackersenf Weißer Senf Hederich Garten-Rettich Blütendiagramm: Zusatzinformationen: 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 14 Die Familie der Korbblütler (Asteracea) Die Familie der Korbblüter besitzt weltweit etwa 23 000 Arten (in Europa ca. 300 Arten). Sie ist in Europa die artenreichste Familie. Sie werden auch Compositae genannt, weil ihre „Blüte gar keine ist. Es ist vielmehr eine Sammelblüte (bzw. ein Blütenstand), die aus sehr vielen kleinen einzelnen Blüten besteht. Die äußeren Blüten sehen dabei so aus wie Blütenblätter. Die inneren Einzelblüten übernehmen die Produktion des Samens. Da alle Blüten vereinigt sind, spricht man auch vom „Körbchen (Hüllkelch), das von Hochblättern (Hüllblättern) gebildet wird Korbblütler Der biologische Vorteil dieser Anpassung ist, das die Sammelblüte großer ist und durch ihre Größe mehr Insekten zum Bestäuben anlockt. Man kann mehrere Gruppen unterscheiden: Korbblüter mit Zungenblüten enthalten fast immer Milchsaft (z.B. Löwenzahn, Endivie, Chicoree) Röhrenblüten z.B. Distel, Flockenblume Zungen- und Röhrenblüten z.B. Sonnenblume, Aster, Margerite Einzelblüte • sehr klein • 5 verwachsene Kronenblätter • Kelchblätter stark zurückgebildet (oft nur 2); beim Löwenzahn haarförmig (bilden Haarkranz Flug der Frucht durch Wind möglich) • 5 Staubblätter; Staubbeutel zu einer Röhre verwachsen; Staubfäden frei • unterständiger Fruchtknoten Blütendiagramm: Quelle Bild: public domain by Wikicommonsuser Griensteidl Strasburger, Noll, Schenck, Schimper: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 4. Auflage, Gustav Fischer, Jena 1900 thank you; 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 15 Bei der Kamille sind sehr schön die einzelnen Blüten zu erkennen. 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 16 Habichtskraut Rotes Habichtskraut Gelbes Habichtskraut Zusatzinformationen: 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 17 Fotos von Korbblütlern Sonnenblume Löwenzahn 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 18 Die Kamillen Geruchlose Kamille Strahllose Kamille 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 19 Wie erklärst Du die Unterschiede der „Blüten? 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 20 Die Familie der Rosengewächse (Rosaceae) Die Rosengewächse stellen eine große Familie mit ca. 3000 Arten dar. Ihre Blüten sind sehr unterschiedlich gestaltet und oft radiärsymmetrisch. Die Blüten sind meist fünfzählig (selten vierzählig ), d.h. Sie haben meistens fünf Kelchblätter und fünf Kronblätter. Während die Rosen vielen Menschen als Geschenke und Gartenpflanzen dienen, ist manchen Menschen nicht bewusst, dass viele wichtige Nutzpflanzen in dieser Familie zu finden sind: Apfel, Birne, Süßkirsche, Quitten, Sauerkirschen, Pflaumen, Mandeln, Aprikosen, Himbeeren, Brombeeren, Pfirsich usw. Pflaumenblüte Zusatzinformationen: 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 21 Verschiedene Rosen aus dem Garten Durch Züchtungen haben die Gärtner es weit gebracht. Während die wilden Rosenarten alle recht kleine Blüten haben, ist es durch viele Jahre der Zucht gelungen immer neue Arten mit größeren Blüten und besonderen Düften zu züchten. Ein besonderer Garten ist in der Wiener Innenstadt im Volksgarten dort gibt es mehr als 500 verschiedene Rosenarten. In einem speziellen Rosarium außerhalb Wiens züchtet man gleichzeitig ca. 17 000 Arten! Weltweit ist bisher die Züchtung von ca. 30 000 verschiedenen Rosenklassen gelungen. Zusatzinformationen: 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 22 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 23 Die Familie Hülsenfrüchtler (Fabaceae) Diese Familie hat drei Unterfamilien, wovon die der Schmetterlingsblütler (Faboideae) die Bekannteste ist. In allen sind viele der Eigenschaften gemeinsam. Die Hülsenfrüchtler sind krautige Pflanzen oder verholzende Pflanzen sowie Bäume und Sträucher. Ihre gemeinsames Merkmal sind neben der „Hülse, ihrem Fruchttyp die Fiederblätter (welche allerdings manchmal bis auf das letzte Blatt, die Endfieder reduziert sein können z.B. beim Färber-Ginster (Genista tinctoria) oder beim aus drei Blättchen bestehen Klee (Trifolium)) Die oft radiärsymmetrischen Blüten sind meist fünfzählig. Aber im genauen Bau werden die Besonders im Bau der Blüten unterscheiden sich die Unterfamilien. Zu den Schmetterlingsblütlern gehören aufgrund ihres hohen Eiweißgehaltes, wichtige Nutzpflanzen wie die Erbse, die Erdnuss, die Linse aber auch andere Pflanzen wie die Kleearten, der Goldregen, Ginster, Soja und Lupinen. Hornklee Blütenaufbau Bsp. Zaunwicke • 5 verwachsene Kelchblätter • 5 Kronblätter Fahne (groß) 2 Flügel Schiffchen (2 untere Kronenblätter verwachsen) • 10 Staubblätter (meist 9 1) • Fruchtknoten liegt in der Rinne, die von den 9 Staubblättern gebildet wird • Frucht Hülse, aus 1 Fruchtknoten; keine Scheidewand Die Blätter sind fast immer zusammengesetzt (gefiedert, dreizählig oder gefingert). Die für die Ernährung wichtigsten Hülsenfrüchte (Angaben in %): Wasser Proteine Fette Kohlenhydrate Bohnen (grün) 82-90 2,5-6 0,3 6,5-8,5 Bohnen (reif) 11-14 24-26 1,5-2 47-55 Erbsen (grün) 80 2,5-6,5 0,5 4-12,5 Erbsen (reif) 14 23 2 53 Kichererbsen 15 20,5 4,8 61 Linsen 12 26 2 53 Sojabohnen 10 34 19 27 Erdnüsse 2 24 50 22 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien Ginster 24 Roter Klee Zusatzinformationen: 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 25 Die Familie der Hahnenfussgewächse (Ranunculaceae) Die Hahnenfußgewächse sind oft leicht erkennbar. Viele sind recht klein und haben gelbe oder weiße Blüten. Sie wachsen oft an Gewässern oder auf feuchten Böden. Man kennt ca. 2500 Arten. Die Pflanzen enthalten vermutlich alle das Gift Protoanemonin. Zusatzinformationen: 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 26 Die Familie der Doldenblütler (Apiaceae, Umbelliferae) Die Doldenblütler sind krautige Pflanzen mit mehrfach geteilten Blättern. Die Blüten sind oft zusammengefasst, berühren sich in der Regel aber nicht. Sie erinnern ein wenig an einen umgedrehten Regenschirm. Daher rührt auch der ältere Familienname Umbelliferae. Man kennt ungefähr 3400 Arten. Zu ihnen gehören viele Nahrungsund Gewürzpflanzen wie Fenchel, Kümmel, Dill, Petersilie, Anis, wilde Möhre ua. Einige sind aber auch sehr giftig, wie die Herkulesstaude oder der Schierling (mit dem Schierlingsbecher wurde Sokrates vergiftet!). Allgemeine Baumerkmale • Stängel vierkantig und hohl mit verdickten Knoten • Blätter häufig gefiedert • Einzelblüten mit 5 kaum sichtbaren Kelchblättern 5 unterschiedlich großen weißen Blütenblättern 2 Fruchtknoten ist klein und unscheinbar Viele Blüten zu Blütenständen zusammengefasst den Dolden: erhöhte Schauwirkung und gute Erkennbarkeit für Insekten guter Landeplatz für bestäubende Insekten große Anzahl an Samen Zusatzinformationen: 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 27 Fotos von Doldenblütern Herkulesstaude (giftig Abstand halten!!!) Wald-Engelwurz 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 28 Der Wiesenkerbel ein Doldenblütler: 02.08.2008 Kapitel 03.03 Die Vielfalt der Pflanzenfamilien 29 Die Familie der Kakteengewächse (Cactaceae) Zusatzinformationen: 02.08.2008