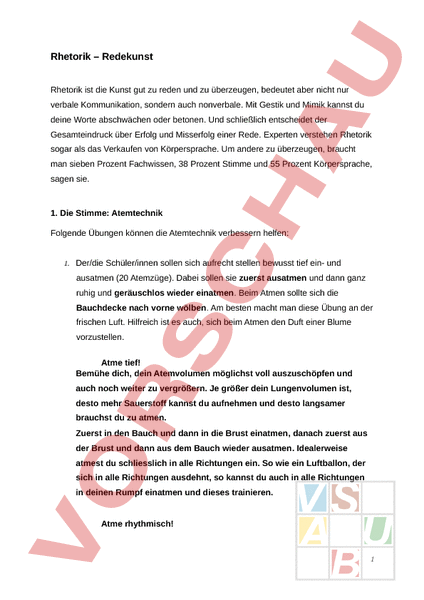Arbeitsblatt: Rhetorik Schulung für die Mittel-oder Oberstufe
Material-Details
auf 12 Seiten gibt es viele Tipps und Übungen für erfolgreiche verbale und nonverbale Kommunikation.
Deutsch
Vorlesen / Vortragen / Erzählen
klassenübergreifend
12 Seiten
Statistik
102094
1182
22
14.11.2012
Autor/in
Rolf Steinmann
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Rhetorik – Redekunst Rhetorik ist die Kunst gut zu reden und zu überzeugen, bedeutet aber nicht nur verbale Kommunikation, sondern auch nonverbale. Mit Gestik und Mimik kannst du deine Worte abschwächen oder betonen. Und schließlich entscheidet der Gesamteindruck über Erfolg und Misserfolg einer Rede. Experten verstehen Rhetorik sogar als das Verkaufen von Körpersprache. Um andere zu überzeugen, braucht man sieben Prozent Fachwissen, 38 Prozent Stimme und 55 Prozent Körpersprache, sagen sie. 1. Die Stimme: Atemtechnik Folgende Übungen können die Atemtechnik verbessern helfen: 1. Der/die Schüler/innen sollen sich aufrecht stellen bewusst tief ein- und ausatmen (20 Atemzüge). Dabei sollen sie zuerst ausatmen und dann ganz ruhig und geräuschlos wieder einatmen. Beim Atmen sollte sich die Bauchdecke nach vorne wölben. Am besten macht man diese Übung an der frischen Luft. Hilfreich ist es auch, sich beim Atmen den Duft einer Blume vorzustellen. Atme tief! Bemühe dich, dein Atemvolumen möglichst voll auszuschöpfen und auch noch weiter zu vergrößern. Je größer dein Lungenvolumen ist, desto mehr Sauerstoff kannst du aufnehmen und desto langsamer brauchst du zu atmen. Zuerst in den Bauch und dann in die Brust einatmen, danach zuerst aus der Brust und dann aus dem Bauch wieder ausatmen. Idealerweise atmest du schliesslich in alle Richtungen ein. So wie ein Luftballon, der sich in alle Richtungen ausdehnt, so kannst du auch in alle Richtungen in deinen Rumpf einatmen und dieses trainieren. Atme rhythmisch! 1 Genauso lange einatmen wie ausatmen. Eine sinnvolle Möglichkeit um dies zu kontrollieren ist es, während des Ein- und Ausatmens zu zählen. Z. B. 5 Sekunden einatmen und 5 Sekunden ausatmen. Später dann 6 Sekunden einatmen und 6 Sekunden ausatmen. Irgendwann nach monatelangem Training bist du dann vielleicht bei 15 Sekunden Einatmen und 15 Sekunden Ausatmen angelangt und so weiter. Übungen zu zweit: 2. Gleiche Übung wie vorher nur dass beim Ausatmen die Laute s, sch und erst langsam fliessend und anschliessend stossweise ausgeströmt werden. 3. Der Atem kann gestützt werden, indem man versucht jedes Wort eines Satzes extrem langsam auszusprechen. Als Ergänzung sollten die Schüler/innen möglichst viele Sätze mit einem Atemzug in gewohntem Redetempo sprechen. Beispiel Artikel aus Zeitung. 2. Sprache schulen Um gut zu sprechen, muss man gut artikulieren. Dazu muss man die Lippen bewegen. Sprich im Flüsterton: E-s i-s-t u-n-m-ö-g-l-i-c-h z-u f-l-ü-s-t-e-r-n, o-h-n-e d-i-e L-i-p-p-e-n z-u b-e-w-e-g-e-n. Übungen zu zweit: 1. Ein bewusstes Sprechen von Konsonanten erreichst du, indem du deinem Nachbarn etwas zuflüsterst und dieser soll den Inhalt wiedergeben. 2. Den selben Effekt erzielst du durch schnelles Sprechen von geeigneten Sätzen sie: „Wer nichts weiss und weiss, dass er nichts weiss, weiss mehr als der, der nichts weiss und weiss nicht, dass er nichts weiss. Zungenbrecher üben. Lest euch gegenseitig Zungenbrecher vor, der Zuhörer muss verstehen, was du gelesen hast. 3. Betontes Sprechen: „Ich fahre heute nach Flums. Je nachdem was ich aussagen will, betone ich das eine oder andere Wort. Ich – nicht mein Freund fahre – ich fliege nicht heute – nicht erst morgen Flums – nicht nach Basel 4. Möglichst viele Sätze in einem Atemzug sprechen. (wie bei 1. Atemtechnik) 5. Tonleiter singen: hinauf und hinunter. Wie gross ist dein Stimmvolumen? Übung in Teams oder alle zusammen: 1. Die Schüler/innen sollen einen Zeitungsartikel laut vorlesen. Dabei sollte versucht werden, möglichst viel Blickkontakt mit der Hörerschaft herzustellen. Dies ist die beste Vorübung für eine spätere freie Rede. (zuerst in Einzelarbeit üben) 2. Die Schüler/innen sollen anschliessend das Vorgelesene wiedergeben und zwar: entweder möglichst wortgetreu oder danach mit eigenen Worten. Dies hilft das Gedächtnis für einzelne Schwerpunkte bei einem Vortrag zu schulen und darüber hinaus die persönliche Wortgestaltung zu optimieren. 3. Satzbau 3 Lange Sätze haben viele Nachteile. Kurze Sätze sind der Gradmesser einer guten Rhetorik. Faustregeln: • Fort mit Zwischen- und Nebensätzen • Weg mit Bindewörtern • Kampf den Kommas! • Kein Satz mit mehr als 10-15 Wörtern. 4. Pausen und Pausentechnik Zeitpunkt richtig setzen. Der Redner darf die Zuhörer nicht aus den Augen verlieren. Pausenarten: • Entspannungs- und Atempausen • Kontroll- und Konzentrationspausen • Fang- und Suggestivpausen Eine Suggestivfrage ist eine Frageform, bei der der Befragte durch die Art und Weise der Fragestellung beeinflusst wird, eine Antwort mit vorbestimmtem Aussageinhalt zu geben, die der Fragesteller erwartet. Die Art und Weise der Frage hat den Zweck, auf das Denken, Fühlen, Wollen oder Handeln einer Person einzuwirken) • Dramaturgische Pausen (vor dem Höhepunkt) • Wirkungs- und Einwirkungspausen • Disziplinarische Pausen 5. Sprechdenken Weder völlig noch monoton den Text ablesen. Wichtig ist gute Disposition: • Bausteine Wörter neben- und untereinander • Überschriften Übung: 3 Begriffe neben- und untereinander schreiben, daraus eine Geschichte schreiben für einen Kurzvortrag von etwa 3 Minuten. 6. Aufbau und Gliederung von Reden Die 5 grossen Ws: 1. Wen spreche ich an? 2. Was sind die Ideen? Stoff? Haupt- und Nebenteile 3. Womit argumentiere ich? Erfahrungen, Beweise, Zitate 4. Wie? Hilfen, Bilder, Gegenstände 5. Wann? Anfänge, Schluss (Was?), Bilder Einteilung in 3 Phasen: Einleitung Hauptteil Schluss 5 Anfang: Zu Beginn der Rede Aufmerksamkeit erwecken – aber wie? • In jedem Fall darf eine kurze (!) Anrede nicht fehlen: Die Zuhörer wollen angesprochen werden. • Der Anekdoten-Einstieg: Ein persönliches Erlebnis, ein Witz oder eine andere Geschichte mit Themenbezug wird so lebendig wie möglich vorgetragen. • Der Effekt-Einstieg: Gegenstände, Bilder oder auch Musik lenken den Zuhörer auf das Thema. Beispiel: Eine Papiertüte aufblasen und mit Knall zerplatzen lassen. Dann: Alle fünf Minuten kracht es auf Deutschlands Straßen. • Der Frage-Einstieg: Über Fragen wird gleich ein Kontakt zum Publikum hergestellt. Die Frage sollte möglichst mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Eine rhetorische Frage, bei der die Antwort jedem klar ist, kann sofort Aufmerksamkeit erzeugen. Beispiel: Wer von euch hat sich noch nie über die Verspätungen bei der Bahn geärgert? • Der Gliederungseinstieg: Informiert kurz und präzise über die Gliederung der Rede und lässt die Zuhörer wissen, was auf sie zukommt. Kann auch Appetithäppchen der Rede unterstreichen. Beispiel: Ich begrüße euch zu meinem Vortrag über . Ich möchte euch einen kurzen Überblick über meine Themen geben: Ich beginne mit . • Der Zitat-Einstieg: Ein Zitat einer berühmten Person erzeugt immer Aufmerksamkeit und kann den eigenen Aussagen mehr Gewicht verleihen. Beispiel: Wie schon der berühmte Schriftsteller und Mark Twain erkannte: . • Aktuelles Ereignis (Gestern las ich in der Zeitung . Am Montag hörte ich auf DRS 3 folgendes ) • These und Antithese Beispiel: Sollte der Sportunterricht besser nur mit Knaben oder Mädchen gemacht werden, weil die Kinder unterschiedliche Interessen haben oder soll der Sportunterricht weiterhin gemischt bleiben? Der wirkungsvolle Schluss: • Der Schluss ist wie der Endspurt im Sport, wie das Finale in der Musik. • Der Schluss soll so gestaltet sein, dass ihn die Zuhörer spüren, „nachwirken. • einen klaren letzten Satz enthalten. • Beispiele für Schluss-Systeme: • Zusammenfassen • Wiederholen der wichtigsten Kernaussagen. • Nie mehr als fünf Punkte erwähnen. • Schluss mit dem Anfang zusammenbringen • Humor • Bringe einen Gag. • Erzähle gekonnt einen Witz. • Ende mit einer fröhlichen Geschichte. • Demonstriere etwas Lustiges. Fazit: 90% des Beifalls gelten dem Schluss. Deshalb: Investieren Sie ausreichende Gedanken für diesen Präsentationsteil. Nur ein starker Schluss ist ein wirkungsvoller Schluss! 7. Eigene Kontrollmechanismen Wie kontrolliere ich, ob die Zuhörer mich verstehen? Vorher • „Na und–Probe, „Na und? Was habe ich davon – dann präsentiere ich am Interesse des Zuhörers vorbei. Was nicht wirkt, schadet. • „Du-Probe Spreche ich so zu einem guten Freund? 7 • Verben benutzen • „Punkt-Probe Wenn statt „und ein Punkt stehen kann, neuen Satz bilden. „Und nur in der Aufzählung. Während der Präsentation • „Nick-Probe Nicken die Zuhörer unbewußt? • „Beteiligungs-Probe Wird mitgeschrieben? • Werden Fragen gestellt? • Gibt es spontane Reaktionen? • „Schmunzel-Probe • „Körpersignal-Probe Überzeugender wirken • Körperhaltung: Sie ist maßgeblicher Bestandteil eines erfolgreichen Vortrags. Eine möglichst lockere, unverkrampfte und natürliche Redehaltung spricht für Sicherheit. Im besten Fall löst sich der Redner vom Pult und bewegt sich frei. Dabei ist der Stand auf beiden Beinen ausbalanciert. Wanken am Pult wirkt konzentrationsstörend und zeugt von Unsicherheit. Souverän und zugewandt Die Körperhaltung, also die Art und Weise zu gehen, zu stehen und zu sitzen, verrät sehr viel über den Charakter, die Einstellung und die momentane Stimmung eines Menschen. Eine gute Körperhaltung strahlt Gelassenheit, Kompetenz und Selbstbewusstsein aus und Dynamik, liefert somit die besten Voraussetzungen, sympathisch zu wirken. Zu vermeiden sind folgende Körperhaltungen: 1. Ein Mensch, der während des Gespräch permanent von einem Bein auf das andere tritt, oder die Hände in den Hosentaschen vergräbt, gibt seinem Gegenüber das Gefühl, nicht der gewünschte Gesprächspartner zu sein. 2. Die breitbeinige Sitzhaltung strahlt Überheblichkeit und Ignoranz aus. 3. An der vordersten Kante des Stuhles zu sitzen und die Lehne mit den Händen zu umklammern, wirkt gehetzt und nervös, als sei man auf dem Sprung. Ein solches Verhalten verrät einen Mangel an Selbstsicherheit, eventuelles Misstrauen und innere Unruhe. 4. Wer den Oberkörper weit zurücknimmt signalisiert Ablehnung und Desinteresse. Bevorzugt sollten folgende Körperhaltungen eingenommen werden: 1. Die ideale Körperhaltung ist aufrecht und locker, mit geraden Schultern und leicht erhobenem Kinn. 2. Der Gang ist leicht und elastisch, die Schritte nicht zu groß oder zu klein, die Arme schwingen locker mit. 3. Die natürlichste Körperhaltung im Stehen nehmen Sie mit hüftbreit auseinander stehenden Beinen ein. Der gelegentliche Wechsel von einem Standbein auf das andere dient der Bequemlichkeit und damit der inneren Sicherheit. Die Arme hängen locker an den Seiten herunter. 4. Die natürliche Sitzhaltung ist aufrecht, die Hände entspannt auf den Sitzlehnen, die Beine etwa hüftbreit auseinander, oder ein Bein locker über das andere geschlagen. Dabei ist darauf zu achten, dass das übergeschlagene Bein zum Gesprächspartner hingewandt ist, um Zuwendung zu zeigen. Ein Drehen der Beine in die andere Richtung drückt Ablehnung aus. 5. Sich im Verlauf des Gespräches hin und wieder vorzulehnen, signalisiert dem Gegenüber Interesse, Aufmerksamkeit und Zuwendung. • Gestik und Mimik Augen, Mund und Hände Die Augen – Mit Blicken sprechen Direkter Blickkontakt zeugt von Selbstsicherheit. Halbgeschlossene Augen vermitteln den Eindruck von Langeweile, Gleichgültigkeit oder auch Arroganz. Klare und weit geöffnete Augen wirken wach und begeisterungsfähig. Nicht auf die Uhr schauen! 9 Unsere Augen sprechen ihre eigene Sprache und gelten als Spiegel und Ausdruck unserer Seele. Blicke können lächeln, Freude ausstrahlen, zustimmen, fragen aber auch zweifelnd oder stark ablehnend wirken. Mitunter sollen sie den anderen treffen oder auch verletzen. Der Volksmund spricht von vernichtenden Blicken und mancher wünscht, dass Blicke sogar töten könnten. Der Wirkung unserer Augen-Blicke kommt eine zentrale Bedeutung zu. In Gesprächen ist es daher immer empfehlenswert dem Gesprächspartner einige Sekunden einen offenen Blick zu schenken, begleitet von einem freundlichen Lächeln. Vorsicht jedoch vor zu langem Blickkontakt. Das kann leicht als Anstarren, übertriebene Neugier oder Unhöflichkeit interpretiert werden. Blicksignale sind oft eindeutig und leicht zu deuten: • Senkt der andere den Blick oder reagiert gar nicht auf dein Blickangebot, besteht von seiner Seite (zumindest im Moment) kein Interesse. • Ein stetig oder häufig zu Boden gesenkter Blick, hin und her flirrende, suchende Augen, zusammen- beziehungsweise hochgezogene Augenbrauen oder demonstratives Wegsehen sind Zeichen für Unsicherheit, Ignoranz oder sogar Provokation. • Ein schräger Blick signalisiert zumeist abschätzende Zurückhaltung und wird häufig bewusst eingesetzt. • Häufiges Blinzeln steht für Unsicherheit. • Das kurze Heben der Augenbrauen beim Anblick einer Person signalisiert Freude über einen Kontakt oder auch das Erkennen eines sympathisch empfundenen Menschen. • Heben sich die Brauen nicht, kann das ein Zeichen sein, dass derjenige sein Gegenüber als (noch) neutral oder unsympathisch empfindet. Während eines Gesprächs den Blick zu halten (ohne zu starren), ist eine unterschwellige Einladung an den anderen, das Gespräch fortzusetzen. Hält dieser den Blickkontakt ebenfalls aufrecht, weiß er die Einladung zu schätzen und nimmt sie dankend an. Während des Gesprächs in einer Gruppe empfiehlt es sich, den Blick wandern zu lassen, um jeden Beteiligten in das Gespräch einzubeziehen. Gestik und Mimik: Der Mund Lächelnd gewinnen Das Lächeln ist die Königsdisziplin um Sympathien zu gewinnen. Ein natürliches, aufgeschlossenes Lächeln ist der perfekte Türöffner. Genau deswegen empfiehlt es sich jedoch, vorher zu überlegen, wem die Tür geöffnet wird. Denn ist derjenige erst einmal eingetreten, wird es sehr schwierig, ihn taktvoll wieder hinauszukomplimentieren, sprich: den Kontakt wieder zu beenden. Ein kurzer Blick in die Augen des Gegenübers verschafft die nötige Zeit zu entscheiden, ob man mit ihm in Kontakt treten möchte. Das anschließende Lächeln kann er dann als Einladung verstehen, die konkret nur ihm gilt. Generell ist auch beim Lächeln auf das Wie und Wann zu achten: • Ein stereotypes Dauerlächeln wirkt künstlich, irritierend und selbstgefällig. • Ein übertriebenes Lächeln, das alle Zähne zeigt, das so genannte PiranhaLächeln, kann sowohl als Zeichen mühsamer Selbstbeherrschung gewertet werden als auch den Eindruck von Beliebigkeit und Oberflächlichkeit vermitteln. Begleitet wird es dann zumeist mit einem ebenso aufgesetzten Wortschwall: Ach, meine Liebe, schön, dass Sie auch da sind! Aaach, da ist ja auch • Ein gequältes, kaum sichtbares Lächeln kann bemüht, ironisch, schadenfroh, überheblich oder unsicher wirken. • Wird nur ein Mundwinkel angehoben, signalisiert die Mimik Zynismus oder Arroganz und ein Überlegenheitsgefühl. • Der überwiegend geöffnete Mund gilt als ausgesprochen unhöflich und bezeugt einen ausgeprägten Mangel an Selbstkontrolle. Er signalisiert auch unverhohlene Neugier. • Ständig zusammengepresste Lippen in Kombination mit nach unten gezogenen Mundwinkeln suggerieren Unzufriedenheit bis hin zur Verbitterung oder den Wunsch nach Distanz. • Die Steigerungsstufe des Lächelns ist das Lachen. Zeigen Sie es nur, wenn Sie tatsächlich höchst amüsiert sind oder sich wirklich sehr freuen. Das echte Lachen ist von hochgezogenen Wangen und Fältchen um die Augen begleitet, daher rührt der Ausdruck: Er lacht über das ganze Gesicht. Beim 11 aufgesetzten Lachen bewegt sich nämlich nur der Mund; der Rest des Gesichtes verändert sich dagegen nicht. Dies wird vom Gesprächspartner bewusst oder unbewusst wahrgenommen und negativ beurteilt. Vorsicht auch bei häufig gehobenen Mundwinkeln, diese Vorstufe des Lächelns signalisiert zunächst Aktivität, auf Dauer aber auch Abwehr. Gestik und Mimik: Die Hände Mit Gesten überzeugen Hände: Klammern sie sich verkrampft um Pult oder Stuhllehnen, so zeugt das von mangelnder Souveränität. Baumeln sie unbeteiligt neben dem Körper wirkt das linkisch. Aufwärtsbewegungen kennzeichnen einen positiven Ausdruck. Gesten sollten stets im Raum oberhalb der Hüfte stattfinden, um nicht abwertend zu wirken. Gehen sie über den Kopf hinaus, wirken sie unglaubwürdig. Die Hände gehören auf keinen Fall in die Hosentaschen! Nicht an den Kleidern herumzupfen, am Kopf kratzen oder im Gesicht reiben! Die Sprache der Hände ist in vielen Teilen der Welt gleich: Die Siegerpose mit der hoch gestreckten Faust, der gehobene Daumen als Signal der Zustimmung, erhobene Hände als Zeichen der Friedfertigkeit – alles das sind allgemein gültige Gesten. Während wir kommunizieren, setzten wir unsere Hände noch viel stärker ein und begleiten und unterstützen unsere verbale Rede in subtilerer Form. Welch entscheidende Rolle die Hände im Gesprächsverlauf einnehmen, vermittelt Ihnen das folgende ABC. Seine Kenntnis hilft Ihnen das eigene Verhalten besser zu kontrollieren und die Befindlichkeit Ihres Gegenübers einfacher zu deuten. Gestik und Mimik: Das kleine ABC der Handgesten Finger an die Nase Ein Zeichen der Konzentration oder für Bedenken legen Getrommel mit den Bedeutet Ungeduld oder Nervosität, möglich ist auch Fingern Gefaltete Hände Hand vor den Mund Provokation Zeigen deutliche Überlegenheit Gesagtes soll zurückgenommen werden, Unsicherheit in halten Händereiben der Sache Suggeriert Selbstzufriedenheit, wirkt nicht immer sympathisch Hände über den Kopf Bei Zurücklehnen zeigt die Geste grenzenlose Souveränität legen Herumspielen mit Lässt auf Desinteresse, Unkonzentriertheit oder Nervosität Fingern Kopf auf die Hände schließen Steht für Nachdenklichkeit, Erschöpfung oder Langeweile stützen Kratzen am Kopf Reiben des Kinns Verschränkte Arme Ein Zeichen von Ratlosigkeit oder Unsicherheit Steht für Nachdenklichkeit und Zufriedenheit Bei Männern: Ablehnung und Verschlossenheit; Bei Frauen: Unsicherheit oder Ängstlichkeit Zum Spitzdach geformte Signalisieren Überheblichkeit, gleichzeitig Abwehr gegen Hände Einwände Grundsätzlich werden zweierlei Handpositionen positiv vom Gegenüber aufgenommen. Zum einen sollten sich die Hände immer offen und sichtbar vor oder neben dem Körper befinden. Die Hand in der Hosentasche wird als negativ empfunden. Wichtig ist auch in welcher Höhe Sie die Hände halten und bewegen. Alle Gesten unterhalb der Taille können provokant wirken, oberhalb der Taille werden sie indes positiv wahrgenommen. Der Händedruck ist häufig der erste Körperkontakt zwischen zwei Menschen. Er vermittelt einen handfesten Eindruck, verstärkt oder vermindert die Sympathie, die dem Gegenüber entgegen gebracht wird. Ein übertrieben kräftiger Händeschlag ist zwar meist als Zeichen von Dynamik und Entschlossenheit gemeint, vermittelt auch leicht den Eindruck von Rücksichtslosigkeit, Konkurrenz oder Angeberei. Zu lasch oder gar feucht vermittelt er deutliche Unsicherheit oder gar Angst. Ideal ist ein fester, aber nicht übertriebener Händedruck, verbunden mit einem geraden Blick in die Augen Tipps gegen Lampenfieber 1. Lampenfieber zulassen, das ist etwas völlig normales. Etwas Lampenfieber ist sogar sehr nützlich. Es ist auch Ausdruck dafür, dass du deine Sache besonders gut machen willst. Somit hilft ein bisschen Lampenfieber sich stärker zu konzentrieren. Ausserdem wirkst du dann überzeugender, als wenn du mit gespielter Lässigkeit ganz cool, etwas vorträgst. 2. Sicherer Einstieg, erste paar Sätze auswendig lernen 3. Frühzeitig bereit sein, damit ich nicht ins Schwitzen komme 4. Plaudern mit den Zuhörern, Kollegen 13 5. Körperspannung auf- und abbauen, 10 Sekunden Luft anhalten, alle Muskeln anspannen, dann entspannen, zweimal machen 6. Während Rede freundliche Gesichter suchen und diese ansehen, aber nicht fixieren Die grössten Fehler beim Reden 1. Baue keinen Blickkontakt auf Vermeide jeglichen Blickkontakt mit deinem Publikum. Das Publikum könnte zurückschauen! Schaue am besten den gesamten Vortrag aus dem Fenster und bleibe ab und zu an einer Sache, die draußen passiert, verträumt hängen und unterbreche deinen Vortrag! 2. Verstecke dich hinter dem Manuskript Schreibe dir deinen gesamten Vortrag vollständig vor und drucke den Text dann auf A4 in Schriftgröße 3 oder kleiner aus. Halte das Skript während des Vortrags direkt vor dein Gesicht! Dein Ziel muss es sein, dass deine Zuhörer während des gesamten Vortrags nicht ein einziges Mal dein Gesicht sehen. Lies den gesamten Vortrag von deinem Skript ab. 3. Klimpere mit Gegenständen in deiner Tasche Suche am Abend, bevor du deinen Vortrag hast, möglichst viele Klimpergegenstände, wie zum Beispiel Schlüssel mit Schlüsselanhängern oder Münzen, und stopfe deine Hosentaschen damit voll. Während du dann deinen Vortrag hältst, solltest du versuchen, mit deinen Gegenständen in der Tasche so zu klimpern, dass du einer afrikanischen Trommelgruppe ähnelst. 4. Bleibe während des Vortrags auf einer Stelle stehen Suche dir vor deinem Vortrag einen Punkt am Rande der Bühne/des Raums aus. Dieser Punkt sollte möglichst versteckt und nicht gut beleuchtet sein. Stelle dich während der gesamten Präsentation an diesen Punkt und bewege dich nicht von der Stelle. Hier wirklich darauf achten, weil: Bewegung könnte deinen Vortrag spannender machen! 5. Mache keine Pausen Warte nicht, bis die Leute ruhig sind, sondern betrete die Bühne und fange sofort an zu reden. Rede, rede, rede ohne Unterbrechung! Schließlich willst du dem Publikum ja einiges an Inhalt bieten, oder?! Wenn jemand Zwischenfragen hat, vertröste ihn auf nach dem Vortrag, so dass der Fragesteller ab dem Moment nicht mehr deinem Vortrag folgt, sondern nur noch seine Frage im Kopf hat. 6. Stopfe deinen Vortrag mit Detail-Informationen zu Die Leute sind nicht gekommen, um etwas Spannendes zu hören, sondern sie wollen pure Informationen. Am besten, du packst in deine Präsentationen möglichst viele große Tabellen mit vielen Zahlen und viele Fremdwörter, welche die Zuhörer mit Sicherheit nicht verstehen. Das Publikum wird es dir danken und dich als hochintelligent ansehen. Erkläre ja keine Fremdwörter, sonst hebst du das Publikum auf das selbe Level wie dich! 7. Lass das Publikum auf dich warten Plane für die Vorbereitung des Vortrags keine Zeit ein. Die Vorbereitungszeit wird sowieso immer überschätzt. Die Stresssituation, in die du dich schon vor deinem Vortrag versetzt, wird dir sicherlich während deines Vortrags helfen; und vergessen wirst du dann sicher auch nichts. Außerdem: Nichts liebt das Publikum mehr, als ein verspäteter Beginn eines Vortrags. Damit glückt dir der erste Eindruck super! Weitere Übungen 1. Zur Schulung der Sprechweise und Sprachvielfalt sollen die Schüler/innen ihren bisherigen Tagesablauf der übrigen Klasse (ev. in 2 Gruppen) erzählen. Dabei sollten sie sich bemühen, unbefangen, natürlich sowie ansprechend zu erzählen. 15 2. Die Schüler/innen sollen einen ausgewählten Zeitungsartikel im Sinne eines Sachberichtes und mittels eines erstellten Stichwortkonzepts wiedergeben. Dabei können zwei Ergänzungen gemacht werden. Das Gesagte muss ich einem Satz zusammengefasst werden oder der Inhalt des Zeitungsartikels soll durch eine eigene kurze Stellungnahme ergänzt werden. 3. Schüler/innen nehmen einen persönlichen Gegenstand, der eine besondere Bedeutung für das Kind hat, mit und bereiten damit einen Kurzvortrag vor: Was ist das? Weshalb gerade dies? Ziel: Kurze Rede in maximal 3 Minuten. Die Zeit wird gemessen.