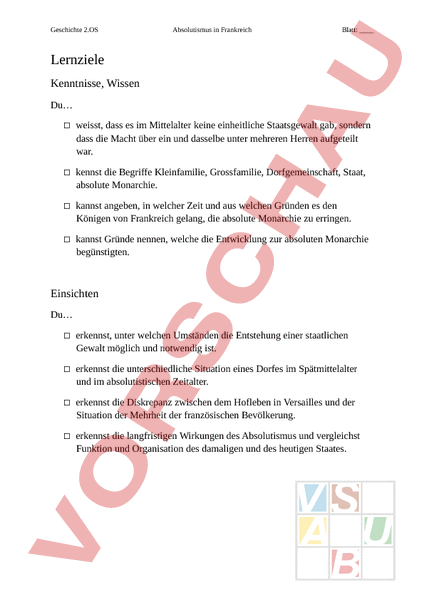Arbeitsblatt: Absolutismus
Material-Details
Arbeitsblätter und Texte, die sich auf das Lehrmittel durch Geschichte zur Gegenwart beziehen. Einige Ergänzungen sind angebracht, die das Thema erweitern.
Geschichte
Neuzeit
8. Schuljahr
32 Seiten
Statistik
102308
1576
18
23.08.2012
Autor/in
Martina Schwarz
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Lernziele Kenntnisse, Wissen Du weisst, dass es im Mittelalter keine einheitliche Staatsgewalt gab, sondern dass die Macht über ein und dasselbe unter mehreren Herren aufgeteilt war. kennst die Begriffe Kleinfamilie, Grossfamilie, Dorfgemeinschaft, Staat, absolute Monarchie. kannst angeben, in welcher Zeit und aus welchen Gründen es den Königen von Frankreich gelang, die absolute Monarchie zu erringen. kannst Gründe nennen, welche die Entwicklung zur absoluten Monarchie begünstigten. Einsichten Du erkennst, unter welchen Umständen die Entstehung einer staatlichen Gewalt möglich und notwendig ist. erkennst die unterschiedliche Situation eines Dorfes im Spätmittelalter und im absolutistischen Zeitalter. erkennst die Diskrepanz zwischen dem Hofleben in Versailles und der Situation der Mehrheit der französischen Bevölkerung. erkennst die langfristigen Wirkungen des Absolutismus und vergleichst Funktion und Organisation des damaligen und des heutigen Staates. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Einführung Auftrag: Betrachte im Buch die Seite 104 und mache dir über folgende zwei Punkte Gedanken: 1. Die gedruckten Ausschnitte belegen die Fülle der heutigen Staatstätigkeiten: Suche möglichst viele dieser staatlichen Aktivitäten und Institutionen heraus. 2. Im Zentrum steht ein Herrscher, der behauptet: „Der Staat – das bin ich.: Kann ein Herrscher all diese Aufgaben erfüllen? Bestanden zur Zeit dieses Herrschers wohl schon alle diese Staatsaufgaben? Welche Gefahr bestünde wohl, wenn all diese Ämter der Gewalt eines Herrschers unterstünden? Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Herrschaft im mittelalterlichen Europa (8. Bis 15. Jahrhundert) Im mittelalterlichen Europa gab es verschiedene Königreiche. Die Macht der Könige war jedoch gering. Nur ein kleiner Teil des Landes gehörte direkt ihnen. Die Könige mussten von den Abgaben der Bauern leben, andere Einkünfte hatten sie nicht. Das übrige Land im Königreich gehörte Adligen, die auf Burgen lebten (Gräfe, Vögte, Ritter), und Klöstern. Adlige und Klöster übten die Herrschaft über die Bauerndörfer aus. Ein weiterer Landteil gehörte den Städten, die vom Kaiser das Stadtrecht erwarben und sich selber regierten und ernährten. Beispiel: Das Dorf Maur am Greifensee um 1250 Der Boden gehörte zum grossen Teil den zürcherischen Klöstern Grossmünster und Fraumünster. Die meisten Bauern waren Pächter und mussten diesen Klöstern einen Grundzins bezahlen. Dieser bestand aus Geld, Getreide, anderen landwirtschaftlichen Produkten oder Arbeiten im Dienst des Klosters. Ausserdem setzten die beiden Klöster einen Pfarrer ein und bezogen dafür den Zehnten, den zehnten Teil der Ernte jedes Bauern. Die Menschen von Maur waren nicht einem Herr sondern mehreren untergeordnet. Jeder dieser Herren hatte eine beschränkte Macht. Bei Streitigkeiten und Verbrechen kam es auf den Schweregrad des Verbrechens drauf an, wer den Gerichtsentscheid fällte: Der Meier von Maur, der die niedrige Gerichtsbarkeit ausübte (einfache Streitigkeiten, z.B. Wegbenützung über fremdes Land), der Graf von Rapperswil, der die hohe Gerichtsbarkeit ausübte (schwere Streitigkeiten, z.B. Diebstahl) oder der Graf von Kyburg, der die Blutgerichtsbarkeit ausübte (Gerichtsentscheid bei todeswürdigen Verbrechen, z.B. Mord). Ähnlich wie in Maur war es auch in den anderen Döfern im mittelalterlichen Europa. Was ist ein Meier? Meier (mhd. maior Fronhofs, mlat. maior regiae] meier, ahd. meiur, Verwalter eines Oberbauer; aus domus [villae, [fronherrlicher, königl.] Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Hausverwalter; mlat. auch villicus). Amtsträger eines fma. Villikationsverbandes, der vom Fronhof aus das Salland bewirtschaftete und die abhängigen Hufen beaufsichtigte und deren Abgaben einzog. Große Villikationen waren in mehrere Meier-Ämter gegliedert, denen insgesamt ein Ober-Meier (summus villicus) vorstand. Die Meier entstammten ursprünglich unfreien Familien des Herrschaftsverbandes, stiegen häufig zur Ministerialität auf und fanden im 13. Jh. vorübergehend Zugang zum niederen Adel, bis dieser sich gegen Neuzugänge abgeschlossen hatte. Sie wurden durch einige Hufen Eigenland (curia villicalis) entlohnt und hatten Anspruch auf Dienste und Abgaben der unterstellten Bauern. Vielfach wirkten sie in der grundherrlichen Gerichtsbarkeit mit. Wo sich um Fron- oder Meierhöfe dörfliche Siedelgemeinschaften bildeten, wuchs dem Meier vom HMA. an – neben dem Schultheißen – auch politischer Einfluss zu, dessen Bedeutung zeitlich und regional unterschiedlich ausgeprägt war. Ausschlaggebend für die herausgehobene Stellung des Meiers waren Größe und wirtschaftl. Potenz des Meiergutes sowie das Erbrecht daran (s. Meierrecht). Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Städte und Handel Seit dem 12. Jahrhundert bekamen in Europa die Städte grössere Bedeutung. Die Bauern verkauften ihre Waren auf dem städtischen Markt und kauften dafür Handwerksgerät, Salz und Pfeffer. Kaufleute zogen mit wertvollen Waren, etwa kostbaren Stoffen, von Stadt zu Stadt. Nun zeigten sich die Nachteile der bestehenden Ordnung: Die adligen Herren führten oft Krieg gegeneinander, weil sie sich wegen irgendeines Rechtes oder eines Besitzes uneinig waren. Oft entstanden auch Intrigen. In diesen Kriegen waren die Dörfer und ihre Bewohner ungeschützt und wehrlos. Oft waren die Männer sogar zum Kriegsdienst verpflichtet. Kaufleute oder Bauern auf dem Weg zum Markt konnten von Räubern oder Raubrittern überfallen werden. Es war niemand da, der Schutz gewähren konnte. Die Besitzungen der Adligen waren meist verstreut. Der adlige Herr war nicht da, wenn man ihn gebraucht hätte. Die Klöster kümmerten sich oft wenig um ihre Bauern, sondern zogen nur die Zinsen ein. Die drei Stände Die Menschen wurden in drei Stände (Schichten) aufgeteilt: 1. Die Geistlichkeit, 2. Der Adel und 3. Der dritte Stand (also die Bürger der Städte, die Bauern, Tagelöhner, Gesindel) Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Auftrag: Beantworte folgende Fragen: 1. Welche verschiedenen Mächte übten die Herrschaft über die Bauern im mittelalterlichen Europa aus? 2. Wie heissen die drei Gerichtsbarkeiten, und was bedeuten sie? 3. Wie entwickelte sich der Handel, nachdem die Städte im 12. Jahrhundert grössere Bedeutung erlangt hatten? 4. Worin zeigten sich die Nachteile der mittelalterlichen Ordnung? Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: 5. Schau dir das Bild an und erkläre die Ausdrücke „Wehrstand, „Lehrstand und „Nährstand. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Der König wird Alleinherrscher Stärkung der Königsmacht Schon im Mittelalter hatte Frankreich einen König. Doch seine Macht war gering: Wenn er in den Krieg zog, war er auf die Hilfe der Adeligen angewiesen. Einnahmen bezog er nur von den Bauern, die auf seinem Privatland lebten. Die Bauern mussten dem König einen Teil ihrer Ernte abliefern und Geld für die Landbenützung bezahlen, die Pacht. Seit dem 13. Jahrhundert aber, versuchten die Könige von Frankreich, ihre Macht zu verstärken. Dazu waren sie auf Soldaten angewiesen. Sie begannen daher, ein stehendes Heer aufzubauen. Ein stehendes Heer ist ein Heer, das ständig zur Verfügung steht und nicht nur dann aufgebaut wird, wenn Krieg bevorsteht. Die Stärke des französischen Heeres: 144 5 146 1 152 5 166 4 9‘000 Mann 12‘000 Mann 20‘000 Mann 45‘000 Mann 168 8 290‘000 Mann 170 3 400‘000 Mann Um die Soldaten bezahlen zu können, reichten die Abgaben der Bauern, die auf dem Privatland des Königs lebten, nicht aus. Daher begann der König, von allen Bewohnern Frankreichs Steuern zu erheben. Zudem liehen ihm die reichen Kaufleute in den Städten Geld aus. Auftrag: Auf der Rückseite findest du ein Koordinatensystem auf dem du die Entwicklung des französischen Heeres mit einer Kurve darstellen sollst. Trage dazu Die weiteren in der Tabelle angegebenen Jahreszahlen ein. Trage die angegebenen Heeresgrössen ein. Verbinde die Punkte, zeichne die Kurve. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Unterstützung Widerstand und • Die Städte unterstützten den König sie erhofften sich Frieden und Ordnung durch die Königsmacht. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: • Die Bauern unterstützten den König auch sie wollten, dass die ständigen Kriege ein Ende nehmen. • Die Kirche unterstützte den König erhofften sich eine Vertreibung der Protestanten (in Frankreich Hugenotten genannt) oder eine gewaltsame Rückführung zur katholischen Kirche. • Die Adeligen unterstützten den König nicht sie hätten ihre Rechte verloren. Adelige besassen auch Land (Grundbesitz) auf dem Bauern arbeiten mussten und den Adeligen Steuern abliefern mussten. Aufgrund des Widerstands seitens des Adels dauerte es bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts, bis die Könige ihr Ziel erreicht hatten. Im 17. und 18. Jahrhundert gelang es Ludwig XIV. als erster, sich von jeglicher Bindung zu lösen. Wenn dies der Fall ist, nennt man die Staatsform „absolute Monarchie. So schuf er einen für die damalige Zeit modernen Staat, der zum Vorbild für die meisten Monarchen Europas wurde. Um den Zorn der Adeligen zu besänftigen, liess der König ihnen viele Vorrechte: sie durften ihren Grundbesitz behalten, bezogen weiterhin die Abgaben der Bauern, sie mussten keine Steuern bezahlen und sie allein hatten die Möglichkeit, einen höheren Posten in der Armee (Offizier) zu erlangen. Viele Adelige zogen auf den Hof des Königs, liessen es sich dort wohl sein und hofften auf ein königliches Geschenk oder ein königliches Amt. Aufträge: 1. Fallbeispiele: In einer Gruppe bearbeitest du mit deinen Kollegen eines der folgenden Beispiele. Eine kurze Antwort wird bei allen, nach den Vorträgen, eingetragen. a) In der Provinz Anjou gibt es einen bewaffneten Aufstand der Bauern. Wie reagiert der König? b) Die Adeligen in der Provinz Normandie sind der Meinung, dass ihre Rechtsordnung ausschliesslich auf der lokalen Tradition beruhe. Was meint der König dazu? Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: c) In der Provinz Poitou sind die Leute der Meinung, da sie fern vom König lebten, würde dessen Anspruch auf Steuern und Gerichtsbarkeit wohl kaum durchgesetzt werden. Ist ihre Hoffnung berechtigt? 2. Übt nun ein Rollenspiel ein: Adelige, Vertreter der Kirche, Bürger der Städte und Bauern diskutieren die positiven und negativen Seiten der absoluten Monarchie. Den einzelnen Schauspielern muss einzig ihre Einstellung zum König klar sein. 3. Vergleicht im Buch die Grafik auf S. 113 mit den Grafiken auf S. 105. 109 und 110. Was stellt ihr fest? Notiert eure Erkenntnisse. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: 4. Lies die Quelle 3 auf der Buchseite 114. Überlege dir deine Antworten auf folgende Fragen. a) Welche Vorteile sieht Bossuet in der absolutistischen Monarchie? b) In welchem Verhältnis steht der Herrscher zu Gott? c) Wie haben sich die Untertanen gegenüber dem Herrscher zu verhalten? Gibt es Ausnahmefälle? d) Lassen sich Gegenargumente zu Bossuets Auffassung anführen? 5. Diskussion: Welche ist die beste Staatsform? Die Fragen unter 4 helfen dir vielleicht zur Meinungsäusserung. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Ludwig XIV. und der Hof des Sonnenkönigs Ludwig XIV. wurde schon mit fünf Jahren König, da sein Vater früh starb. Bis er die Regierung mit 23 Jahren selber übernahm, vertrat ihn sein Ministerpräsident, Kardinal Mazarin, der den Machtausbau begann. Ludwig XIV. behielt die Regierung des mächtigsten Staates im damaligen Europa bis zu seinem Tod 1715. „Létat cest moi (Der Staat bin ich), diesen Ausspruch haben ihm die Zeitgenossen in den Mund gelegt um seine Herrschaftsauffassung zu charakterisieren. Ludwig XIV. Das Bild hängt im Thronsaal von Versailles. Es ist 2,80 Meter hoch und wurde so aufgehängt, dass der Betrachter die Füsse des Königs in Augenhöhe hat. Beamte und Gesetze Der König begann auch, Gesetze zu erlassen, die für alle Bewohner Frankreichs galten. Ebenso erhob er den Anspruch, nur er dürfe über die Franzosen Gericht halten. Da er aber nicht überall gleichzeitig sein konnte um die Steuern einzuziehen und Gericht zu halten, setzte Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: er Beamte ein, die den Willen des Königs in allen Winkeln Frankreichs durchsetzten. Ihren Lohn bezogen sie aus den Steuergeldern. Diskussionspunkte für die Klasse Wie möchte Ludwig XIV. jeweils erscheinen? Welche Machtstellung des Königs soll zum Ausdruck gebracht werden? Kommentar zum Bild von Ludwig XIV. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Der absolutistische Staat Das Recht, über die Franzosen zu regieren, war nun nicht mehr auf viele Herren verteilt, sondern vereinigt im Staat. So war also der französische Staat entstanden. Alle staatliche Gewalt lag aber beim König. Der König selbst liess sich von niemandem etwas vorschreiben. Seine Macht war unbeschränkt, absolut (lateinisch: absolutus losgelöst). Er sah sich selbst als frei von der Bindung an die menschlichen Gesetze, da er sie selbst erlassen und aufheben konnte. Er wollte losgelöst von jeder Kontrolle regieren. Sein Wille blieb einzig durch die Verantwortung gegenüber Gott eingeschränkt. Der König verstand sich nämlich als Stellvertreter Gottes, durch dessen Gnade er als Monarch (griechisch: monarchos König). eingesetzt worden war (Gottesgnadentum). Wir nennen diese Staatsordnung absolute Königsherrschaft oder absolute Monarchie. Um diesen Anspruch dem einfachen Volk, das weder schreiben noch lesen konnte, ständig vor Augen zu führen, wählte Ludwig XIV. als Symbol seiner Herrschaft ein Bild, dessen Bedeutung allen bekannt war: die Sonne. „Als Sinnbild wählte ich die Sonne. Sie ist ohne Zweifel das lebendigste und schönste Sinnbild eines grossen Fürsten, sowohl deshalb, weil sie einzig in ihrer Art ist, als auch durch den Glanz, der sie umgibt, durch das Licht, das sie den anderen Gestirnen spendet, die gleichsam ihren Hofstaat bilden, durch die gerechte Verteilung des Lichtes über die verschiedenen Himmelsgegenden der Welt, durch die Wohltaten, die sie überall spendet, durch ihre unaufhörliche Bewegung, bei der sie trotzdem stets in ständiger Ruhe zu schweben scheint, durch ihren unveränderlichen Lauf, von dem sie niemals abweicht. (Ludwig XIV., Memoire, S. 137. Sonnensymbol am Gitter vor dem Hof des Schlosses von Versailles. Dieses Symbol liess Ludwig XIV. an zahlreichen öffentlichen Plätzen anbringen. Wie die Planeten um die Sonne kreisen, sollten sich die Adligen um den König bewegen. Gegenüber dem Glanz in dem der König stand, sollten sie verblassen. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Frankreich unter Ludwig XIV. Versailles Ludwigs Macht war unbestritten. Er wollte aber, dass diese auch gegen aussen sichtbar werde. Dazu diente ihm ein einfaches Schloss in Versailles, etwa 20 Kilometer ausserhalb von Paris. Dieses Schloss liess er von 1668 bis 1710 aufwändig umbauen und erweitern. Schliesslich war daraus eine gewaltige Schloss- und Parkanlage entstanden. Während der über 40-jährigen Bauzeit waren ständig zwischen 20‘000 und 30‘000 Arbeiter beschäftigt. In einzelnen Jahren wurden über 10 Millionen Pfund ausgegeben; allein von 1668 bis 1690 waren es 70 Millionen. Zum Vergleich: ein Tagelöhner verdiente pro Tag etwa 0,5 Pfund, etwa gleich teuer war ein Kilogramm Butter; eine Kuh kostete etwa 50 Pfund. Alle Flügel des Schlosses waren streng geometrisch angeordnet und auf die königlichen Gemächer hin ausgerichtet. Einzig die Schlosskapelle durchbricht die Symmetrie und überragt alle anderen Gebäude. Im Mittelpunkt des Schlosses lag das Schlafzimmer Ludwigs. Hier versammelten sich jeden Morgen alle, die Rang und Namen hatten, um dabei zu sein, wenn der König sich erhob. Die Pracht wurde von den riesigen Ausmassen des Komplexes unterstrichen. Er besass eine 580 lange Gartenseite mit 1000 Fenstern. 2000 Räume soll das Schloss haben. Trotzdem war es eng, denn insgesamt etwa 20‘000 Menschen lebten im Schloss und in dessen unmittelbarer Nähe (4000 Hofbeamte, Hofdamen und Diener (Hofbeamte und Hofdamen waren ausschliesslich adeliger Herkunft), 7000 Soldaten und Offiziere, 1000 Angehörige der Staatsverwaltung (Sekretäre, Schreiber), dazu Gäste, Künstler und Gesandte aus dem Ausland etc.). Darunter allein 338 Köche. Das Wasser für die Springbrunnen des Parks mussten aus der Seine herbeigeführt werden, denn pro Stunde wurden 5000 Kubikmeter Wasser verspritzt. Das dazu notwendige Pumpwerk umfasste 14 Wasserräder und 225 Pumpen. Hofhaltung Die Unterhaltskosten für den Hof betrugen pro Jahr zwischen 6 und 10 Millionen Pfund, darin inbegriffen die zahlreichen Theateraufführungen, Feuerwerke, Festessen und Bälle. Von 1682 an lebte der König ausschliesslich in Versailles. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Aufträge: 1. Rechne zusammen mit einem Partner/einer Partnerin die angegebenen Kosten aufgrund heutiger Löhne in aktuelle Werte um. Den Umrechnungswert müsst ihr zuerst berechnen. Geht von den damaligen und heutigen Tageslöhnen aus: 0,5 Pfund (im absolutistischen Frankreich)/ 200 Franken (heute in der Schweiz) Umrechnungswert: a) Bauaufwand 1668 bis 1690: b) Auslage für den Bau in einzelnen Jahren: c) Unterhaltskosten für den Hof: 2. Vergleiche den Wasserverbrauch der Parkanlagen von Versailles mit dem Schwimmbad Grava in Laax (Gesamtfassungsvermögen ca. 700 m3). 3. Vergleiche die Ausdehnung von Schloss und Park von Versailles mit dir bekannten Grössen (z.B. Fussballplatz) 4. Lies im Buch auf den Seiten 115/116 den Tagesablauf von Ludwig XIV. Schildere den Tagesablauf mit eigenen Worten. Was ist dir speziell aufgefallen? Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Versailles im Jahre 1722 (Gemälde von Pierre-Denis Martin) Versailles heute Heiratspolitik Mit 22 Jahren heiratete König Ludwig XIV Maria Theresia, die Tochter des spanischen Königs. Er hatte sie zuvor nie gesehen; die Heirat war von ihren und seinen Eltern und Ministern veranlasst worden. Die Hochzeit hatte einen politischen Hintergrund: Frankreich hoffte, dass die spanische Königsfamilie bald einmal aussterben würde, so dass Ludwig als Gatte einer spanischen Prinzessin Spanien erben könnte. Der spanische König hingegen, versprach sich von dieser Ehe gute Beziehungen zu Frankreich, mit dem er bis dahin meistens Krieg geführt hatte. Staaten wurden damals wie Privatgüter unter den Fürstenfamilien vererbt. Die Heirat von Königen und Prinzen war von so grosser politischer Bedeutung, dass die Frage nach der gegenseitigen Liebe des Königspaares nicht einmal gestellt wurde. Ein harmonisches Familienleben gab es daher nicht. Nachdem Maria Theresia einem Prinzen das Leben geschenkt und damit ihre Pflicht erfüllt hatte, vernachlässigte Ludwig sie völlig und hielt sich eine Anzahl von Freundinnen, sogenannte Mätressen, von denen er zahlreiche Kinder bekam. Diese Kinder waren zwar nicht erbberechtigt, erhielten aber von ihrem Vater riesige Güter zum Geschenk. Unterhaltung Für den Hof in Versailles konnte es nie genug Unterhaltung geben. Der König liebte das Theater, die Oper und das Ballet. Ständig waren Schauspielertruppen in Versailles zu Gast. Die bekannteste unter ihnen dürfte diejenige von Jean-Baptiste Molière gewesen sein. Molière Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: wies in seinen Komödien auf menschliche Schwächen hin, auch auf diejenige des Königs. Doch solange es nicht zu weit ging, konnte der König darüber lachen. Diskussionsfragen in der Klasse: 1. Warum werden „politische Ehen geschlossen? 2. Was sind die familiären und menschlichen Konsequenzen dieser Ehen? 3. Wo ist der Sinn der umfangreichen Bauen und des ausgeklügelten Zeremoniells? 4. Hatte der König ein Privatleben? 5. Möchtet ihr Ludwig XIV. gewesen sein? Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Der König und sein Volk Aussenpolitik Ludwig XIV. wollte seine Macht nicht nur im eigenen Land, sondern auch gegen aussen zeigen. Die anderen Herrscher sollten sich seinem Willen fügen und Frankreich sollte sich vergrössern. Das führte zu zahlreichen Kriegen. Um Krieg zu führen, braucht es eine Armee – dazu hatte der König sein stehendes Heer. Dieses Heer kostete viel, etwa 60% der Staatsausgaben. Der König war daher auf Einnahmen angewiesen. Die Einnahmen waren meistens Steuern der Bürger der Städte und der Bauern auf dem Land. Besitzverhältnisse Etwa 80% aller Franzosen lebten auf dem Land. Ein grosser Teil des Bodens gehörte den Adligen, der Kirche und den städtischen Bürgern, die reich geworden waren und Land gekauft hatten. Das Land der Adeligen und der Kirche wurde von Kleinbauern bewirtschaftet, die ihren „Vorgesetzten hohe Abgaben entrichten mussten. Nur wenige Bauern hatten eigenes Land und ein eigenes Gespann. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Leben der Bauern Dem Bauern blieb von seinem erwirtschafteten Ertrag kaum mehr als die Hälfte. Er lebte sehr ärmlich, hauptsächlich von Getreideprodukten und Wein. Fleisch war ein seltener Luxus. Die meisten Bauern hatten kein Vieh, daher gab es auch keinen Mist, um die Felder zu düngen. Die Ernteerträge waren bescheiden: Pro Hektare wurden fünf bis zehn Zentner Getreide geerntet, von denen etwa 20% wieder ausgesät werden musste. Zum Vergleich: Heute werden in der Schweiz rund 45 Zentner Getreide pro Hektare geerntet. Seuchen, vor allem Pocken, waren häufig. Ein Viertel der Kinder erlebte den ersten Geburtstag nicht, ein weiterer Viertel starb vor dem 20. Altersjahr. Obendrein wurden die Bauern wegen ihrer körperlichen Arbeit auch noch verachtet. Ein französischer Schriftsteller (de la Bruyère) verglich sie mit Tieren, „die man da und dort auf den Feldern sieht, dunkel, fahl und ganz von Sonne verbrannt, über die Erde gebeugt, die sie mit zäher Beharrlichkeit durchwühlen und umgraben. Die Familien hatten viele Kinder, welche helfen mussten die Einnahmen zu erhöhen und die alten oder nicht mehr arbeitsfähigen Angehörigen zu versorgen. Schon mit elf und zwölf Jahren mussten die Jungen und Mädchen bis zu vierzehn Stunden am Tag arbeiten, als Hirten und Mägde, in Bergwerken oder Spinnstuben. Auch den Menschen in den Städten ging es nicht viel besser. Reiche gab es nur wenige. Handwerker und Besitzer kleiner Läden verfügten über ein kleines Einkommen. Steuern Adel und Kirche hatten das Vorrecht, überhaupt nicht besteuert zu werden. Dafür die Bauern umso stärker. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Armut und Hunger Der hohe Steuerdruck und die grosse Armut verhinderte eine Verbesserung der Betriebsführung, um mehr produzieren zu können. Auch auf dem Besitz der Adligen und der Kirche sah es nicht besser aus, da diese meist wenig von der Landwirtschaft verstanden. Missernten waren häufig, welche dann die Getreidepreise in die Höhe schnellen liessen. In den unteren Schichten kam es zu Hungersnöten. Aufstände wurden vom Heer unterdrückt. Ein König, ein Glaube, ein Gesetz Die Vereinheitlichung des gesamten Königreichs traf eine Gruppe innerhalb der Bevölkerung besonders hart. Den Hugenotten (reformierte Minderheit) hatte der Grossvater Ludwigs XIV. 1598 im Edikt von Nantes erlaubt, den Gottesdienst in ihren Kirchen so zu feiern, wie sie es wünschten. Nun wollte der König den Calvinismus (die französischen Protestanten wurden von Jean Calvin reformiert) beseitigen: • Katholische Pfarrer wurden immer häufiger beauftragt die Protestanten zu bekehrten. • Die reformierten Schulen mussten schliessen. • Kinder ab sieben Jahren, die zum katholischen Glauben übertreten wollten, durften ihren Eltern weggenommen werden. • Protestantische Frauen mussten zur Entbindung katholische Hebammen rufen. • Soldaten wurden in Wohnungen der Hugenotten einquartiert, wo sie ungestraft plündern und vergewaltigen konnten. Diese Zwangsmassnahmen führten allerdings nicht zu den gewünschten Bekehrungen. Daher widerrief Ludwig XIV. das Edikt von Nantes. Die Reformierten galten jetzt als Ketzer. Da der König die religiöse Einheit herstellen wollte, verlangte er von den Hugenotten den Übertritt zum katholischen Glauben. Dass die reformierten Pastoren ausgewiesen und die Gotteshäuser der Hugenotten zerstört wurden, sahen viele Katholiken gern, weil sie die oft wohlhabenden und einflussreichen Protestanten beneideten. Für die Protestanten gab es nur zwei Möglichkeiten: Die meisten legten zum Schein ein Lippenbekenntnis ab. Etwa 250‘000 wagten die verbotene Flucht. Damit verlor Frankreich gut ausgebildete Fachleute, die England, die Niederlande, Preussen und die Schweiz gerne aufnahmen. Die Stützen des absolutistischen Staates Der Theologe, königlicher Hofprediger und Erzieher des Thronfolgers Jacques Bossuet (1627-1704) über die beste Staatsform und die Macht des Königs: Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: „Die Menschen werden allesamt als Untertanen geboren Staaten bilden heisst: sich vereinigen. Man ist aber nirgends besser geeinigt als unter einem einzigen Oberhaupt Der Fürst blickt von einem höheren Standort aus; man darf deshalb darauf vertrauen, dass er weiter sieht als wir; deshalb muss man ihm ohne Murren gehorchen Die königliche Gewalt ist erstens heilig, zweitens väterlich, drittens unumschränkt. Die Fürsten handeln als Diener Gottes und als dessen Stellvertreter auf Erden. Durch sie übt er seine Herrschaft aus. Die königliche Gewalt ist unumschränkt. Der Fürst braucht niemandem Rechenschaft abzulegen über das, was er verfügt. Ohne diese unumschränkte Gewalt kann er das Gute nicht fördern und das Böse nicht unterdrücken Nur Gott kann über die Entscheidungen der Herrscher und ihre Person richten. Die Untertanen sind dem Fürsten unbedingten Gehorsam schuldig. Der einzige Schutz des Untertanen gegen die Staatsgewalt muss seine Unschuld sein Der Fürst kann sich selber zurechtweisen, wenn er merkt, dass er Böses getan hat Die Könige dürfen ihre Macht nur für das Allgemeinwohl gebrauchen.Es gibt nur eine Ausnahme: Wenn der Fürst etwas gebietet, was gegen Gott ist Es ist durchaus notwendig, mit der wahren (das heisst katholischen) Kirche verbunden zu bleiben. Der Fürst muss seine Gewalt dazu anwenden, die falschen Religionen in seinem State zu vernichten. Aufträge: 1. Unterstreiche die Textstellen, in denen du etwas über das Verhältnis zwischen Gott und König erfährst. 2. Ludwig XIV. sah sich selbst als „König von Gottes Gnaden (Gottesgnadentum). Erläutere mithilfe des Textes, was das bedeutet. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: 3. Welche Rechte hatte der Herrscher aufgrund dieses „Gottesgnadentums? 4. Wer kontrolliert den absoluten Herrscher? 5. Welche Gefahren und Nachteile ergeben sich für die Untertanen aus einer absoluten Herrschaft? Begründe! Neuordnung und Verwaltung Die Untertanen in den Provinzen des Königreichs hatten alle ihre eigenen Alltagssorgen. Da Versailles weit entfernt war und sie den Herrscher normalerweise niemals in ihrem Leben sahen, fühlten sie sich den Anordnungen Ludwigs XIV. kaum verpflichtet. Auch die adligen Gouverneure regierten selbstherrlich ihre Provinzen und wirtschafteten oft in die eigene Tasche. Daher musste der König dafür sorgen, dass der Staat nach seinen Vorstellungen geordnet und von Versailles aus kontrolliert wurde. Er brauchte zuverlässige Männer, die auf neuen Wegen seine Wünsche zu erfüllen suchten: Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: • Zuerst wurden die hohen, ehemals einflussreichen Adligen aus dem „Königlichen Rat ausgeschlossen; sie konnten an der Regierung nicht mehr mitwirken. • Aus dem Kreis der Minister wählte der König nun einige Vertraute aus, die ihm als persönliche Ratgeber dienen durften. Ludwigs wichtigste Stütze war Jean Baptiste Colbert. • Um den unumschränkten Machtanspruch des absoluten Monarchen in den Provinzen durchzusetzen entsandte Colbert königstreue Intendanten. Sie erhielten die Amtsbefugnisse der Adligen, die Provinzleitung und das Recht der Steuereintreibung. Dadurch wurden die Adligen in ihren Ämtern entmachtet. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Aufträge – Lösung 1. Unterstreiche die Textstellen, in denen du etwas über das Verhältnis zwischen Gott und König erfährst. Der Theologe, königlicher Hofprediger und Erzieher des Thronfolgers Jacques Bossuet (1627-1704) über die beste Staatsform und die Macht des Königs: „Die Menschen werden allesamt als Untertanen geboren Staaten bilden heisst: sich vereinigen. Man ist aber nirgends besser geeinigt als unter einem einzigen Oberhaupt Der Fürst blickt von einem höheren Standort aus; man darf deshalb darauf vertrauen, dass er weiter sieht als wir; deshalb muss man ihm ohne Murren gehorchen Die königliche Gewalt ist erstens heilig, zweitens väterlich, drittens unumschränkt. Die Fürsten handeln als Diener Gottes und als dessen Stellvertreter auf Erden. Durch sie übt er seine Herrschaft aus. Die königliche Gewalt ist unumschränkt. Der Fürst braucht niemandem Rechenschaft abzulegen über das, was er verfügt. Ohne diese unumschränkte Gewalt kann er das Gute nicht fördern und das Böse nicht unterdrücken Nur Gott kann über die Entscheidungen der Herrscher und ihre Person richten. Die Untertanen sind dem Fürsten unbedingten Gehorsam schuldig. Der einzige Schutz des Untertanen gegen die Staatsgewalt muss seine Unschuld sein Der Fürst kann sich selber zurechtweisen, wenn er merkt, dass er Böses getan hat Die Könige dürfen ihre Macht nur für das Allgemeinwohl gebrauchen. Es gibt nur eine Ausnahme: Wenn der Fürst etwas gebietet, was gegen Gott ist Es ist durchaus notwendig, mit der wahren (das heisst katholischen) Kirche verbunden zu bleiben. Der Fürst muss seine Gewalt dazu anwenden, die falschen Religionen in seinem State zu vernichten. 2. Ludwig XIV. sah sich selbst als „König von Gottes Gnaden (Gottesgnadentum). Erläutere mithilfe des Textes, was das bedeutet. Der König handelt als Gottes Diener und Statthalter auf Erden. Er braucht niemandem Rechenschaft abzulegen über das, was er befiehlt. 3. Welche Rechte hatte der Herrscher aufgrund dieses „Gottesgnadentums? Der Herrscher hat alle Rechte, wenn er seine Macht für das Allgemeinwohl einsetzt. 4. Wer kontrolliert den absoluten Herrscher? Gott. Ausserdem kann er sich selber zurechtweisen. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: 5. Welche Gefahren und Nachteile ergeben sich für die Untertanen aus einer absoluten Herrschaft? Begründe! Da es keine Gewaltenteilung gibt, ist der Untertan dem Herrscher letztlich ausgeliefert. Andererseits braucht er sich nicht zu fürchten, wenn er unschuldig ist. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Handel und Gewerbe Der König hoffte, vor allem von den Bürgern (Kaufleute und Gewerbetreibende) mehr Steuern einnehmen zu können. Das war nur möglich, wenn die Bürger gut verdienten. Daher versuchte der König (oder besser gesagt: dessen Finanzminister Colbert, denn der König beschäftigte sich mit diesen Problemen nicht), Handel und Gewerbe zu unterstützen: • Manufakturen: Die Betriebe, die begehrte, hochwertige Dinge in grossen Mengen (Massenproduktion) preiswert erzeugten, waren die Manufakturen (lateinisch: manu facere von Hand herstellen). Diese grossen Betriebe unterstütze Colbert mit Geld und befreite sie von Steuern, damit sie kostengünstig einen Warenüberschuss produzierten. Die Arbeiten führten bei der Herstellung der Produkte nur noch kleine, sich ständig wiederholende Arbeitsschritte aus (Arbeitsteilung). Verbreitet waren besonders Textil-, Seiden-, Metallwaren- und Spiegelmanufakturen. • Die Rohstoffe, die in den Manufakturen verarbeitet wurden, wurden aus den französischen Kolonien (an der westafrikanischen Küste, in Indien und Nordamerika) beschafft. Dort waren die Rohstoffe besonders günstig. • Zur Verbesserung des Verkehrs wurden Kanäle gebaut (Verbindung zwischen dem Mittelmeer und dem Atlantik: Canal du Midi, 241 km) • Hohe Einfuhrzölle: Gegen die Einreise fremder Händler. Die Franzosen sollten die Waren im eigenen Land und nicht aus dem Ausland beziehen (Schutzzoll). • Binnenzölle zwischen den einzelnen Provinzen wurden abgeschafft. • Mit dem Bau von Handelsschiffen wurde der Verkauf französischer Waren ins Ausland unterstützt. Tatsächlich konnten einzelne Bürger ihre Betriebe ausbauen und kamen zu recht grossem Reichtum. Bauern hingegen verarmten, da sie ihr Getreide billig verkaufen mussten, um dem Wettbewerb der ausländischen Rohstoffe standhalten zu können. Dieses System nennt man Merkantilismus. Auftrag: Überlege dir zusammen mit einem Partner/einer Partnerin, warum die merkantilistische Wirtschaftstheorie problematisch ist. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Auftrag Lösung Überlege dir zusammen mit einem Partner/einer Partnerin, warum die merkantilistische Wirtschaftstheorie problematisch ist. Die Erhebung hoher Zölle führte bei den anderen Ländern zu entsprechenden Gegenmassnahmen. Dadurch wurde der internationale Güteraustausch behindert. Zudem aber hat sich Ludwig XIV. sehr bald über die Grundsätze des Merkantilismus hinweggesetzt. Seine Aussen- und Finanzpolitik war kontraproduktiv Es ging ihm nicht darum, den Wohlstand des Volkes oder auch nur eines Teils des Volkes zu mehren, sondern die im Innern gefestigte Königsmacht nach aussen zu tragen und die Vormachtstellung über ganz Europa zu erringen. Das war nur durch fortdauernde Kriege möglich, die ein riesiges Heer nötig machten und die Finanzkraft des Landes überforderten. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Ergebnisse Die steigenden Steuereinnahmen waren für Ludwig nur ein Mittel zur Vergrösserung der eigenen Macht. Während 33 von 54 Regierungsjahren war er in grosse Kriege verwickelt. Trotz dieser Kriege waren ihm nicht viele Gebietseroberungen geglückt (s. Karte) Ausserdem war der Krieg für den Handel ungünstig. Viele Kaufleute erwarben daher, wenn sie genug Geld verdient hatten, lieber einen Landbesitz mit sicherem Eintrag, als dass sie ihr Geschäft ausbauten. 1685 trieb Ludwig fast alle Protestanten zur Auswanderung, weil er sie zur Bekehrung zum Katholizismus zwingen wollte. Unter den Protestanten befanden sich aber viele tüchtige Geschäftsleute, die sich nun in Deutschland, England, den Niederlanden und in der Schweiz niederliessen. Bei Ludwigs Tod war Frankreich zwar nach wie vor ein mächtiger Staat, jedoch aber völlig verschuldet! Zeitalter des Absolutismus Eigentlich errang der König von Spanien im 16. Jahrhundert als erster europäischer Herrscher die Stellung eines absoluten Monarchen. Stützen konnte er sich auf die enormen Gold- und Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Silbermengen, die nun in Lateinamerika zutage gefördert wurden. Seien Regierungsform ist sehr vergleichbar mit derjenigen des französischen Königs Ludwig XIV. Offenbar aber war Europa ein Jahrhundert früher noch nicht bereit, die absolutistische Monarchie nachzuahmen. Später machte das Vorbild des Königs von Frankreich den anderen Herrschern Europas Eindruck. Auch sie wollten auf ihrem Gebiet die absolute Königsherrschaft erlangen. Das führte dazu, dass in Deutschland an den meisten Höfen nur noch Französisch gesprochen wurde. Auch die englisch-schottische Königsfamilie der Stuarts strebte die absolute Königsmacht an. Indessen erwies sich das Unterhaus des Parlament, das vom Adel dominiert wurde, als sehr widerstandsfähig. Nach mehreren Bürgerkriegen, der Hinrichtung des Königs, der Ausrufung der Republik und der Militärdiktatur Oliver Cromwells setzte sich am Ende des 17. Jahrhunderts schliesslich ein System durch, in welchem der König keine wesentliche Entscheidungen ohne das Parlament treffen konnte. Grossbritannien wurde zum Vorbild aller, welche den Absolutismus kritisierten. Absolutismus – auf dem Weg zum modernen Staat Zusammenfassung Bisher konnten die Könige ihre Herrschaft nur mit Unterstützung mächtiger Adliger und geistlicher Würdenträger ausüben. Im 17. und 18. Jahrhundert gelang es Ludwig XIV., dem französischen König, sich von jeglicher Bindung zu lösen. So schuf er einen für die damalige Zeit modernen Staat, der zum Vorbild für die meisten Monarchen Europas wurde. Ludwig XIV. hatte es als Erster geschafft, sich von jeder Kontrolle seiner Person zu befreien, indem er aus den Adligen Untertanen mit besonderen Rechten machte. An deren Stelle berief der König ihm verpflichtete Beamte, die seine Vorstellungen in allen Winkeln des Landes umsetzen sollten. Dabei hatten Adlige, Priester, Soldaten, Kaufleute und Bauern dem Monarchen als Untertanen zu gehorchen und zu dienen. Die absolute Gewalt benutzte Ludwig XIV. um zentral von Versailles aus die Verwaltung, Wirtschaft und Religion seines Staates neu zu ordnen und zu vereinheitlichen. In vielen Gebieten Europas versuchten kleine und grosse Herrscher diese absolutistische Regierungsweise unter den besonderen Bedingungen ihrer Länder zu verwirklichen Doch gewann eine Gruppe kritischer Denker immer mehr Einfluss, die Aufklärer. Sie bezweifelten, dass der König allein alle Gewalt im Staat besitzen dürfe. Unter ihrem Einfluss entstand der aufgeklärte Absolutismus. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: Fragen über Fragen 1. Warum wählte Ludwig XIV. die Sonne als Symbol seiner Stellung? 2. Was bedeutete Ludwigs Politik für die anderen europäischen Mächte? 3. Warum produzieren Manufakturen günstiger als Handwerksbetriebe? 4. Stelle mit Hilfe der Karte alle staatlichen Massnahmen zur Förderung des Handels zusammen und erläutere deren Zweck. Geschichte 2.OS Absolutismus in Frankreich Blatt: 5. Beschreibe, woran man erkennt, dass die neuen Residenzen nach dem Vorbild von Versailles gebaut sind. (Bilder!!!)