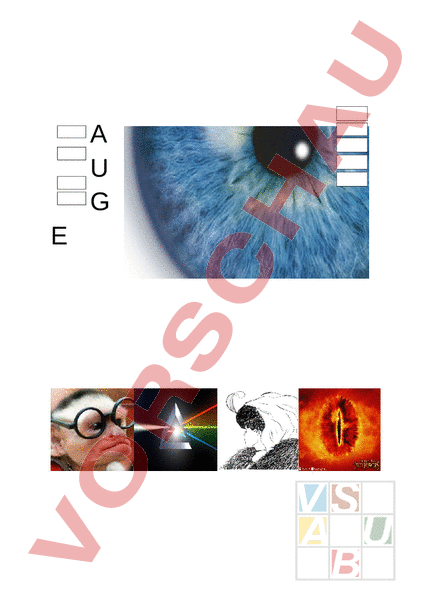Arbeitsblatt: Dossier Auge
Material-Details
Grundlagen über Aufbau, Funktion, Räumliches Sehen, Farben sehen und optische Täuschungen.
Physik
Optik
8. Schuljahr
20 Seiten
Statistik
112436
2309
109
27.02.2013
Autor/in
sa co
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
A G Lernziele Auge und Optik Prüfungstermin:_ Unser Auge Äussere Teile des Auges benennen Innerer Aufbau Teile des Auges an einer Abbildung beschriften können Aufbau des Auges skizzieren können Die Bestandteile des Auges und ihre Funktion Die Funktionen der Augenteile beschreiben Die Augenteile ihren Funktionen zuordnen können Schutzeinrichtungen des Auges Den Tränenapparat beschriften können Wissen was Adaption bedeutet Die Adaption erklären können Real Sek x x x x Bau und Funktion der Netzhaut Aufbau der Netzhaut beschriften können Aufgaben der einzelnen Teile beschreiben Der Sehvorgang Funktionsweise einer Linse beschreiben Den Sehvorgang erklären können Die Schritte des Sehvorgangs richtig ordnen Die Aufgaben von Stäbchen und Zäpfchen nennen x x Akkommodation Unterschiede zwischen Weit- und Nahsehen aufzählen Linse und Augenmuskeln bei verschiedenen Einstellungen zeichnen x x Räumliches Sehen Das Entstehen des räumlichen Sehen in eigenen Worten wiedergeben x Sichtbarer Farbbereich Absorption und Reflektion erklären Die Spektralfarben in der richtigen Reihenfolge zeichnen Begründen weshalb Gegenstände farbig erscheinen Farbenblindheit Häufigste Art der Farbenblindheit beschreiben Erklären wie Farbenblindheit zustande kommt Fehlsichtigkeiten 3 Fehlsichtigkeiten kennen Wirkung der Linsen bei einer Sehkorrektur kennen x x x x x Wissensüberprüfung Aufgaben möglichst auswendig richtig lösen Optische Täuschungen Entstehung von optischen Täuschungen verstehen Verschiedene Täuschungsarten kennen S.Cocchi 2 Das Auge Das Auge – Arbeitsaufträge Arbeitsblatt Thema Arbeit 1. Unser Auge Mache die Versuche 2. Innerer Aufbau Ordnet die Begriffe den entsprechenden Nummern zu Seite 5 Urknall 7, Seite 19 Mache die Versuche und Notiere die Beobachtungen Stift Ordne jedem Bestandteil des Auges aus der linken Spalte, eine Funktion zu Bau und Funktion unseres Körpers ab Seite 124 4. Schutzeinrichtungen des Auges Fülle die Wörter ein und löse die untere Aufgabe Markiere die dir unbekannten Wörter rot Rote Farbe 5. Bau und Funktion der Netzhaut Lies den Text durch und markiere die neuen Wörter blau Seite 8 9 Blauer Stift Text Seite 8 oben 3. Die Bestandteile des Auges und ihre Funktionen Material Unterlagen beschriebenen Banknachbar, Farben Mache den Versuch löse die Aufgaben 1-5 6. Der Sehvorgang Mache den Versuch und fülle die Lücken aus Lupe, Papier und Sonnenschein 7. Akkommodation Schaue dir die kurze Animation unter 09/umwelt_technik/12sehen/ako m.htm und ergänze die Abbildungen Computer 8. Räumliches Sehen Mache die Versuche und Folge der Linie. Zusätzliche Infos unter Stift Banknachbar Computer 9. Sichtbarer Farbbereich Mache den Versuch. Lies den Text im Buch und beantworte die Fragen im Dossier Prisma, Lichtquelle, Papier Buch „Physik für die Sekundarstufe 1 Seite 40/41 10.Farbenblindheit Lies den Text und Versuche die Zahlen zu erkennen. Markiere die dir unbekannten Wörter rot Roter Stift 11.Fehlsichtigkeiten Lies die Texte und zeichne in den Abbildungen die Lichtlinien nach Brille 12.Wissensüberprüfung Löse die Aufgaben ohne nachzuschauen 13.Optische Täuschungen Betrachte die Täuschungen und versuche sie zu erklären S.Cocchi 3 Seiten 18 – 20 Das Auge Unser Auge Versuche zum Aussehen 1. Betrachte das Auge deines Banknachbarn und erstelle eine Skizze. Beschrifte dann die einzelnen Teile mit den folgenden Begriffen: Oberes und unteres Augenlid Lidränder mit Wimpern Eingänge zu Tränenkanälchen um Inneren Augenwinkel Hornhaut Regenbogenhaut Pupille Skizze: 2. Schaue deinem Banknachbarn nun ganz tief in die Augen und betrachte die Regenbogenhaut (den farbigen Teil des Auges). Beschreibe anschliessend wie diese ausgesehen hat. S.Cocchi 4 Das Auge Innerer Aufbau 6 5 3 2 1 4 8 7 9 Augenmuskel Netzhaut Blinder Fleck Pupille Gelber Fleck Regenbogenhaut Iris Glaskörper Sehnerv Linse Versuche zum Auge 1.Jemand soll die Augen 20 Sekunden lang schliessen und dann mit Blick Richtung Lichtquelle wieder öffnen. Der Andere soll beim öffnen der Augen genau die Pupillen betrachten. Wechselt euch ab! Welche Beobachtung macht ihr? S.Cocchi 5 Das Auge 2.Haltet einen Stift vor euer Gesicht und betrachtet den Hintergrund und den Stift gleichzeitig. Geht das? Was seht ihr scharf und was nicht? Könnt ihr beides gleichzeitig scharf sehen? Besprecht zu zweit, was ihr gesehen habt. S.Cocchi 6 Das Auge Die Bestandteile des Auges und ihre Funktionen 1 Aderhaut Die Stelle des schärfsten Sehens befindet sich im hinteren Augenbereich. An dieser Stelle hat es keine Stäbchen, sondern nur Zäpfchen. 2 Augenmuskeln Der Ringmuskel gibt jedem Menschen seine Augenfarbe, und reguliert durch Veränderung der Pupillengrösse die ins Auge fallende Lichtstärke. In ihr befinden sich die Lichtsinneszellen (Stäbchen und Zäpfchen) und der Sehnerv führt von ihr direkt ins Gehirn. 3 Blinder Fleck 4 Gelber Fleck Die vordere durchsichtige Abdeckung des Auges ist gewölbt und sammelt dadurch die einfallenden Lichtstrahlen. Sie schützt das Auge vor eindringenden Fremdkörpern. 5 Glaskörper Er tritt beim blinden Fleck aus dem Auge, führt von dort direkt ins Hirn und übermittelt optische Informationen. 6 Hornhaut An dieser Stelle „sieht man nichts, da hier der Sehnerv aus dem Auge tritt. 7 Iris Regenbogenhaut Diese Muskelfasern befinden sich rund um die Linse und sind für die Bildschärfe zuständig. 8 Lederhaut Sie ist durchsichtig, bricht das ins Auge fallende Licht und kann die Form verändern um das Bild scharf zu stellen. 9 Linse Die äusserste weisse Haut grenzt das Auge gegen aussen ab, schützt es vor Fremdkörpern und gibt ihm die Form und Stabilität. Sie geht vorne in die Hornhaut über. 1 0 Netzhaut Retina Die Grösse dieses Sehlochs, durch das Licht ins Auge geleitet wird, kann je nach Lichtstärke von der Iris verändert werden. Pupille Die sechs Muskeln können den Augapfel nach oben, unten, zur Seite und diagonal bewegen. 1 2 Sehnerv Hier wird die Tränenflüssigkeit produziert und zum Auge geführt. 1 3 Tränendrüse, Schwemmkanal Diese Hautschicht besteht aus Muskelgewebe und leitet das Blut ins Auge. Sie geht vorne in die Iris über. Der grösste Bestandteil des Auges ist mit einer durchsichtigen Masse gefüllt. Er befindet sich zwischen der Linse und der Netzhaut und gibt der Form des Auges Stabilität. 11 1 4 Ziliarmuskeln 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 7_ 8_ 9_ 10_ 11_ 12_ 13_ 14_ S.Cocchi 7 Das Auge Schutzeinrichtungen des Auges Der Tränenapparat 1 2 3 4 5 6 7 8 Ausführungsgänge, oberes Tränenröhrchen, Tränendrüse, Tränennasengang, Tränenpünktchen, Tränensack, untere Nasenmuschel, unteres Tränenröhrchen Die knöchernen Augenhöhlen sind mit weichem Fett ausgepolstert, so dass die Augen bei Stössen federnd zurückweichen können. Diese Fettschichten werden auch bei grossem Hunger nie abgebaut. So bleibt der parallele Verlauf der beiden Augenachsen gewährleistet und es können keine Sehfahler durch Doppelbilder entstehen. Die Tränendrüsen sorgen für eine ständige Befeuchtung der empfindlichen Hornhaut. Im inneren Augenwinkel fliesst das überflüssige Wasser über Tränenkanäle in den Tränensack und von dort in die Nasehöhle ab. Bei Überschuss gibt es Tränen. Nur Menschen können beim Lachen und Weinen Tränen vergiessen Die Augenlider arbeiten wie Scheibenwischer. Sie bewegen sich unwillkürlich 5-7 Mal pro Minute und streifen Bakterien und andere Fremdkörper von der Hornhaut weg. Bei Gefahr können sie sich reflexartig schliessen (Lidschluss-Reflex). Adaption – Helligkeitsanpassung Damit wir ständig optimal sehen können ist es wichtig, dass die richtige Menge an Licht in unser Auge kommt. Bei zu hoher Lichtintensität werden wir geblendet, bei zu geringer sehen wir die Dinge nur dunkel. Beim zweiten Versuch auf Seite 5 habt ihr selber ausprobiert wie diese Helligkeitsanpassung, oder auch Adaption genannt (manchmal auch Adaptation), funktioniert. Wenn es dunkel ist öffnet sich unsere Pupille weit, so dass viel Licht in das Innere des Auges eindringen kann. Wenn es nun heller wird verengt sich unsere Pupille und es kommt weniger Licht bis auf die Netzhaut. Diese Anpassung benötigt eine kurze Zeit in der wir das Gefühl haben nichts zu sehen. Diesen Effekt kennt ihr sicher, wenn ihr durch einen Tunnel fahrt und am Ende des Tunnels wieder ins Helle kommt. In welchen Situationen können wir diesen Effekt noch beobachten? S.Cocchi 8 Das Auge Bau und Funktion der Netzhaut Die Netzhaut ist nur ca. 0,2 Millimeter dick und liegt direkt auf der Aderhaut. Durch die Augenlinse und die Hornhaut werden Bilder auf der Netzhaut abgebildet. Diese Bilder werden in der Netzhaut mit Hilfe der Sehsinnesszellen zu Nervenimpulsen verarbeitet. Die Netzhaut enthält zwei verschiedene Arten von Sehsinneszellen. Die rund 120 Millionen länglichen Stäbchen sind sehr lichtempfindlich und können deshalb auch bei sehr schwachem Licht arbeiten. Die kürzeren Zapfen sind für die Farbwahrnehmung (grün, blau, rot) zuständig. Von den Zapfen gibt es „nur etwa 6 Millionen. Die Zapfen funktionieren nur bei gutem Licht, deshalb können wir in der Nacht Farben nur schwer unterscheiden. Die Sehsinneszellen liegen auf einer Schicht Zellen, welche einen Farbstoff enthalten. Diese Schicht nennt man Pigmentschicht. Trifft Licht auf eine Sehsinneszelle, wird diese angeregt. Dies führt dazu, dass der Farbstoff in den Zellen der Pigmentschicht zerfällt und so ein Nervenimpuls produziert wird. Dieser Nervenimpuls wird, mit Hilfe der Nervenbahnen in das Gehirn weitergeleitet. Das Gehirn fügt anschliessend die Nervenimpulse wieder zu Bildern zusammen. Alle Nervenbahnen zusammen bilden den Sehnerv. An der Stelle, wo der Sehnerv die Netzhaut verlässt befinden sich keine Stäbchen und Zapfen. Diese Stelle wird blinder Fleck genannt. Versuch zur Netzhaut Decke mit der linken Hand das linke Auge ab. Schaue mit dem rechten Auge auf den Kreis. Bewege den Kopf langsam zum Blatt hin. In den meisten Entfernungen sieht man auch das Kreuz. In einer bestimmten Distanz (ca. 30 cm) verschwindet das Kreuz. Das Bild des Kreuzes liegt im binden Fleck. Aufgabe 1: Die untere Abbildung zeigt eine stark vergrösserte Netzhaut. Beschrifte die Stäbchen, die Zapfen, die Pigmentschicht, die Nervenbahnen und die Lichtstrahlen. Färbe die Stäbchen und die Zapfen verschieden ein. S.Cocchi 9 Das Auge Aufgabe 2: Im oberen Text hast du einige neue Fachbegriffe gelernt. Lies den Text nochmals durch und versuche jeweils in eigenen Worten zu erklären, was die Aufgabe der einzelnen Bestandteile der Netzhaut ist. Stäbchen Zapfen Pigmentschicht Blinder Fleck Nervenbahnen Aufgabe 3: Die untere Tabelle erklärt den Sehvorgang. Die Reihenfolge ist jedoch falsch. Schreibe in die linke Spalte die richtige Nummer. Der Nervenimpuls wird über die Nervenbahnen in das Gehirn weitergeleitet. Die Stäbchen und die Zapfen (nur bei hellem Licht) werden angeregt. Das Licht trifft auf die Netzhaut und gelangt an den Nervenzellen vorbei zu den Sehsinneszellen. Durch die angeregten Sehsinneszellen zerfällt der Farbstoff in der Pigmentschicht und produziert einen Nervenimpuls. Aufgabe 4: Nachdem der Farbstoff in den Zellen der Pigmentschicht zerfallen ist und einen Nervenimpuls produziert hat, dauert es etwa eine Zehntelsekunde bis die Zelle wieder genügen Farbstoff produziert hat und bereit ist, einen neuen Nervenimpuls zu erzeugen. Warum ist diese Tatsache wichtig für das Kino? Aufgabe 5: Du kennst das Redewendung: „In der Nacht sind alle Katzen grau. Woran liegt das? S.Cocchi 10 Das Auge Der Sehvorgang Versuch zur Sammellinse Halte eine Lupe zwischen ein Blatt Papier und die Sonne. Bewege die Lupe langsam auf und ab. Was stellst du fest wenn du den Lichtpunkt auf dem Blatt beobachtest? Das Glas einer Lupe wird als Linse bezeichnet und ist speziell geschliffen. Eine Linse besteht aus lichtdurchlässigem Material und ist meistens von zwei schwach gewölbten Kugelflächen begrenzt. Eine Sammellinse ist in der Mitte dicker als am Rand. Die parallel einfallenden Lichtstrahlen werden in der Linse gebrochen (abgelenkt) und schneiden sich in einem Punkt hinter der Linse. In diesem Brennpunkt wird ein Bild am schärfsten dargestellt. Sammellinse Die ins Auge einfallenden Bild bestehend aus Gegenstand werden durch das optische System, ,L und Glaskörper gebrochen und gelangen auf die . In ihr liegen Brennpunkt die lichtempfindlichen Sinneszellen. Etwa drei bis sechs Millionen dienen dem Farbsehen, während die Schwarzweiss-Empfindung durch rund hundert Millionen vermittelt wird. Diese Sinneszellen werden durch das Licht gereizt. Die Erregungen werden über den zum Sehzentrum im geleitet und zu einer Wahrnehmung verarbeitet. Die sind jedoch viel weniger lichtempfindlich als die . Deshalb versagen sie ihren Dienst bereits in der Dämmerung, während die Stäbchen noch von schwachem Licht erregt werden. Da die Stäbchen aber farbunempfindlich sind, gleicht das entworfene Bild, das im Gehirn wahrgenommen wird, einer Schwarzweiss-Fotografie. S.Cocchi 11 Das Auge Akkommodation (Anpassung des Auges) Die Stäbchen arbeiten in einem bestimmten Helligkeitsbereich optimal. Deshalb wird das ins Auge einfallende Licht durch die Pupille reguliert. Diese Anpassungsfähigkeit des Auges wird Adaption genannt. Das Auge hat aber auch die Fähigkeit, sich für das Nahsehen und für das Weitsehen einzustellen, indem es die Linsenwölbung verändern kann. Das ist die Akkommodation. Zeichne den Strahlengang von einem nahen Objekt auf die Netzhaut! Zeichne auch die Linse ein. Zeichne den Strahlengang von einem fernen Objekt auf die Netzhaut! Zeichne auch die Linse ein. Der Unterschied besteht in der Krümmung der Linse und der Spannung der Linsenbänder. Beschreibe die Unterschiede. Welche Linse gehört zum Weit- resp. Nahsehen? S.Cocchi 12 Das Auge Räumliches Sehen Für was haben wir Menschen zwei Augen? Der Grund dafür ist, dass wir Dinge dreidimensional Sehen können. Dies lässt sich leicht an Hand eines kleinen Versuchs testen: Versuch zum räumlichen Sehen 1. Stelle einen Bleistift in Griffweite (ca. 40-50 cm) vor dir auf den Tisch. Halte nun mit einer Hand dein linkes Auge zu und versuche mit der anderen Hand den Gegenstand umzustossen. Was stellst du dabei fest? 2. Strecke deinen Arm von dir weg und halte den Daumen nach oben. Schaue nun abwechslungsweise nur mit einem Auge auf deinen Daumen. Was passiert mit dem Hintergrund? Der Grund dafür, dass wir räumlich sehen können liegt darin, dass unsere Augen etwas auseinander liegen und wir daher beim sehen zwei verschiedene Bilder sehen. In unserem Gehirn werden diese anschliessend zusammengesetzt. Folge den roten und blauen Sehnerven von den Augen bis ins Gehirn. Was fällt die auf? Halte einen Massstab neben deine Nase und fahre mit einer Bleistiftspitze von vorne auf den Kopf zu. Wo liegt die letzte Stelle die du noch scharf siehst? Bei cm S.Cocchi 13 Das Auge Sichtbarer Farbbereich Aus wie vielen Farben besteht ein Regenbogen? In welcher Reihenfolge sind diese Spektralfarben? (Zeichne einen kleinen Regenbogen) Versuch Stelle im Nebenraum die schwarze Lampe so auf, dass ihr Lichtkegel durch ein Glasprisma strahlt. Der Lichtkegel ändert im Prisma die Richtung und wird in seine Zusammensetzung (Spektralfarben) aufgespalten. Zeichne hier die Reihenfolge in welcher du die Spektralfarben siehst. Beginne bei Rot Rot Lies im Buch „Physik für die Sekundarstufe 1 die Texte auf Seite 40 unten und 41. Versuche die Fragen zu beantworten. Versuche nun zu erklären, weshalb am Abend der Himmel manchmal rot erscheint. (Tipp: in der Atmosphäre gibt es viele kleine Wassertröpfchen) In der gleichen Zusammensetzung ist auch unser Sonnenlicht. Es besteht aus verschiedenen Wellenlängen, welche wir als Farben wahrnehmen. Wenn nun diese Wellen auf einen Gegenstand treffen wird ein Teil von ihnen absorbiert (geschluckt). Die restlichen Wellen werden reflektiert (gespiegelt). Wir nehmen anschliessend nur die reflektierten Wellen war. Beispiel Auf einer Wiese steht eine grosse Tanne, deren Nadeln saftig grün scheinen. Welche Farben, resp. Wellenlängen, werden absorbiert und welche reflektiert? S.Cocchi 14 Das Auge S.Cocchi 15 Das Auge Farbenblindheit In der Umgangssprache meint man mit Farbenblindheit eigentlich die Farbenfehlsichtigkeit. Absolute Farbenblindheit ist glücklicherweise sehr selten. Die häufigste Störung ist die RotGrün-Schwäche. Bei der absoluten Farbenblindheit fehlen die Zapfen auf der Netzhaut komplett. Wie kommt das Farbensehen zu Stande? Unser Auge ist mit verschiedenen Sehzellen ausgerüstet. Für das Farbensehen haben wir in unserem Netzhautzentrum etwa 7 Millionen Zapfen. Einige Zapfen sind für die Wahrnehmung der Farbe Rot, andere für Grün oder Blau spezialisiert. Aus der Mischung dieser drei Grundfarben entsteht der Sinneseindruck Farbe. Wir sehen zum Beispiel Gelb, wenn die Rezeptoren für Grün und Rot durch gelbes Licht in einem bestimmten Verhältnis gereizt werden. Was versteht man unter Farbenfehlsichtigkeit? Bei der Farbenfehlsichtigkeit ist durch einen angeborenen (genetischen) Defekt mindestens eine der drei Zapfenarten nicht normal funktionsfähig und die entsprechende Grundfarbe kann nicht normal wahrgenommen werden. Dadurch können Betroffenen gewisse Farben gar nicht oder nur schlecht unterscheiden. Etwa 8.4% der Männer und 0.8% der Frauen haben eine Farbenfehlsichtigkeit. Am häufigsten ist die Rot-Grün-Sehschwäche. Dabei funktioniert die Zapfen für Grün oder Rot nicht mehr normal. Was ist Farbenblindheit? Wenn alle drei Zapfenarten ausfallen können Betroffene keine Farben mehr wahrnehmen. Dabei ist die eigentliche Farbenblindheit meist das kleinste Problem. Die Betroffenen leiden viel mehr unter der stark verminderten Sehschärfe (etwa 10-15% der normalen Sehschärfe) und einer starken Blendempfindlichkeit. Glücklicherweise ist diese ebenfalls vererbte Störung sehr selten. Was kann man dagegen tun? Die Farbenfehlsichtigkeit ist nicht heilbar. Wenn es sich nicht gerade um die schwere Störung der Farbenblindheit handelt, fühlen sich Betroffen meist erstaunlich wenig beeinträchtigt durch Ihre Farbsehschwäche. Zu beachten gilt es, dass gewissen Berufe für Betroffene nicht möglich oder ungeeignet sind: Beispielsweise Polizist, Berufspilot, Lokomotivführer, Grafiker/Drucker. Versuch zur Farbenblindheit S.Cocchi 16 Das Auge Fehlsichtigkeiten Kurzsichtigkeit Im Gegensatz zu Normalsichtigen liegt der Brennpunkt bei Kurzsichtigkeit Kurzsichtigen vor der Netzhaut meist ist das Auge zu kurz gebaut oder die Brechkraft der Hornhaut zu hoch. Zur Korrektur verwendet man Zerstreuungslinsen. Per Laser lassen sich Kurzsichtigkeiten bis -9 Dpt, bei ausreichend dicker Hornhaut evtl. auch bis -10 Dpt ausgleichen. Weitsichtigkeit Im Gegensatz zu Normalsichtigen liegt der Brennpunkt bei Weitsichtigen vor der Netzhaut. Bei geringer Ausprägung und in jungen Jahren kann das Auge die bestehende Weitsichtigkeit durch Akkommodation (Veränderung der Linsenform zum Nah- oder Fernsehen) ausgleichen. Mit zunehmendem Alter gelingt das nicht mehr eine Korrektur wird nötig. Dazu verwendet man Zerstreuungslinsen. Per Laser lassen sich Fehlsichtigkeiten bis 4 Dpt. ausgleichen. Astigmatismus (Hornhautverkrümmung) Weitsichtigkeit Die Hornhaut sollte normalerweise gleichmässig gewölbt sein, was sie aber in den seltensten Fällen ist. Durch Verkrümmungen in der Hornhaut kommt es zu unterschiedlich scharfen Abbildungen und Verzerrungen auf der Netzhaut ein Punkt kann z.B. zu einem Stab verzerrt werden. Häufig besteht neben einer Fehlsichtigkeit zusätzlich eine Hornhautverkrümmung. Der Fehler kann durch Zylindergläser korrigiert werden. Per Laser lassen sich Fehler bis ca. 3 Dpt korrigieren. Alterssichtigkeit Mit zunehmendem Alter lässt die Elastizität der Linse nach das Einstellen auf Nahes gelingt immer schlechter. Irgendwann wird dann eine Lesebrille benötigt. Die Alterssichtigkeit kann per Laser (noch) nicht korrigiert werden. Gelaserte (also dann Normalsichtige) Personen benötigen im Alter immer eine Lesebrille. Schaue durch die Brille eines Mitschülers. Welchen Effekt hat die Sehhilfe bei dir? S.Cocchi 17 Das Auge Wissensüberprüfung 1. Setz die Begriffe am richtigen Ort ein. Lichtstrahlen schluckt Gehirn reflektiert Sammellinsen steht auf dem Kopf gebrochen Lupe scharf Eine Tomate ist rot weil sie grünes, blaues und gelbes Licht rotes aber Die Aufgabe der Linse ist es, die zu sammeln. Fallen Lichtstrahlen durch eine Linse, können sie auf der anderen Seite nur an einem Ort abgebildet werden. Das Bild auf der Netzhaut Das dreht das Bild anschliessend wieder. Die Linse des Auges gleicht einer Man nennt diese Linsen Trifft ein Lichtstrahl auf eine Linse, geht er in einer anderen Richtung weiter. Man sagt er wird . 2. Schaue 30 Sekunden auf das Auge des Roten Fisches. Wechsle anschiessend schnell auf den roten Punkt. Erkläre das beobachtete 3. Brillengläser haben die gleiche Wirkung wie eine Lupe. Was ändert sich am Strahlengang? Zeichne den Strahlengang in die Abbildung! S.Cocchi 18 Das Auge 4. Kreuzworträtsel Waagrecht 2. Hautstück, welches das Auge verschliesst 5. Spannen die Linse 7. Anderer Name für die Regenbogenhaut 8. Hilfsmittel zum Brechen des Lichts 9. Häufigster Bestandteil des Auges 10. Sehhilfe 11. Eine „Zapfenfarbe 12. Fachbegriff für Licht schlucken Senkrecht 1. Sorgt für die Durchblutung des Auges 3. Grosser durchsichtiger Teil des Auges 4. Ein Sehfehler 6. Äussere Farbe des Regenbogens 5. Wie kommt das räumliche Sehen zustande? S.Cocchi 19 Das Auge Optische Täuschungen Sinnestäuschungen sind Produkte unserer Sinnesorgane und der zentralnervösen Auswertungsstelle, dem Gehirn. Sie entstehen in Grenzsituationen, wenn das Gehirn in seinem Bemühen, ein Bild zu etwas Erkennbarem und leicht Verständlichem zu verarbeiten, „falsche Schlüsse zieht. So entstehen die optischen Täuschungen. Auf den folgenden Seiten sind einige solche zu sehen. Optische Täuschung 1 – Grössenkonstanz Auf der Darstellung stehen die drei Mädchen in verschiedenen Tiefen des Raumes. Die weiter hinten stehenden Figuren werden darum durch unser Gehirn vergrössert. Versuche in einigen Worten zu erklären weshalb die hinteren Figuren grösser erscheinen als die vorderen: S.Cocchi 20 Das Auge Optische Täuschung 2 –Geometrische Täuschungen 1. Vergleiche die Längen der beiden niederen Balken auf dem Teppich vor dem Kamin 2. Vergleiche die hintere Teppichbreite mit der Teppichlänge 3. Vergleiche den Verlauf der Wandleiste rechts oben mit dem Verlauf auf der Wandleiste links unten 4. Vergleiche die vordere Teppichbreite mit der Breite der Rückwand des Raumes S.Cocchi 21 Das Auge Optische Täuschung 3 – 1 Bild, oder doch nicht? Was siehst du auf diesem Bild? Male die gesehen Bilder richtig aus Was siehst du hier? S.Cocchi 22 Das Auge