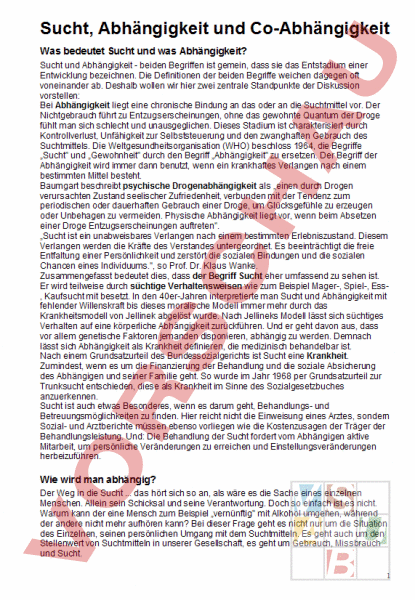Arbeitsblatt: Sucht / Suchtmittel
Material-Details
Sucht, Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit, Süchte & Drogen im Überblick
Lebenskunde
Drogen / Prävention
klassenübergreifend
10 Seiten
Statistik
11500
2684
99
05.11.2007
Autor/in
Princess13 (Spitzname)
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Sucht, Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit Was bedeutet Sucht und was Abhängigkeit? Sucht und Abhängigkeit beiden Begriffen ist gemein, dass sie das Entstadium einer Entwicklung bezeichnen. Die Definitionen der beiden Begriffe weichen dagegen oft voneinander ab. Deshalb wollen wir hier zwei zentrale Standpunkte der Diskussion vorstellen: Bei Abhängigkeit liegt eine chronische Bindung an das oder an die Suchtmittel vor. Der Nichtgebrauch führt zu Entzugserscheinungen, ohne das gewohnte Quantum der Droge fühlt man sich schlecht und unausgeglichen. Dieses Stadium ist charakterisiert durch Kontrollverlust, Unfähigkeit zur Selbststeuerung und den zwanghaften Gebrauch des Suchtmittels. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschloss 1964, die Begriffe „Sucht und „Gewohnheit durch den Begriff „Abhängigkeit zu ersetzen. Der Begriff der Abhängigkeit wird immer dann benutzt, wenn ein krankhaftes Verlangen nach einem bestimmten Mittel besteht. Baumgart beschreibt psychische Drogenabhängigkeit als „einen durch Drogen verursachten Zustand seelischer Zufriedenheit, verbunden mit der Tendenz zum periodischen oder dauerhaften Gebrauch einer Droge, um Glücksgefühle zu erzeugen oder Unbehagen zu vermeiden. Physische Abhängigkeit liegt vor, wenn beim Absetzen einer Droge Entzugserscheinungen auftreten. „Sucht ist ein unabweisbares Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und zerstört die sozialen Bindungen und die sozialen Chancen eines Individuums., so Prof. Dr. Klaus Wanke. Zusammengefasst bedeutet dies, dass der Begriff Sucht eher umfassend zu sehen ist. Er wird teilweise durch süchtige Verhaltensweisen wie zum Beispiel Mager-, Spiel-, Ess, Kaufsucht mit besetzt. In den 40er-Jahren interpretierte man Sucht und Abhängigkeit mit fehlender Willenskraft bis dieses moralische Modell immer mehr durch das Krankheitsmodell von Jellinek abgelöst wurde. Nach Jellineks Modell lässt sich süchtiges Verhalten auf eine körperliche Abhängigkeit zurückführen. Und er geht davon aus, dass vor allem genetische Faktoren jemanden disponieren, abhängig zu werden. Demnach lässt sich Abhängigkeit als Krankheit definieren, die medizinisch behandelbar ist. Nach einem Grundsatzurteil des Bundessozialgerichts ist Sucht eine Krankheit. Zumindest, wenn es um die Finanzierung der Behandlung und die soziale Absicherung des Abhängigen und seiner Familie geht. So wurde im Jahr 1968 per Grundsatzurteil zur Trunksucht entschieden, diese als Krankheit im Sinne des Sozialgesetzbuches anzuerkennen. Sucht ist auch etwas Besonderes, wenn es darum geht, Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten zu finden. Hier reicht nicht die Einweisung eines Arztes, sondern Sozial- und Arztberichte müssen ebenso vorliegen wie die Kostenzusagen der Träger der Behandlungsleistung. Und: Die Behandlung der Sucht fordert vom Abhängigen aktive Mitarbeit, um persönliche Veränderungen zu erreichen und Einstellungsveränderungen herbeizuführen. Wie wird man abhängig? Der Weg in die Sucht . das hört sich so an, als wäre es die Sache eines einzelnen Menschen. Allein sein Schicksal und seine Verantwortung. Doch so einfach ist es nicht. Warum kann der eine Mensch zum Beispiel „vernünftig mit Alkohol umgehen, während der andere nicht mehr aufhören kann? Bei dieser Frage geht es nicht nur um die Situation des Einzelnen, seinen persönlichen Umgang mit dem Suchtmitteln. Es geht auch um den Stellenwert von Suchtmitteln in unserer Gesellschaft, es geht um Gebrauch, Missbrauch und Sucht. 1 Dabei gibt es laut Hüllinghorst viele einzelne Schritte und gefährliche Übergänge: Wann hört der normale Gebrauch eines Mittels auf? Wo fängt der Missbrauch an? Ab wann wird ein Mittel gewohnheitsmäßig konsumiert? Wo beginnt die Abhängigkeit, die Sucht? • Unter Gebrauch wird die sinnvolle Verwendung von Suchtmitteln verstanden. Das bezieht sich sowohl auf den gelegentlichen Konsum, als auch auf andere Verwendungsarten (Alkohol zum Beispiel bei der Verwendung zur Wunddesinfektion). • Als Genuss wird definiert, wenn das Mittel zwar nicht benötigt wird, bei Gebrauch aber als angenehm empfunden wird (z. B. „mal ein Glas Bier, Wein etc.). • Der Missbrauch ist gekennzeichnet durch eine schädliche Verwendung quantitativer oder qualitativer Art (z. B. „sich sinnlos zu betrinken oder Alkohol im Straßenverkehr bzw. Trunkenheit am Arbeitsplatz). • Als Gewöhnung wird die physische oder psychische Bindung an ein Suchtmittel bezeichnet (z. B. jemand „braucht sein Bier, um abends abzuschalten). Aus der Gewöhnung folgt dann meistens als fließender Übergang der Schritt in die Abhängigkeit. Sehr schnell kann durch Lernen am „Erfolg aus einem erstmaligen Gebrauch eine Gewöhnung oder schlimmstenfalls eine Abhängigkeit entstehen. Dazu ein Beispiel: Vor einer wichtigen Klassenarbeit ist Katrin unheimlich nervös, obwohl sie eigentlich fleißig gelernt hat. Deshalb gibt ihr die Mutter eine halbe Beruhigungstablette. Die Klassenarbeit gelingt. Nun nimmt sie auch vor der nächsten, übernächsten und den weiteren Arbeiten eine Beruhigungstablette. Denn Katrin hat gelernt: Wenn ich vor einer Klassenarbeit oder Prüfung aufgeregt bin, nehme ich vorher einfach eine Tablette zur Beruhigung. Und das überträgt sie auf jede neue Anforderung. Es geht nicht mehr ohne Tablette. Katrin ist in eine psychische Abhängigkeit geraten. Warum wird man abhängig? Warum wird jemand abhängig? Diese Frage konnte bis heute nicht allgemein gültig beantwortet werden. Die Suchtfamilie, die Suchtpersönlichkeit, die Suchtursache all das trifft es nicht. Denn es sind immer mehrere Faktoren individuelle wie auch soziale welche in einem mehrjährigen Prozess der Suchtentwicklung zusammen wirken. Diese Frage lässt sich nur durch die intensive Auseinandersetzung mit der konkreten Lebensgeschichte des Betroffenen klären. In der Drogenforschung musste man erkennen, dass es keine eindeutigen Ursachen für abhängiges Verhalten gibt. Daher sollte der Begriff der „Ursache besser durch den Begriff des „Risikos ersetzt werden. Man geht davon aus, dass das Vorliegen bestimmter Bedingungen diese Wahrscheinlichkeit erhöhen kann. Beispielsweise, dass jemand überhaupt Zugang zu Drogen und Konsumverhalten bekommt und dieses erlernt und dann auch als Verhaltensmuster an- oder übernimmt, was unter weiteren ungünstigen Bedingungen zu einem abhängigen Missbrauchsverhalten führen kann. Welche Risiken können also in eine Abhängigkeit führen? Hüllinghorst von der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren sieht drei Problemkreise, die als auslösende und begünstigende Bedingungen oder Risiken für die Entwicklung einer Drogenabhängigkeit von Bedeutung sind. Diese liegen im einzelnen Menschen, im gesellschaftlichen Umfeld und im Suchtmittel: Der einzelne Mensch In der persönlichen Einstellung zum Suchtmittel liegt der Übergang zu den Risiken, die im Menschen selbst liegen. Welche Möglichkeiten hat er, um mit Problemen fertig zu werden? Ist er in seinen Entscheidungen autonom und frei, oder von anderen abhängig? Braucht er ein (Sucht-)Mittel, um persönliche Belastungen und Schwierigkeiten zu ertragen? Die Gesellschaft Unter welchen Bedingungen lebt der Einzelne? Findet er in seiner Arbeit Befriedigung? 2 Hat er Arbeit? Wird in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis viel Alkohol getrunken, oder ist es üblich, Haschisch zu rauchen? Das Suchtmittel Die als Suchtmittel bezeichneten Substanzen legal oder illegal haben eine Gemeinsamkeit: ihr Gebrauch kann zur Abhängigkeit führen und ist je nach Substanz mit mehr oder weniger Risiko verbunden. Man spricht hier vom so genannten Suchtpotenzial einer Substanz/Droge. Weitere Risiken liegen in der Griffnähe (Möglichkeiten und/oder Art und Weise des Zugangs), in der Gewöhnung (regelmäßiger/häufiger Konsum, Missbrauch) und in der Einstellung zum Suchtmittel (gehört es einfach dazu, mache ich nur mit, der Wirkung wegen). Etwas differenzierter betrachtet, geht man von vier Problemkreisen aus, welche die Entwicklung einer Drogenabhängigkeit begünstigen: • den sozialen Nahbereich des Individuums mit allen Beziehungen und Verhältnissen; • die Person des Konsumenten bzw. potentiellen Konsumenten in seiner psychischen, physischen, emotionalen und sozialen Entwicklung; • die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in ihrer objektiven und für das Individuum subjektiven Bedeutung sowie • die gesellschaftliche Akzeptanz, die Verfügbarkeit bzw. Erreichbarkeit und die Wirkungsweise der Droge. „Gute wie schlechte Verhaltensweisen werden im Laufe des Sozialisationsprozesses erworben und eine Vielzahl von Faktoren sind hieran beteiligt. Was wir lernen, hängt von unserem sozialen Kontext und von unserer individuellen Verstärkergeschichte ab. Vorbilder in der eigenen Familie, der sozialen Bezugsgruppe sowie aus der Werbung in den Massenmedien haben einen wesentlichen Einfluss auf unser Verhalten. Einflussfaktoren der Sozialisation Eltern und Familie Ein wichtiges Vorbild für den potentiellen Umgang mit psychoaktiven Substanzen sind die Eltern. Deshalb sollten Eltern ihr eigenes Verhalten gegenüber Suchtstoffen unbedingt kritisch beobachten. Eltern wirken mit ihrem Konsumverhalten als Modell für das heranwachsende Kind. Dort, wo der Konsum von Alkohol, Tabak und Medikamenten selbstverständlich ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche schon früh erste Erfahrungen mit diesen Mitteln machen. Noch entscheidender wirken sich jedoch Erziehungsfehler, die bei der Herausbildung der Persönlichkeitsstruktur des Heranwachsenden gemacht werden aus. Wenn es zum Beispiel an Selbstbewusstsein, Handlungskompetenz, Konfliktfähigkeit, positivem Selbstbild und stabilen Selbstwertgefühl mangelt, so steigt die Wahrscheinlichkeit für Missbrauch und Abhängigkeit. Eltern sind bis zur Pubertät das wichtigste Vorbild für die Entwicklung der Kinder. Sie tragen damit wesentlich zur Suchtprävention bei ihren Kindern bei. Die Gruppe der Gleichaltrigen und Bezugsgruppen In der Pubertät verblasst die Vorbildfunktion der Erwachsenen, besonders die der eigenen Eltern, immer mehr. Jugendliche stehen dann wesentlich stärker unter dem Einfluss von gleichaltrigen Bezugsgruppen, Cliquen (Peergroups) oder auch älteren Idolen. Die Gruppe der Gleichaltrigen gewinnt immer mehr an Bedeutung und übernimmt Aufgaben der psychischen Stabilisierung des Einzelnen. Der Einfluss von Gleichaltrigen oder Bezugsgruppen kann sich positiv wie negativ auswirken: Jugendliche, die sich in einer solchen Gruppe einer großen Akzeptanz erfreuen, können als Vorreiter einen negativen Einfluss auf das Drogenverhalten anderer ausüben. Denn fast immer erfolgt das Experimentieren mit Drogen in der Gruppe der Gleichaltrigen nur selten eigenständig. 3 Zum Missbrauch psychoaktiver Substanzen kommt es meistens in der pubertären Entwicklungs- und Ausprobierphase häufig als falsch verstandene Anpassung an soziale Normen und den Gruppendruck der Bezugspersonen. Zum Problem wird es, wenn der Konsum von Suchtmitteln zu den informellen Regeln der Gruppe gehört und wie eine Art Mutprobe zum „Eintrittsgeld zur Aufnahme in die Gruppe wird. Umgekehrt können Gleichaltrige aber auch eine wichtige positive Modellfunktion einnehmen, wenn es gelingt, sie von präventiven Aufgaben zu überzeugen. Oder wenn sie durch schulische und sportliche Erfolge positiv auffallen, können andere durch Lernen am Erfolg ihrem positiven Beispiel folgen. So haben präventive Aktivitäten in Schulen wesentlich bessere Erfolge, wenn sie von gleichaltrigen oder etwas älteren Schülern durchgeführt werden. Das gesellschaftliche Umfeld Unabhängig von der fachlichen Diskussion, wer den meisten Einfluss auf die kindliche Entwicklung hat seine Eltern oder andere Sozialisationsbegleiter so lässt sich, wenn die Voraussetzungen stimmen, Erziehung im besten Falle mit Primärprävention gleichsetzen. Den besten Schutz gegen Sucht und Gewalt bieten positive erwachsene Vorbilder, an denen sich die Kinder orientieren können. Erziehung kann schützen und stark machen. Mit dem Eintritt in die Schule, zum Teil aber auch schon mit dem Besuch des Kindergartens, geraten die Heranwachsenden in eine neue Situation. Die Bezugspersonen wechseln. Neben den Eltern übernehmen Pädagog(inn)en in Kindergarten, Schule und Sport- und sonstigen Vereinen immer mehr Verantwortung im Erziehungsprozess. Dabei sind die traditionellen Erziehungsinstitutionen für sich allein oftmals überfordert. Für Familien ist es schwer, ein kinderfreundliches Umfeld zu finden, denn durch das fortschreitende Schwinden natürlicher Bewegungsräume können sich Kinder immer weniger austoben. Zudem erhöht der wachsende Leistungsdruck der Gesellschaft und der sich verschärfende Wettbewerb im Hinblick auf die eigenen Zukunftschancen den psychosozialen Druck in der Schule. Durch die schwierige Situation im Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt werden eigene ökonomische Unabhängigkeit und das Erlebnis unmittelbarerer gesellschaftlicher Nützlichkeit immer später erfahren. Dem hohen Erwartungsdruck sind viele Jugendliche nicht gewachsen. Frustration und die Flucht in Scheinwelten können die Folge sein. Präventive Maßnahmen zur Förderung der Schutzfaktoren in Familie und Schule durchzuführen, ist ein wichtiger Schritt, bleibt aber Stückwerk, wenn nicht zusätzlich die Bevölkerung insgesamt für präventive Maßnahmen motiviert wird und geeignete gesellschaftliche Rahmenbedingungen zur Durchführung der Prävention geschaffen werden. Denn, auch wenn präventive Maßnahmen so gut wie nicht messbar sind, heißt das nicht, dass sie nicht wirksam sind! Co-Abhängigkeit Drogen beeinflussen jedoch nicht nur das Leben des Abhängigen, sondern ohne es zu wollen, werden nahestehende Personen wie Familienangehörige und engste Freunde zu „Mit-Abhängigen der Droge (lateinischer Ursprung con: mit). Angehörige leiden mit, weil sie erleben müssen, wie der Suchtkranke sich und seine Gesundheit ruiniert. Wenn man von Sucht und Abhängigkeit spricht, so spielt der Begriff der Co-Abhängigkeit zwangsläufig eine wichtige Rolle. Eltern, Ehepartner und Kinder sowie engste Freunde reiben sich im Kampf gegen die Sucht auf. Sie wollen helfen, werden aber immer wieder enttäuscht. Denn meistens sind alle ihre Versuche, den Abhängigen von seiner Sucht abzubringen, zum Scheitern verurteilt. Auch den Angehörigen kann dann wie dem Süchtigen selbst nur noch eine Beratung und Unterstützung von außen helfen. In Deutschland leben ungefähr 2,5 Millionen behandlungsbedürftig Alkoholkranke. Das bedeutet, dass in etwa jeder zehnten Familie ein Alkoholiker lebt. Insgesamt leben bei uns 4 also circa 8 Millionen Menschen „in enger Gemeinschaft mit einem alkoholabhängigen Menschen schätzt die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS). Rechnet man zudem mit rund 300.000 Konsumenten harter Drogen und 800.000 Medikamentensüchtigen, so haben noch einmal rund zwei bis drei weitere Millionen Menschen mit einer Suchtkrankheit zu tun. Viele Angehörige merken lange Zeit nicht, dass etwas nicht stimmt. Oft verschließen sie aber auch bewusst ihre Augen vor den an sich auffälligen Verhaltensweisen und merkwürdigen Wesensänderungen. Vor allem fürchten sie sich vor dem Gerede der anderen Leute, decken den Suchtkranken nach außen und werden so regelrecht zu dessen Komplizen. Um ihm zu helfen und ihm unangenehme Situationen zu ersparen, gehen die Angehörigen auf die Launen des Abhängigen ein, passen ihr Leben dem Süchtigen an und stellen eigene Interessen zurück. Die Sorge um den Suchtkranken beherrscht schließlich das ganze Denken der Angehörigen. Mit ihrer gut gemeinten Hilfe erreichen sie aber genau das Gegenteil: sie bringen den Abhängigen nicht von den Drogen los, sondern unterstützen vielmehr durch ihr „loyales Verhalten die Sucht und verlängern damit die Krankheit. Letztendlich geht es aber darum, den Suchtkranken mit der Realität seines Verhaltens und den negativen Konsequenzen zu konfrontieren. Er selbst muss dafür die Verantwortung übernehmen und von seiner Abhängigkeit loskommen wollen und dies bedeutet für die Co-Abhängigen „Hilfe durch Nichthilfe. Hilfe bei Co-Abhängigkeit • Bei Suchtproblemen in der Familie vertraute Personen wie den Vertrauenslehrer, Schulpsychologen etc. ansprechen oder Beratungsstellen um Hilfe bitten. Denn oft ist es einfacher, sich an Außenstehende als an Verwandte zu wenden. • „Hilfe durch Nichthilfe heißt nicht, den Suchtkranken im Stich zu lassen. Aber erst wenn der Leidensdruck beim Süchtigen groß genug ist, kann dies dazu führen, dass er selbst etwas ändern will. Denn den Willen zur Abstinenz kann nur der Betroffene selbst aufbringen. • Sich im Klaren sein, dass Sucht eine Krankheit ist, durch die der Abhängige oftmals die Kontrolle über sich verliert. Legale und illegale Drogen Was bedeutet das Wort Droge? Der Begriff Drogen stammt von dem niederländischen Wort drog und bedeutet trocken. Das ursprüngliche Verständnis des Begriffs Drogen bezeichnete getrocknete Pflanzen oder Kräuter, die als Gewürz, Parfüm oder Medizin genutzt wurden. In diesem Sinne versteht sich auch die im deutschen Sprachgebrauch heute noch verbreitete Bezeichnung der guten alten Drogerie. Und im Englischen steht drug nicht nur für Rauschgift, sondern ganz allgemein für Arzneimittel. So wusste man schon vor 4.700 Jahren im alten China die medizinische Wirkung der berauschenden Cannabispflanze zu nutzen und hielt dieses Wissen in Lehrbüchern über Botanik und Heilkunst fest. Heute gebrauchen wir die Bezeichnung Drogen weniger für Heil- oder Arzneimittel, sondern vor allem für Stoffe, die den Menschen körperlich und seelisch abhängig machen können und eher mit einem Missbrauch assoziiert werden. Kommt es zu einer krankhaften Abhängigkeit von solchen Substanzen, so gilt der Betroffene als drogensüchtig. 5 Also kann jedes Arzneimittel eine Droge sein, und fast jede Droge ein Medikament je nach Rezept, also Zubereitung, Einnahmeart, Dosierung, Anwendungsdauer und Zweck. Jede nicht medizinisch notwendige Einnahme von Arzneimitteln, wie zum Beispiel von Schmerz-, Schlaf- oder Betäubungsmitteln, ist ein Drogenmissbrauch. Was sind Drogen? Drogen sind Substanzen, die auf das zentrale Nervensystem einwirken und so in die natürlichen körperlichen Vorgänge eingreifen. Dabei können sie die Wahrnehmung von Sinneseindrücken, Gefühlen und Stimmungen beeinflussen. Unter Drogen verstehen wir alle Mittel, die anregen oder beruhigen. Stoffe, die den Menschen zunächst in angenehme aber auch unangenehme Stimmungen versetzen und ihn körperlich und seelisch abhängig machen können. Das gilt sowohl für legale Drogen wie Alkohol, Nikotin und pharmazeutische Produkte als auch für illegale Drogen wie Haschisch, Kokain, Heroin etc., deren Besitz, Handel, Anbau und Einfuhr unter Strafe stehen. Das Drogenlexikon beschreibt Drogen als Stoffe, die unser Bewusstsein verändern. Wegen ihrer direkten, bewusstseinsverändernden Wirkung auf unser zentrales Nervensystem, nennt man sie auch psychoaktiv oder psychotrop. Daher werden sie auch Betäubungsmittel genannt. Laut Betäubungsmittelgesetz fallen unter diesen Sammelbegriff alle Stoffe mit psychotropen, bewusstseins- und stimmungsverändernden Wirkungen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert jede Substanz als Droge, „die in einem lebenden Organismus Funktionen zu verändern vermag. Mit diesem erweiterten Drogenbegriff bezieht die WHO neben Cannabis, Kokain, Opiaten, Halluzinogenen, Tabak, Schmerzmitteln, Stimulantien, Schlaf- und Beruhigungsmitteln auch Alltagsdrogen wie zum Beispiel Kaffee und Tee mit ein. Warum nehmen Menschen Drogen? Ursprünglich wurden pflanzliche Drogen wegen ihrer berauschenden und bewusstseinsverändernden Wirkung von Medizinmännern, Schamanen, Priestern, Heilern und dergleichen verwendet, um während ihrer religiösen, kultischen oder magischen Zeremonien und Feierlichkeiten mit ihren Geistern, Göttern oder Kräften aus der Natur in Verbindung zu treten. Die Verwendung von Drogen kann bis in die Zeit von etwa 10.000 Jahren vor Christus zurückverfolgt werden. Die ersten weiter verbreiteten alkoholischen Rauschmittel in Deutschland waren Bier und Met. Außerdem verschiedene Pflanzen wie zum Beispiel Alraune, Stechapfel und Eibe, die als Heil-, Schlaf- oder Rauschmittel genutzt wurden. Drogenkonsum und -missbrauch kann viele Ursachen haben. Ein komplexes Geflecht von Ursachen kann diese Entwicklung beeinflussen: sie können sich auf die Persönlichkeit des Betroffenen, das soziale Umfeld oder die Anziehungskraft und Verfügbarkeit der Drogen zurückführen lassen (mehr hierzu unter Sucht, Abhängigkeit und CoAbhängigkeit). Alle diese Aspekte können den Einstieg in eine Drogenabhängigkeit begünstigen besonders, wenn mehrere negative Faktoren zusammen kommen. Eine pauschale Ursachenangabe für eine Drogenkarriere ist deshalb kaum möglich. Es gibt nur den Einzelfall. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum anzunehmen, dass nur labile, frustrierte, isolierte und besonders problembeladene Jugendliche, die aus kaputten Elternhäusern kommen, Drogen nehmen. Wenn man die Lebensläufe von Drogenabhängigen untersucht, dann gibt es ebenso Jugendliche, die aus so genannten intakten Familien kommen, in ihrer Klassengemeinschaft beliebt und im Freundeskreis tonangebend sind. Problematisch für den Umgang mit Suchtmitteln ist es auf jeden Fall, wenn ein Jugendlicher nicht gelernt hat, mit Konflikten umzugehen oder Enttäuschungen zu ertragen, wenn er Angst hat zu versagen, nicht akzeptiert zu werden, wenn er kein 6 Selbstwertgefühl hat und von Gefühlen wie Langeweile, Wut, Angst und Einsamkeit erdrückt wird. Baumgärtner fand durch eine Befragung von Hamburger Schülern und Lehrern im Jahr 2004 heraus, dass besonders bei illegalen Drogen Konsummotive wie ‚Neugier, ‚Neues und Aufregendes erleben am häufigsten als Grund für den Gebrauch von Drogen genannt wurden. Für jeden fünften Konsumenten übt vor allem das Verbotene den größten Anreiz zum Konsum aus. Und für etwa ein Drittel der befragten Konsumenten sind das ‚Gemeinschaftsgefühl und die ‚Geselligkeit ausschlaggebend. Das Bedürfnis, sich mittels verschiedenster Substanzen in einen Rauschzustand zu versetzen, ist so alt wie die Menschheit selbst. Dabei haben Leichtsinn und Unwissenheit immer wieder zu großen Problemen, zu Drogenmissbrauch geführt. Zusätzlich tendieren heute viele Drogenkonsumenten immer häufiger zum gefährlichen gleichzeitigen Mischen verschiedener Stoffe, zum so genannten „Mischkonsummuster. Legale und illegale Drogen Bei Drogen denken die meisten Menschen hauptsächlich an die illegalen Drogen, wie Cannabis, Ecstasy, Kokain, LSD oder Heroin und weniger an den Konsum von legalen Drogen wie Alkohol, Tabak und Medikamenten, der im Allgemeinen von der Gesellschaft überwiegend akzeptiert und toleriert wird. Jeder kann im Familien-, Freundes-, Kollegenoder Bekanntenkreis den selbstverständlichen Umgang mit Zigaretten, Alkohol und Schmerz- oder Beruhigungsmitteln beobachten. So kann ein ganz normaler Tag im Leben eines ganz normalen Menschen aussehen: Morgens erst mal einen Kaffee und eine Zigarette zum Aufwachen, dasselbe Ritual dann während der Arbeit, in der Uni, der Schule wo auch immer. Nach dem Mittagessen noch einen Kaffee, plus Zigarette zur Verdauung. Vielleicht noch ein Schnäpschen, das Essen war ja so fettig. Vor der schwierigen Prüfung eine Beruhigungstablette, eine Tablette gegen die fiesen Kopfschmerzen von der Arbeit am Computer oder gegen die Magenbeschwerden von dem vielen Kaffee, dem miesen Essen sowie dem ständigen Stress und Ärger. Abends dann ein, zwei, drei oder mehr Feierabendbierchen oder weinchen zur Entspannung, zum Abschalten, zum Vergessen. Und zum Einschlafen noch eine Schlaftablette, denn morgen ist ja wieder ein langer Tag . Heute ist der Konsum von Kaffee und Zigaretten sowie Alkohol und Medikamenten für viele Menschen schon fast selbstverständlich geworden. Deshalb werden sie auch Alltagsdrogen genannt. Natürlich fällt es vielen Menschen schwer, die oftmals als Genussmittel verharmlosten Alltagsdrogen als gefährliche Drogen anzusehen, doch gerade der Alkoholmissbrauch fordert Tausende Todesopfer. Und auch das Rauchen gilt weltweit als Krankheits- und Todesursache Nummer eins. Neben den gesundheitlichen Risiken darf man den volkswirtschaftlichen Schaden, der durch den Missbrauch oder die Gewöhnung an die legalen Drogen verursacht wird, nicht unterschätzen. Dazu einige alarmierende Zahlen, die zeigen, dass die legalen Drogen sehr viel weiter verbreitet, und nicht weniger gefährlich, als illegale Drogen sind: Deutschland kann sich laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) immer noch in die Gruppe der sieben Länder, in denen jährlich mehr als zehn Liter reiner Alkohol pro Kopf konsumiert werden, einreihen. So lag der Anteil der hierzulande allein durch Alkohol verursachten Todesfälle am Gesamtanteil der Todesfälle im Jahr 2003 in der Altersgruppe von 35 bis 65 Jahren bei Männern bei 25 Prozent und bei Frauen bei 13 Prozent. Und etwa 22 Prozent aller Todesfälle bei Männern und fünf Prozent bei Frauen seien dem Rauchen anzulasten, gibt die DHS in ihrem Suchtbericht 2005 bekannt. Außerdem kann ein Missbrauch von Alkohol, Nikotin und Medikamenten den Einstieg in den Konsum illegaler Drogen fördern, wie Studien zum Zusammenhang von legalen und illegalen Drogen belegen. 7 Zu Ihrer Information haben wir Ihnen unter Legale Drogen bzw. Illegale Drogen einen kurzen Überblick über die einzelnen Substanzen und deren gesundheitliche Risiken zusammengestellt. Positive und negative Tendenzen des Drogenkonsums Es gibt einige positive Entwicklungen des Drogenverhaltens in Deutschland, berichtet die DHS in ihrem Jahrbuch Sucht 2005: • die Anzahl der durch Alkohol verursachten Verkehrsunfälle hat sich gegenüber 1995 um die Hälfte verringert. Der Pro-Kopf-Konsum reinen Alkohols geht jährlich um 0,1 Liter zurück. Und insgesamt habe das Bewusstsein über die Gefährlichkeit des Alkoholkonsums zugenommen. • die Zahl der Raucher sei durch Tabaksteuererhöhungen und andere Restriktionen „massiv zurückgegangen. So habe der Umgang mit Tabak einen völlig veränderten Stellenwert Rauchen sei eigentlich schon out. • es gibt weniger vorzeitige Todesfälle von Konsumenten harter Drogen. • auch der Konsum von Heroin und Partydrogen ist weiterhin rückläufig. Aber auch einige negative Tendenzen, so Prof. Böning von der DHS: • Kinder beginnen immer früher Substanzen mit Suchtpotential zu konsumieren. • auch Tabak wird in immer jüngeren Jahren konsumiert, wobei besonders Mädchen vermehrt zur Zigarette greifen. • weiterhin zugenommen hat auch der Konsum von Cannabisprodukten verstärkt bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. • zu Essstörungen kommt es immer häufiger bereits in einem Alter von 15 Jahren Diese negativen Tendenzen, die sich in den letzten Jahren abgezeichnet haben, betreffen in erster Linie Kinder und Jugendliche. Weil der Organismus von Kindern und Jugendlichen noch nicht ausgewachsen und besonders anfällig ist, und weil sie auch psychisch neue Anforderungen und jede Menge Neuorientierungen zu meistern haben, sind sie nach Ansicht von Böning besonders gefährdet. Weltweit lassen sich eher negative Tendenzen beobachten, denn die Anzahl der Drogenabhängigen hat sich im letzten Jahr um acht Prozent auf 200 Millionen Drogenkonsumenten erhöht, berichten die Vereinten Nationen in ihrem Jahresbericht im Juni 2005. Von den illegalen Rauschgiften wird weltweit am meisten Cannabis produziert, verkauft und konsumiert. Der vermehrte Gebrauch von Cannabis ist der Hauptgrund für den Anstieg der Abhängigenzahl. Laut UN gehen die größten Gesundheitsgefahren jedoch weiterhin von Heroin und Kokain aus. Etwa fünf Prozent der Weltbevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren haben im letzten Jahr mindestens einmal Drogen genommen. In absoluten Zahlen seien das 15 Millionen Konsumenten mehr als im Vorjahr, so die UN. Bereits im Jahr 2003 hätten 160 Millionen Menschen Cannabis-Produkte verbraucht zehn Millionen mehr als im Jahr zuvor. Nach Ansicht der UN deuten „alle Anzeichen daraufhin, dass der Markt weltweit weiter wächst, berichtet die SZ am 30. Juni 2005. So sei der Umsatz in Höhe von 265 Milliarden Euro im Drogenhandel größer als die einzelnen Bruttoinlandsprodukte von fast 90 Prozent der Staaten in aller Welt, gibt Antonio Maria Costa, Leiter des UN-Büros für Drogen und Verbrechen (UNODC), zu Bedenken. Obwohl die Konsumentenzahlen weiterhin ansteigen, sehen die Vereinten Nationen doch einen positiven Trend innerhalb der Entwicklung: Im Jahr 2003 hätten 44 Prozent der Staaten einen Anstieg des Drogenkonsums vermeldet, während es im Jahr 2000 noch 53 Prozent der Staaten waren. (SZ, 30.6.2005) 8 Süchte Drogen im Überblick • Alkohol (Ethanol) • Alkohol bei Kindern und Jugendlichen • Nikotin • NEU: Wie höre ich mit dem Rauchen auf? • Koffein (Trimethylxanthin) • Natural Drugs, Smart Drugs • Psychopharmaka Diazepam (Valium) Ritalin • Opiate • Heroin • Halluzinogene Designerdrogen Amphetamin (Speed) • MDMA (Ecstasy, XTC) • Gammahydroxybuttersäure (GHB, Liquid ecstasy) • Cannabis • Kokain • Anabole Steroide • Keiner Kontrolle unterliegende Drogen • Schnüffelstoffe • Poppers • Nicht substanzgebundene Drogen Eßstörungen Genetisch bedingte Esssucht 9 Essattacken, Binge-Eating-Disorder Adipositas Orthorexia nervosa Anorexie Bulimie Latente Esssucht Spielsucht am Computer Internetsucht Kaufsucht Workaholic die Sucht nach der Arbeit Hörigkeit Das Messie-Syndrom 10