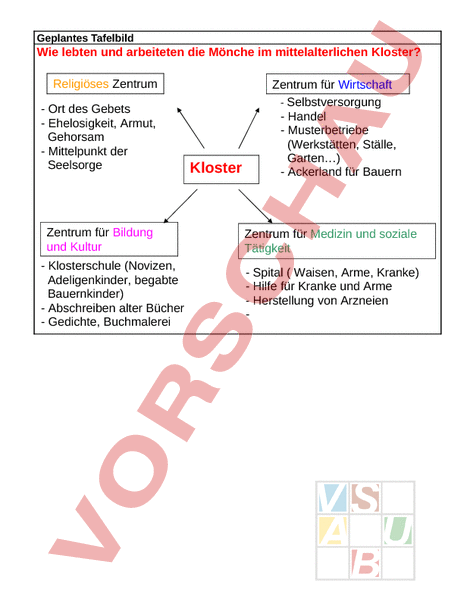Arbeitsblatt: Kloster im Mitetlalter
Material-Details
Erarbeitung eines Tafelbilds über die Aufgaben des Klosters im Mittelalter
Geschichte
Mittelalter
8. Schuljahr
10 Seiten
Statistik
119133
967
19
06.08.2013
Autor/in
Samuel Glaser
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Geplantes Tafelbild Wie lebten und arbeiteten die Mönche im mittelalterlichen Kloster? Religiöses Zentrum Ort des Gebets Ehelosigkeit, Armut, Gehorsam Mittelpunkt der Seelsorge Zentrum für Bildung und Kultur Klosterschule (Novizen, Adeligenkinder, begabte Bauernkinder) Abschreiben alter Bücher Gedichte, Buchmalerei Kloster Zentrum für Wirtschaft Selbstversorgung Handel Musterbetriebe (Werkstätten, Ställe, Garten) Ackerland für Bauern Zentrum für Medizin und soziale Tätigkeit Spital Waisen, Arme, Kranke) Hilfe für Kranke und Arme Herstellung von Arzneien Text 1 Religiöses Zentrum Im Mittelalter wählten Menschen ein Leben im Kloster aus verschiedenen Gründen: Starker Glaube an Gott, Adeliger ohne Erbschaft, Versorgung und Schutz. Die Regeln des Ordens gaben den Mönchen eine klare Tagesordnung vor und das Alltagsleben der Mönche wurde durch das Gebet und die Arbeit stark geprägt. Sie standen um zwei Uhr auf, beteten und sangen siebenmal am Tag, aßen zweimal warm und arbeiten dazwischen hart. Im Benediktinerkloster war der Tagesablauf durch strenge Regeln des heiligen Benedikt bestimmt. Die Mönche lebten nach drei Gelübden: Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam gegenüber dem Abt, dem Klosterführer, und ihrem obersten Grundsatz, der lautet: „Ora et labora! („Bete und arbeite!). Bei groben Regelverstößen wurden die Mönche vom Abt aus dem Kloster verbannt. Die Benediktinerregel bildete auch die Grundlage für Frauenklöster, deren Vorschriften meist noch strenger ausfielen. Der Mönch besaß kein privates Eigentum, er wurde aus dem Klosterbesitz mit allem Notwendigen versorgt. In der Klosterkirche gab es regelmäßig Gottesdienste für die Bevölkerung. Die Menschen im Mittelalter waren wesentlich enger mit Gott verbunden als heute. Sie erflehten Segen für Hütten und Häuser, reiche Ernten oder das Gelingen eines guten Geschäftes. Das Kloster war Mittelpunkt der Seelsorge. Text 2 Zentrum für Medizin und soziale Tätigkeit Das Kloster war auch ein Ort der Nächstenliebe: Oft war es die einzige Hilfe für Kranke und Arme. Gerade in den Städten des Mittelalters gab es viele Krankheiten und Seuchen. Die Menschen lebten auf engstem Raum und die Hygiene war sehr schlecht. Der Pförtner kümmerte sich um die Armen. Hierfür wurde 1/10 aller Einkünfte zur Verfügung Kleidung wurden gestellt. und sie selten auch für Die auch kurze Armen mit Geld Zeit im wurden versorgt. Kloster In mit Nahrung, besonderen aufgenommen Fällen hierzu musste aber zuerst die traditionelle Fußwaschung vorangehen. Die Sorge für die Kranken selbst lag im frühen Mittelalter ausschließlich in den Händen der Geistlichkeit, vor allem der Mönche, die häufig medizinisches Wissen und Erfahrung in der Krankenpflege besaßen. Die Mönche, und die Nonnen in Frauenklöstern, stellten Medizin und Salben selbst her. Die Heilpflanzen dafür bauten sie ebenfalls an. Den größeren Klöstern, deren Hauptaufgabe die Seelsorge 1 darstellte, war meist ein Spital angegliedert. Hier konnten Kranke Zuflucht suchen, doch nahm man auch Schwache, Bedürftige, Arme und Waisen auf. Klöster beherbergten2 auch Reisende. Sie fanden dort Ruhe und Verpflegung und konnten sich auf das Gebet konzentrieren. 1 2 Bemühen um den Menschen und seiner Beziehung zu Gott Unterkunft geben Text 3 Zentrum für Wirtschaft Die Klöster waren nicht nur Orte des Gottesdienstes, sondern auch selbstständige Wirtschaftsbetriebe. So waren sie von der restlichen Bevölkerung relativ unabhängig und konnten sich selbst versorgen. Die Klöster besaßen ihre eigenen Ländereien, die meist durch Schenkungen in ihren Besitz kamen. Schenkungen an Klöster waren in der damaligen Zeit weit verbreitet. Man tat es um Gott zu gefallen und die Klöster zu unterstützen, aber auch um die politische Macht der Kirche und der Klöster zu stärken. Klöster besaßen neben dem eigentlichen Hauptgebäude eine Reihe von Wirtschaftsgebäuden, z.B. Werkstätten wie Schmiede, Wagnerei (Herstellung und Reparatur von Wagen), Küferei (Herstellung von hölzernen Gefäßen/Bottichen) und Mühle, Brauereien, Bäckereien, Viehställe und Gärten. Die Mönche hatten eine eigene Landwirtschaft und trieben Handel mit Wein und Salz. Der Unterhalt der Klöster wurde durch den Verkauf von Wirtschaftsprodukten finanziert, sowie durch die Verpachtung von Grundbesitz. Die Pächter mussten Abgaben leisten und meist auch Frondienste 1. Die Mönche arbeiteten auf dem Feld, rodeten 2 Wälder und legten Sümpfe trocken. Sie gründeten Dörfer und zeigten den Bauern, wie man Ackerland gewinnt und ein landwirtschaftliches Gut führt. Als Wirtschaftsbetrieb waren die Klöster Musterbetriebe für die gesamte Umgebung. 1 2 Arbeiten, anstatt zu bezahlen Bei der Rodung werden Bäume und Sträucher mitsamt ihrer Wurzeln dauerhaft entfernt. Text 4: Zentrum für Bildung und Kultur Bis zum 12.Jahrhundert lag das Bildungswesen ausschließlich in den Händen der Kirche. Bis auf wenige Ausnahmen, konnten nur die Mönche und Nonnen in den Klöstern Lesen und Schreiben. Dadurch konnten nur sie diese Fähigkeiten weitervermitteln. Die wohlhabende Gesellschaft schickte ihre Kinder in Klöster, um dort das Lesen und Schreiben zu erlernen. Die Klöster erhielten dafür Ländereien und finanzielle Unterstützung. Eine Schulpflicht bestand nicht. Die Klosterschulen waren für die Öffentlichkeit verschlossen, aber nicht nur Söhne und Töchter von Adeligen wurden aufgenommen, sondern auch begabte Bauernkinder. Die Schüler, welche später selbst Mönch oder Nonne werden sollten, nannte man Novizen. Der Schulalltag der Klosterschüler begann erst im Alter von sieben Jahren und dauerte acht Jahre an. Neben schulischen Tätigkeiten wurden z.B. auch Feldarbeiten verrichtet; dadurch hatten die Kinder fast keine Freizeit. Es wurde Lesen und Schreiben in lateinischer Sprache und eher selten auch Mathematik unterrichtet. Die Lehrer konnten über den Lehrstoff selbst frei entscheiden, da keine Lehrpläne vorhanden waren. Die Prügelstrafe war auch in Klöstern erlaubt und allgegenwärtig. Die Mönche schrieben Bücher und Bibeln mit der Hand ab und bemalten die Seiten kunstvoll. So trugen sie zur Bewahrung des Wissens bei. Sie sammelten ebenfalls Gedichte und Lieder. Religiöses Zentrum Zentrum für Wirtschaft Zentrum für Bildung und Kultur Zentrum für Medizin und soziale Tätigkeit Kloster