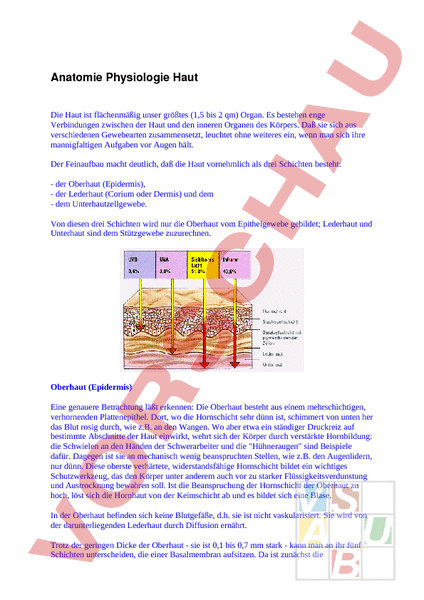Arbeitsblatt: Anatomie Haut
Material-Details
Beschreibung der Anatomie und Physioloige der Haut
Biologie
Anatomie / Physiologie
10. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
129088
1163
8
05.03.2014
Autor/in
Jessica Stauber
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Anatomie Physiologie Haut Die Haut ist flächenmäßig unser größtes (1,5 bis 2 qm) Organ. Es bestehen enge Verbindungen zwischen der Haut und den inneren Organen des Körpers. Daß sie sich aus verschiedenen Gewebearten zusammensetzt, leuchtet ohne weiteres ein, wenn man sich ihre mannigfaltigen Aufgaben vor Augen hält. Der Feinaufbau macht deutlich, daß die Haut vornehmlich als drei Schichten besteht: der Oberhaut (Epidermis), der Lederhaut (Corium oder Dermis) und dem dem Unterhautzellgewebe. Von diesen drei Schichten wird nur die Oberhaut vom Epithelgewebe gebildet; Lederhaut und Unterhaut sind dem Stützgewebe zuzurechnen. Oberhaut (Epidermis) Eine genauere Betrachtung läßt erkennen: Die Oberhaut besteht aus einem mehrschichtigen, verhornenden Plattenepithel. Dort, wo die Hornschicht sehr dünn ist, schimmert von unten her das Blut rosig durch, wie z.B. an den Wangen. Wo aber etwa ein ständiger Druckreiz auf bestimmte Abschnitte der Haut einwirkt, wehrt sich der Körper durch verstärkte Hornbildung: die Schwielen an den Händen der Schwerarbeiter und die Hühneraugen sind Beispiele dafür. Dagegen ist sie an mechanisch wenig beanspruchten Stellen, wie z.B. den Augenlidern, nur dünn. Diese oberste verhärtete, widerstandsfähige Hornschicht bildet ein wichtiges Schutzwerkzeug, das den Körper unter anderem auch vor zu starker Flüssigkeitsverdunstung und Austrocknung bewahren soll. Ist die Beanspruchung der Hornschicht der Oberhaut zu hoch, löst sich die Hornhaut von der Keimschicht ab und es bildet sich eine Blase. In der Oberhaut befinden sich keine Blutgefäße, d.h. sie ist nicht vaskularisiert. Sie wird von der darunterliegenden Lederhaut durch Diffusion ernährt. Trotz der geringen Dicke der Oberhaut sie ist 0,1 bis 0,7 mm stark kann man an ihr fünf Schichten unterscheiden, die einer Basalmembran aufsitzen. Da ist zunächst die Basalzellschicht (Stratum basale). Sie sitzt einer Basalmembran auf, die ihrerseits an die Lederhaut grenzt. Letztere dringt mit kleinen regelmäßigen Ausstülpungen, den sogenannten Papillen, in sie ein. In der Stachelzellschicht stehen die Zellen über Zytoplasmafortsätze in Verbindung, wodurch sie ein stacheliges Aussehen erhalten. Die Basalzellschicht und die Stachelzellschicht wird auch als Keimschicht bezeichnet, da hier die Zellteilung stattfindet. Da dieser Vorgang sehr strahlenempfindlich ist, sind in die Keimschicht Melaninzellen (Pigmentzellen) eingelagert. Sie bilden einen braunschwarzen Farbstoff, der ultraviolette Strahlen abfängt. Ist die Haut diesen Strahlen in stärkerem Maße ausgesetzt, wird dieser Farbstoff verstärkt gebildet und es kommt zur Hautbräunung. Die Körnerzellschicht (Stratum granulosum) besteht aus platten Zellen, die Körner enthalten, in denen sich ein Vorstadium von Horn befindet (Keratohyalinkörnchen). Die Glanzschicht (Stratum lucidum) kommt nur an dicken Epidermisstellen vor, wie Hohlhand und Fußsohle. Sie enthält eine stark lichtbrechende Substanz, das Eleidin, eine Zwischenform von Keratohyalin zu Horn. Die Hornschicht (Stratum corneum), das ist die äußerste Schicht, besteht aus platten, kernlosen Zellen, die mit Hornstoff (Keratin) vollgefüllt sind. In der obersten Hornhautschicht sind die Zellgrenzen nicht mehr zu erkennen. In der Basalzellschicht entstehen ständig neue Zellen. Sie wandern zur Oberfläche hin, reifen und verändern sich dabei. Nachdem sie die Stachelzellschicht, die Körnerzellschicht und die Glanzschicht an den stärker verhornten Stellen durchlaufen haben, gelangen sie als kernlos gewordene, abgestorbene Hornzellen in die äußere Hornschicht. Hier bilden sie, dicht gedrängt und übereinandergeschichtet, die eigentliche sichtbare Oberfläche des Körpers. Die Hornzellen werden dann permanent als feinste Schuppen abgestoßen, was normalerweise unbemerkt geschieht. Die Kopfhautschuppen bilden eine der Ausnahmen. Vom Entstehen bis zum Abstoßen der Zellen vergehen knapp 30 Tage. Die Schuppung der Haut ist hier auch in den Rhythmus als eine Urerscheinung allen Lebens eingebettet. Wir sind bei diesem Geschehen in den Rhythmus des Naturgeschehens ebenso eingebettet, wie wir ihren Einflüssen ausgesetzt sind. Die Oberhaut ist auch Sitz hochspezialisierter Zellen wie der Langerhans-Zellen, die als Außenposten des Immunsystems sowohl Fremdstoffe unschädlich als auch durch Botenstoffe andere Abwehrstoffe alarmieren sollen. Lederhaut (Corium, Dermis) Die Grenze zwischen Oberhaut und Lederhaut ist deutlich zu erkennen. Die beiden Hautschichten sind fest miteinander verwachsen. Daß die Haut dennoch in ihrer Gesamtheit so gut verschiebbar ist, wird der dritten Schicht, dem Unterhautzellgewebe verdankt. Die Lederhaut besteht aus einem festen Geflecht geschmeidiger Bindegewebsfasern und verleiht dem Hautganzen die nötige Festigkeit und Elastizität und Dehnbarkeit. Daneben enthält sie Nerven, Blut- und Lymphgefäße. Sie hat gewöhnlich eine Dicke von 1 bis 2 Millimetern. Schneidet man sich in den Finger, daß es blutet, so hat man nicht nur das Epithel durchtrennt, sondern auch bereits die Lederhaut verletzt. Sie grenzt nicht etwa in flacher Linie an die Oberhaut, sondern ragt mit Zapfen, die wie Wellenberge und -täler anmuten, in die Epidermis hinein; und in diesen Erhebungen sind Knäuel der feinsten Blutgefäßendigungen (Kapillaren, lat. capillus Haar, also haarfeine Gefäße), sowie die später noch zu erwähnenden Tastkörperchen der Hautnerven untergebracht. Die wie Wellenberge- und -täler anzusehenden feinen Rillen sind nach einem individuellen Muster angeordnet, das es möglich macht, einen Menschen aufgrund seiner Fingerabdrücke zu indentifizieren. Die Lederhaut selbst besteht aus zwei Schichten, dem Papillarkörper (Stratum papillare) und einer darunter verlaufenden faserreichen Bindegewebsschicht, die als Netzschicht (Stratum reticulare) bezeichnet wird. Sie enthält größere Nerven, Blut- und Lymphgefäße, Haarfollikel und Talgdrüsen. Aus der Verzahnung der Papillarkörper mit der Netzschicht ergibt sich eine große Kontaktfläche für den Austausch von Substanzen. Dies ist notwendig, weil die Oberhaut von unten her ernährt und entsorgt wird. Dazu hat die Natur es eingerichtet, daß durch die Lederhaut etwa ein Viertel des gesamten Blutes fließt. Dies ist notwendig, um Sauerstoff, Nähr- und Baustoffe heranzuschaffen und Abfallstoffe aus dem Stoffwechsel abzutransportieren. Dazwischen verlaufen freie Nervenendungen oder Nerven, die zu Sinneskörperchen, den Rezeptoren, führen. Die freien Endungen vermitteln nur Sinnesempfindungen, die einfache primitive Wahrnehmungen betreffen. Die Rezeptoren hingegen besitzen ein höher empfindliches und besser differenzierendes Unterscheidungsvermögen für ganz bestimmte Reize wie Schmerz, Druck, Wärme oder Kälte. In der Lederhaut haben sich auch die Schweiß- und Talgdrüsen festgesetzt, die aus Anlagen in der Oberhaut entstehen. Äußerst bedeutsam für die Fragen der Gesunderhaltung der Haut ist auch, wo sich der größte Wasserspeicher des Körpers befindet, denn er Bedarf einer ständigen Pflege und Auffüllung. Er befindet sich in der Lederhaut und dem Unterhautzellgewebe. Hier sammelt sich etwa ein Drittel aller Flüssigkeit. Wie vielfältig die Aufgaben der Zellen und des Gewebes der Lederhaut sind, ergibt sich auch aus den Feststellungen der Wissenschaft, daß sich auf einem Quadratzentimeter etwa 100 Schweißdrüsen, bis zu 40 Talgdrüsen, annähernd 200 Schmerzrezeptoren, etwa 100 Rezeptoren für die Wahrnehmung von Druck, zwölf für Kälte- und zwei für Wärmemeldungen befinden. All diese Funktionen müssen mit Energie versorgt werden, sollen sie korrekt arbeiten. Aber auch wichtige Bestandteile des Immunsystems der Haut sind in der Lederhaut plaziert. Es sind dies die T-Lymphozyten, die Monozyten, die Makrophagen, die Plasmazellen und die Mastzellen. Unterhautzellgewebe Das Unterhautzellgewebe dient der Anheftung der Haut an die Unterlage. Bezeichnend für diese Hautschicht ist der Reichtum an Fettgewebe, das bisweilen zumal an der Bauchhaut eine Dicke von 15 cm und mehr erreichen kann. Die Dicke der zwischen zwei Fingern angehobenen Bauchhaut dient normalerweise denn auch als Grad für die Fettleibigkeit eines Menschen. Das Fettgewebe dient als Nahrungsreserve, der Wärmeisolierung und der Polsterung. Die Anzahl der Fettzellen hängt unter anderem von der Ernährung in der Kindheit ab. Bestimmte Teile des Körpers dienen bevorzugt als Fettspeicher, wie z.B. Bauch, Hüften und Gesäß. Neben Fettzellen enthält das Unterhautzellgewebe auch noch eine Vielzahl von Nerven und Blutgefäßen. An das Unterhautgewebe schließt sich dann ein Muskel, Knochen, Knorpel oder sonstiges Organ an, die mit großen Faserbündeln befestigt sind. Damit wird deutlich, daß das Unterhautzellgewebe das Bindeglied zwischen dem Körper und seiner äußeren Hülle ist.