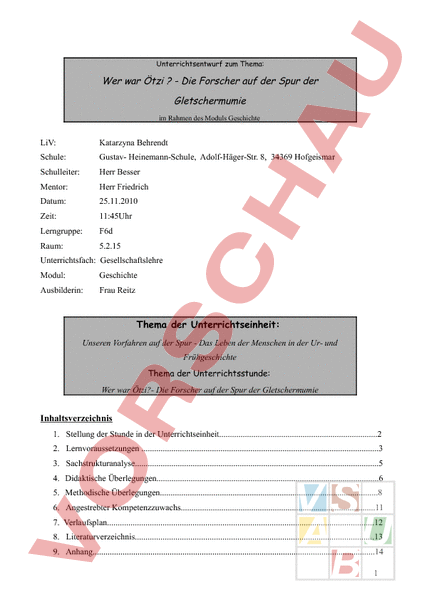Arbeitsblatt: Unterrichtsentwurf Ötzi
Material-Details
Unterrichtsentwurf zum Thema Steinzeit (Ötzi)
Geschichte
Urzeit
6. Schuljahr
22 Seiten
Statistik
137290
2774
37
05.10.2014
Autor/in
Katarzyna Behrendt
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Unterrichtsentwurf zum Thema: Wer war Ötzi - Die Forscher auf der Spur der Gletschermumie im Rahmen des Moduls Geschichte LiV: Katarzyna Behrendt Schule: Gustav- Heinemann-Schule, Adolf-Häger-Str. 8, 34369 Hofgeismar Schulleiter: Herr Besser Mentor: Herr Friedrich Datum: 25.11.2010 Zeit: 11:45Uhr Lerngruppe: F6d Raum: 5.2.15 Unterrichtsfach: Gesellschaftslehre Modul: Geschichte Ausbilderin: Frau Reitz Thema der Unterrichtseinheit: Unseren Vorfahren auf der Spur Das Leben der Menschen in der Ur- und Frühgeschichte Thema der Unterrichtsstunde: Wer war Ötzi?- Die Forscher auf der Spur der Gletschermumie Inhaltsverzeichnis 1. Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit2 2. Lernvoraussetzungen .3 3. Sachstrukturanalyse5 4. Didaktische Überlegungen6 5. Methodische Überlegungen8 6. Angestrebter Kompetenzzuwachs.11 7. Verlaufsplan.12 8. Literaturverzeichnis13 9. Anhang14 1 1. Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit Thema der Unterrichtseinheit: Unseren Vorfahren auf der Spur Das Leben der Menschen in der Ur- und Frühgeschichte Stunde Thema der Stunde Angestrebter Kompetenzzuwachs 1 Die Arbeit der Archäologen Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Herkunft unseres heutigen historischen Wissens, indem sie sich mit dem Beruf und der Arbeitsweise der Archäologen auseinandersetzen. 2 Auf den Spuren der ersten Die Schülerinnen und Schüler benennen die wichtigen Menschen Entwicklungsstufen in der Evolution des Menschen. Sie entwickeln ihre Anerkennung für das „Andere, indem sie schlussfolgern, dass alle Menschen weltweit dieselben Wurzeln haben. 3 Das Leben der Jäger und Die Schülerinnen und Schüler beschreiben historische Sammler in der Altsteinzeit Verhältnisse und das Handeln der steinzeitlichen Menschen unvoreingenommen als anders (nicht rückständig), indem sie sich mit der altsteinzeitlichen Lebensweise und besonderen Fähigkeiten der Jäger und Sammler auseinandersetzen. 4 Menschen werden sesshaft Die Schülerinnen und Schüler stellen fest, dass das Streben nach intensiver Nutzung natürlicher Ressourcen das Leben der Menschen bis heute beeinflusst, indem sie die Fragen nach Voraussetzungen des allmählichen gesellschaftlichen, technologischen und kulturellen Wandels im Übergang von Alt- zur Jungsteinzeit beantworten. 5 Das Leben in der Jungsteinzeit Die Schülerinnen und Schüler nehmen die Veränderungen in der Geschichte wahr, indem sie die Vorteile und Schwierigkeiten des jungsteinzeitlichen Übergangs zu Feldanbau und Viehhaltung verbunden mit der sesshaften Lebensweise (neoloitische Revolution) gegenüber dem früheren Nomadenleben herausstellen. 6 Wer war Ötzi?- die Forscher auf der Spur der Gletschermumie Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre historische Orientierungskompetenz, indem sie zum Ergebnis kommen, dass es bei der Interpretation archäologischer Funde gleichwertig plausible Interpretationslinien gibt und feststellen, dass die Quellen (archäologische Funde) uns dabei helfen, Geschichte zu rekonstruieren, aber nicht alle Fragen beantworten können. 7 Die Menschen nutzen das Die Schülerinnen und Schüler erläutern, welche Metall Veränderungen die Gewinnung und Verarbeitung von Metall in der Lebensweise und im Zusammenleben der Menschen bewirkte, indem sie sich mit der Kultur der Kelten auseinandersetzen. 8 Besuch der Ausstellung im Die Schülerinnen und Schüler stellen die Verbindung Naturkundemuseum: zwischen dem schulischen Unterricht und dem Lernort Evolution der Menschen Museum her, indem sie die Ausstellung Evolution der Menschen besuchen und an einem Workshop teilnehmen. 2 2. Lernvoraussetzungen Die Klasse F6b besteht aus 21 Schülerinnen und Schülern im Alter von 11 bis 13 Jahre, wovon 8 Mädchen und 13 Jungen sind. Die Lerngruppe habe ich in der zweiten Hälfte des vergangenen Schuljahres 2009/2010 übernommen und unterrichte dort seitdem drei Stunden in der Woche eigenverantwortlich. Meine Eindrücke von der Lerngruppe sind positiv. Die Klasse verhält sich mir gegenüber offen und freundlich. Die Gustav-Heinemann-Schule ist eine kooperative Gesamtschule, die sich als Ziel setzt, die Schülerinnen und Schüler in der Förderstufe (5./6. Klassen) auf die verschiedenen Bildungsgänge vorzubereiten. Dies hat zur Folge, dass das Leistungsniveau in den betroffenen Jahrgangsstufen oftmals sehr differenziert ist. Dies gilt auch für die Klasse F6d, die insgesamt als sehr heterogen in ihrem Entwicklungsstand und ihrem Leistungsvermögen zu bezeichnen ist, was man an der mündlichen Beteiligung, den Lernergebnissen und dem Arbeitstempo der einzelnen Schülerinnen und Schüler erkennen kann. Vier Kinder haben einen Migrationshintergrund. Zwar schlägt sich dieser bei einigen in einem weniger ausgeprägtem Sprachvermögen nieder, jedoch weist die Lerngruppe keinerlei Schwierigkeiten auf, den sprachlichen Anforderungen des Unterrichts gerecht zu werden. Das soziale Miteinander kann weitestgehend als gut angesehen werden und die Klasse zeichnet sich im Allgemeinen durch einen freundlichen Umgang miteinander aus. Das Gemeinschaftsgefühl ist bei der Mehrheit der Gruppe stark entwickelt, was sich in sozialen Kontakten bemerkbar macht. Das Lernverhalten der Schülerinnen und Schüler ist allerdings unterschiedlich und von der Tagesform und dem Unterrichtsthema abhängig. Vor allem Ötzge, Justin, Tim und Nicola fallen durch ihr unruhiges Verhalten und vom Thema abweichende Kommentare auf. Sie stören auch manchmal den Unterricht, indem sie mit anderen Schülern sprechen bzw. zappelig sind. Bei Justin und Tim kann dies auf ärztlich diagnostizierte ADHS zurückgeführt werden. Während der erstgenannte Schüler regelmäßig entsprechende Medikamente einnimmt, musste Tim diese aufgrund der Nebenwirkungen absetzen. Die klassischen vorpubertären Konflikte zwischen den Geschlechtern sind ansatzweise in der Klasse erkennbar, ansonsten wirkt die Lerngruppe noch eher kindlisch verspielt. Der hohe Jungenanteil führt zusätzlich dazu, dass die Gruppe sehr lebhaft und häufig auch unruhig ist. Andreas gilt in der Klasse als Außenseiter. Er hat wenig Kontakt zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern und der Umgang mit ihm wird weitgehend vermieden. Im Unterricht macht er sich in erster Linie dadurch bemerkbar, dass er entweder in den Büchern blättert oder in einen Streit mit seinem Tischnachbarn verwickelt ist. Durch die fehlende Akzeptanz ergibt sich eine weitere Schwierigkeit, denn seine Mitschüler verweigern sich, in einer Gruppe mit ihm 3 zusammenzuarbeiten. Das Interesse am Fach Gesellschaftslehre ist geteilt. Einige Schüler (Lisa, Kevin) sind passiv und müssen verstärkt zur mündlichen Beteiligung aufgefordert werden. Der größte Teil der Gruppe arbeitet allerdings motiviert, meldet sich gerne zu Wort und will unbedingt seine Ergebnisse präsentieren. Dies gilt insbesondere für Julian, der bereits über ein breit angelegtes historisches Wissen verfügt und ständig neue Aspekte in den GL-Unterricht mit einbringt. Er muss des Öfteren gebremst werden und wird von mir beim Melden bewusst nicht immer als Erster dran genommen. Um ihn nicht zu demotivieren, habe ich ihm in einem Gespräch deutlich gemacht, dass ich seine Meldung registriere, ihn aber nicht immer als Ersten dran nehmen kann. Das Gleiche betrifft Jonathan und Steffen. Obwohl ihre Unterrichtsbeiträge oftmals qualitativ gut sind, muss das Melden immer wieder geübt werden. Dennoch bringen sie mit ihren guten inhaltlichen Einfällen den Unterricht voran. Als weitere Leistungsträger im Fach Gesellschaftslehre sind Isabell, Lea, Lena und Felix anzuführen. Die oben genannten Schülerinnen und Schüler sind stets bemüht den Unterricht voranzubringen, beteiligen sich kontinuierlich, haben tolle Ideen und arbeiten inhaltlich gut. Prinzipiell lässt sich sagen, dass die Lernenden gerne ihre eigenen Meinungen äußern und dass man sie schnell für ein Thema begeistern kann. Spezielle Lernvoraussetzungen Wie von Hackenberger/Schalück vorgeschlagen, findet die Behandlung des Ötzi im Anschluss an die Themen der Alt- und Jungsteinzeit statt.1 Die Schülerinnen und Schüler besitzen also die vom Lehrplan geforderten Kenntnisse über das Leben der Jäger und Sammler in der Altsteinzeit sowie über die neolithische Revolution, den Übergang zur produzierenden Wirtschaftsweise und die damit einhergehenden Veränderungen der Lebens- und Arbeitsweise der Frühmenschen. Den Schülerinnen und Schülern ist jedoch bekannt, dass es damals die Berufe im heutigen Sinne noch nicht gab. Sie verfügen über Kenntnisse, dass in dieser Zeit Grundlagen für soziale und wirtschaftliche Strukturen gelegt worden sind, die im Grunde heute noch bestehen. Während der ersten Unterrichtsstunde habe ich festgestellt, dass die Lernenden für das Thema Steinzeit sehr aufgeschlossen sind und ein gewisses Grundwissen bereits vorhanden ist. Insbesondere Felix scheint von dem Thema fasziniert zu sein, was sich in seiner Beteiligung am Unterricht sowie in einem freiwillig erstellten Plakat zum Thema Entwicklung des Menschen äußert. Etlichen Lernenden ist der Fund Ötzis bereits bekannt, was sich während der Beschäftigung mit dem Thema Arbeit der Archäologen herausstellte. Dabei habe ich bemerkt, dass die entdeckende Vorgehensweise der Forscher Begeisterung in der Klasse hervorgerufen hat. 1 Vgl. Hackenberg, W.; Schalück, A. „Er stand uns in nichts nach Ötzi und seine Welt, in: Praxis Geschichte 70/1999, S. 46. 4 Um den verschiedenen Lerntypen und Leistungsniveaus gerecht zu werden, bemühte ich mich während meiner bisherigen Unterrichtstunden mit den Schülerinnen und Schülern verschiedene methodische Ansätze auszuprobieren und konnte erfreulicherweise feststellen, dass sich die Gruppe gerne auf verschiedene Unterrichtsmethoden einlässt. Das Abhandeln von Themen in Form einer Expertengruppe wurde mit den Lernenden bereits geübt, wobei die Lehrkraft häufig dahin gehend einwirken musste, dass die Lernenden stets beim Thema bleiben und die ihnen gegebene Freiheit zielführend nutzen. Nach einem Feedback-Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern hat sich herausgestellt, dass die Gruppenarbeit sehr beliebt ist, wobei anzumerken ist, dass bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn die Gruppenkonstellationen von der Lehrperson bestimmt werden. Die Gruppe ist mit der Bedeutung der Begriffe Rekonstruktion und Quelle bereits vertraut. Abschließend bleibt abzuwarten, wie konzentriert die Schülerinnen und Schüler in der dritten GLStunde an diesem Tag aktiv am Thema mitarbeiten und der beabsichtigte Lernerfolg erzielt werden kann. 3. Sachstrukturanalyse Der „Mann aus dem Eis wurde am 19. September 1991 von einem Nürnberger Ehepaar bei einer Wanderung in den Ötztaler Alpen entdeckt. Der Fundort lag am Hauslabjoch auf 3200m Höhe direkt an der Grenze zwischen Österreich und Italien. Die Gletschermumie wurde schnell zur Weltsensation und erhielt den Namen nach ihrer Fundstelle „Ötzi. Untersuchungen des Leichnams ergaben, dass der ca. 160cm große und ca. 60 bis 70kg schwere Ötzi in einem Spätsommer bzw. Frühherbst vor ca. 5 300 Jahren im Alter von ca. 45 Jahren ums Leben gekommen war.2 Die im Eis des Gletschers über Jahrtausende fast unversehrt erhaltene Mumie war ein großes Glück für die Forschung zur Frühgeschichte, denn bisher hatten Archäologen das Leben jener Zeit fast nur anhand von vergleichsweise mageren Überresten (Skeletten, Gräbern, Grabbeigaben) rekonstruieren müssen. Neben dem gut konservierten Körper konnten auch Reste seiner Ausstattung ausgegraben werden, die zeigen, wie gut und zweckmäßig ausgerüstet „Ötzi für seinen Weg durch die Hochalpen war, was die Forscher viele Rückschlüsse auf das jungsteinzeitliche Leben ziehen ließ. Auf viele Fragen zu Ötzis Leben und Sterben gibt es bis heute keine eindeutige Antwort. Unbestritten ist, dass er von einem Pfeil getroffen und mitten aus dem Leben gerissen wurde, als er mit schadhafter Ausrüstung den Alpenhauptkamm überquerte. Es gibt allerdings keine genaue Erklärung zu den Umständen seines Todes. Ebenso die Fragen nach seinem „Beruf und Motiven, die ihn um diese Jahreszeit in das Hauslabjoch trieben, bleiben unklar. Einige Forscher, u.a. Konrad Spindler, sehen ihn als Ausgestoßenen, der infolge eines Konflikts sein 2 Vgl. ebd, S. 46. 5 Dorf verlassen musste. Dabei ging ein Teil seiner Ausrüstung verloren bzw. wurde beschädigt.3 Der Innsbrucker Ur- und Frühgeschichtsprofessor vermutet, dass Ötzi möglicherweise ein Hirte war, der die Almlandschaft als Weidegebiete für Schafe oder Ziegen aufgesucht hatte. Dass er in einem Kontakt zu einer Siedlungsgemeinschaft stand, bezeugen mehrere beim Leichnam gefundene Ausrüstungsgegenstände. Das Holzbeil mit Kupferklinge, damals ein sehr kostbares und begehrtes Metall, legt die Vermutung nahe, dass Ötzi eine hohe gesellschaftliche Stellung einnahm. Weitere Spekulationen lassen vermuten, dass der „Mann aus dem Eis ein Metallprospektor war, der sich auf Erzsuche befand. Diese Theorie wird jedoch dadurch relativiert, dass diese Tätigkeit eine Zusammenarbeit mit anderen Menschen erfordert. Weitere bei der Gletschermumie gefundene Gegenstände lassen zahlreiche Vermutungen zu. So deuten der „Retuscheur und Feuersteingeräte darauf hin, dass Ötzi als Händler tätig war, wenngleich das Vogelnetz, Steinbockknochen sowie Jagdwaffen uns mutmaßen lassen, dass es sich bei der Gletschermumie um einen Jäger handelte.4 4. Didaktische Überlegungen In der Jahrgangsstufe 6 sieht der hessische Lehrplan des Faches Gesellschaftslehre an Förderstufen in der Unterrichtsreihe Von den Jägern und Sammlern zu den Ackerbauern das Thema Spuren aus der Geschichte der Menschen der Frühzeit vor.5 Dabei wird viel Wert darauf gelegt, dass in der Auseinandersetzung mit der Frühzeit der Menschen die Frage nach der Herkunft unseres heutigen (historischen) Wissens in den Vordergrund rückt. Die Schülerinnen und Schüler sollen mittels des entdeckenden und erfahrungsorientierten Unterrichts die Einblicke in die Arbeit der Archäologen gewinnen und eigene Deutungsversuche durchführen. Dies soll die Lernenden zu der Erkenntnis führen, dass die Interpretation historischer Spuren kompliziert ist und die Notwendigkeit zeigen, zwischen Hypothesen und gesichertem Wissen zu unterscheiden.6 Im Bezug darauf bietet das Thema Ötzi sowie die Überreste, die bei der Gletschermumie gefunden wurden, eine hervorragende Möglichkeit, kreativ und eigenständig über seinen Beruf7 und die Umstände seines Lebens nachzudenken und somit den Umgang mit archäologischen Funden als Quelle für den Geschichtsunterricht einzuüben bzw. zu schulen. Dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler sich in einer vergleichbaren Situation wie die Forscher befinden und anhand der Fundstücke versuchen, das Leben der Gletschermumie in engerem Sinne zu rekonstruieren, wird ihnen mittels eines forschend-entdeckenden Ansatzes die Arbeit der Archäologen nahe gebracht. 3 Vgl. Sulzenbacher, G.: Ötzi und Juanita- Fenster in die Vergangenheit. Archäologische Funde entschlüsseln die (Vor-)Geschichte der Menschen in: Praxis Geschichte 2/2000, S. 29. 4 Vgl. Hackenberg, W.; Schalück, A. „Er stand uns in nichts nach Ötzi und seine Welt, S. 46. 5 Vgl. Hessisches Kultusministerium: Handreichung zur Arbeit mit den Lehrplänen der Bildungsgänge Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Gesellschaftslehre an schulformübergreifenden (integrierten) Gesamtschulen und Förderstufen, Wiesbaden, S.4. 6 Vgl. Hessisches Kultusministerium: Lehrplan Geschichte, Bildungsgang Realschule. Jahrgangsstufen 5 bis 10, Wiesbaden 2002, S. 8. 7 Die Bezeichnung Beruf hat natürlich nicht die heutige Bedeutung eines Berufes. Jedoch scheint es passend, vor allem für die Lernenden Ötzis Tätigkeiten als Beruf zu bezeichnen. 6 Fragen über den Beruf des Ötzi lassen sich anhand der Fundstücke nicht eindeutig beantworten (vgl. Kpt.3). Indem sich die Schülerinnen und Schüler näher über die Funde informieren und sie hinsichtlich der Frage, wer Ötzi war, analysieren, können sie einerseits nachvollziehen, dass die Ereignisse der Vergangenheit nur in Form von Spuren und von Überresten verschiedenster Art gegenwärtig sind. Außerdem erfahren die Lernenden, dass es bei der „Interpretation archäologischer Funde durchaus gleichwertige plausible Interpretationslinien und mehrere Deutungsmöglichkeiten gibt8 und feststellen, dass die Quellen (archäologische Funde) uns dabei helfen, Geschichte zu rekonstruieren, aber nicht alle Fragen beantworten können. Dabei darf nicht aus dem Auge verloren werden, dass „Ötzi in erster Linie ein Fallbeispiel für die Erkenntnismöglichkeiten moderner archäologischer und naturwissenschaftlicher Untersuchungsmethoden, weniger aber ein repräsentativer Befund für jungsteinzeitliche Lebensweise ist.9 Die Relevanz des Themas ergibt sich außerdem daraus, dass Ötzi uns in besonderer Weise zugleich nah und fern erscheint. Das liegt nicht nur daran, dass dieser bisher „komplexeste Fund seiner für uns entfernten Epoche „Weltruhm erlangte und daher einigen Schülerinnen und Schülern bereits aus den Medien bzw. anlässlich der Ausstellung im Kasseler Naturkundemuseum bekannt ist (vgl. Kpt. 2). Dies wie auch die damit verbundene Begeisterung bei den Lernenden waren Grund dafür, mich für dieses Thema zu entscheiden. Der Fall Ötzi ist im besonderen Maße geeignet, lebendige Geschichte, hier eine „Entdeckungsreise durch die Jungsteinzeit anhand eines anschaulichen Fallbeispiels zu vermitteln. Geschichte wird hier also konkret und greifbar. „Doch eben dieses individuelle Schicksal ist es, was heutzutage fasziniert, was unser Interesse an jener grauen Vorzeit ungemein geweckt hat und so auch die Archäologie indirekt beflügelt. Gerade weil das dramatische Ende des Gletschermannes, obschon es sich vor 5000 Jahren ereignet hat, so unmittelbar vor unseren Augen liegt, berührt es uns.10 Aus diesem Grund lässt sich mithilfe dieses Themas der Gegenwarts- und Zukunftsbezug als operative Kategorie der Geschichtsunterricht in idealer Weise im Unterricht verwirklichen. Da der Fund vor allem mit dem Begriffspaar „Mumie und „Steinzeit in Verbindung gebracht und damit mit „gruselig und „sehr alt konnotiert wird, wirkt es sich auf die Lernenden, die diesen Themen (insbesondere Mumien) gegenüber aufgeschlossen sind, sehr motivierend aus. Darüber hinaus bietet das Thema den Lernenden die Möglichkeit, erneut aufzugreifen, dass Ötzis Lebensspanne in eine Zeit großer Umwälzungen fällt, was hier am Beispiel der Herausbildung erster Berufe deutlich wird. Abschließend lässt sich sagen, dass die Analyse und die Rekonstruktion des Ötzi das Potenzial haben, viele Kennzeichen sowohl des steinzeitlichen als auch des Menschen der Metallepoche hervorzuheben. Das Aufkommen des Metalls kann hiermit in der darauf 8 Sulzenbacher, G.: Ötzi und Juanita- Fenster in die Vergangenheit, S.30. 9 Raetzel-Fabian, D.: Die Geschichte vor Geschichte. Basisartikel, in: Geschichte lernen 70/1999, 20. 10 Engeln, H.: Ötzi- Der Mann aus der Steinzeit, in: GEO 10/1996, S.92. 7 folgenden Stunde sehr anschaulich den Schülern nahe gebracht und damit zur neuen Epoche übergeleitet werden. 5. Methodische Überlegungen Die Stunde beginnt mit einem stummen Impuls. Das Bild zeigt den mumifizierten Ötzi an seiner Fundstelle in den Ötztaler Alpen. Die Abbildung wird an die Wand projiziert und den Lernenden wird Zeit gegeben, sie zu betrachten. Die Schülerinnen und Schüler sollen somit angeregt werden, sich spontan zu dem Gesehenen zu äußern. Ich habe mich für diese Form des Einstiegs aus mehreren Gründen entschieden. Zum Einen hat er das Ziel, die Gruppe an das zu behandelnde Thema heranzuführen. Zum Anderen erhoffe ich mir damit bei den Lernenden eine gewisse Überraschung oder gar Begeisterung für die dargestellte Mumie hervorzurufen (vgl. Kpt. 4), um Interesse und Motivation für das Kommende zu wecken. Ich gehe davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler auf den Begriff Ötzi kommen, denn er ist bereits von einigen im Unterricht erwähnt worden (vgl. Kpt.3/4). Für den Fall jedoch, dass sie den Inhalt des Bildes nicht ohne meine Hilfe nennen können, werde ich den Namen Ötzi an die Tafel schreiben. Um sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler über die gleichen Basisinformationen verfügen, werde ich wichtige Informationen ergänzen, die mithilfe einer großen Wandkarte veranschaulicht werden. Damit die Lernenden den zu vermittelnden Informationen besser folgen können, werde ich während des kurzen Lehrervortrages einen roten Punkt und den Namen des Fundortes der Gletschermumie auf die entsprechende Stelle der Wandkarte kleben. In der darauf folgenden Hinführungsphase in die Gruppenarbeit wird den Lernenden eine Rekonstruktionszeichnung von Ötzi auf Folie präsentiert. Diese hat für den weiteren Verlauf eine vielfache Bedeutung. Einerseits hat sie das Ziel, der Gruppe den Unterschied zwischen dem Fund und dessen Nachbildung transparent zu machen, worauf ich zum Schluss der Stunde explizit eingehen werde. Da sich die Lernenden in der Erarbeitungsphase mit der Ausrüstung von Ötzi befassen werden, dient sie andererseits als Vorbereitung auf diesen Unterrichtsschritt, mit der Absicht, die Vorkenntnisse der Schülerinnen und Schüler über die steinzeitlichen Werkzeuge zu aktivieren. Dabei werden die unbekannten Gegenstände, falls nötig, erklärt. Dadurch können die Schülerinnen und Schüler einen Überblick erhalten, womit sich die Gruppen während der Erarbeitungsphase beschäftigen werden. An dieser Stelle schafft die Lehrkraft den Übergang in die Erarbeitungsphase, indem sie die Gruppe auffordert, zu vermuten, welche Fragen Forscher an Ötzi stellen könnten. Ich gehe davon aus, dass einer der Lernenden nach Ötzis Tätigkeit fragen, was für den weiteren Unterrichtsverlauf wesentlicher Ausgangspunkt ist. Erforderlichenfalls muss ich das Gespräch in diese Richtung 8 lenken. An dieser Stelle werde ich das Thema der Stunde: Was war Ötzi von Beruf? an die Tafel schreiben. Ich hätte die Gruppe ihre Vermutungen zu dieser Frage aufstellen lassen können, aber um das Absinken der Spannung und unendliches Spekulieren zu vermeiden, werde ich auf diesen Schritt verzichten. In der Erarbeitungsphase arbeiten die Schülerinnen und Schüler in fünf von mir bestimmten Stammgruppen, die ich nach ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit und Sozialverhalten differenziert zusammensetze (vgl. Kpt.2). Mit der einheitlichen Leistungsstärke der einzelnen Teams soll eine Überforderung vermieden und ein Arbeitsergebnis gesichert werden, mit dem weiter gearbeitet werden kann. Fünf Schülergruppen bilden die Forscherteams, die sich auf eine Forschungsreise begeben. Sie beschäftigen sich mit den einzelnen archäologischen Funden, deren Merkmale und Funktionen den Texten und Abbildungen zu entnehmen sind. Sie versuchen herauszufinden, welchen Beruf Ötzi ausgeübt haben könnte, um ihre Meinung mit überzeugenden Argumenten zu untermauern. Dabei soll den Lernenden lediglich eine Auswahl der verschiedenen Funde präsentiert werden, die am deutlichsten eine Aussage über seinen Beruf treffen zulassen. Dabei wurde angesichts des Alters der Lerngruppe eine Beschränkung auf die zugänglichsten bzw. relativ leicht zu interpretierenden Stücke von der Lehrkraft vorgenommen. Obwohl das Werkzeug „Retuscheur für einige sicherlich abstrakt ist und Schwierigkeiten (bereits bei der Aussprache) bereiten kann, habe ich mich aufgrund seiner möglichen Zuordnung zu dem Beruf des Händlers absichtlich dafür entschieden. Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, wird der Text von mir einfach verfasst und zur Sicherheit einer stärkeren Gruppe zugewiesen. Alternativ könnte ich den Lernenden lediglich die Abbildungen von den Fundstücken geben. Es scheint mit jedoch hilfreich, kurze Informationstexte zu einzelnen Materialien zu geben, da diese allein aus den Abbildungen von den Schülerinnen und Schülern nur schwer erschlossen werden können. Damit die Lernenden sich auf die Präsentationsphase gründlich vorbereiten können, werde ich sie explizit darauf hinweisen, dass jedes Teammitglied im nächsten Schritt die Ergebnisse – als Experte- in einer neuen Gruppe präsentieren soll. Dadurch erhoffe ich mir eine höhere Partizipation der einzelnen Schüler. Außerdem kann die Übernahme der Verantwortung für den Lernprozess zur Steigerung des Selbstwertgefühls und Selbstvertrauens führen.11 Für die hier beschriebene Stunde habe ich einen forschend-entdeckenden Ansatz gewählt, denn ich erhoffe mir, dass diese der Arbeit mit der Archäologen grundsätzlich vergleichbare Situation, in der die Lernenden wie echte Wissenschaftler die vorliegenden Überreste analysieren und daraus ihre 11 Vgl. Mathis, Ch.: Gruppenpuzzle, in: Günther-Arndt, H.: Geschichts-Methodik. Handbuch für die sekundarstufe und II, Berlin 2007, S. 222. 9 Schlüsse ziehen müssen, eine hohe Schülermotivation12 („Forscher-Ehrgeiz) ermöglicht (vgl. Kpt. 2). Des Weiteren soll das eigenständige und kreative Nachdenken über Ötzis möglichen Beruf die Lernenden zu eigenen Einsichten und Erkenntnissen anleiten, wodurch nicht das historische Wissen, sondern vor allem die methodische Kompetenz, eigene Erklärungs- und Verstehensversuche zu unternehmen, in den Vordergrund des Unterrichts tritt. Dies ist umso wichtiger, denn „sich fragengeleitet und selbstbestimmt in ein unbekanntes Gebiet einzuarbeiten ist [] eine Schlüsselkompetenz über den Bereich eines einzelnen Faches hinaus13 Die Sozialform der Gruppenarbeit ergibt sich zum Einen aus dem gewählten forschendentdeckenden Ansatz, bei dem die Schülerinnen und Schüler in die Rolle von Forschern schlüpfen und analog zu deren wissenschaftlichen Arbeit agieren. Zum Anderen kann in der Gruppe bereits ein intensiver Austausch über die Arbeitsergebnisse stattfinden. Jeder kann sich, seiner Möglichkeit entsprechend, einbringen und erfährt dadurch Wertschätzung: Seine Ideen und seine Neugier werden benötigt. In der darauf folgenden Präsentationsphase werden die Lernenden in ihrer Rolle als Wissenschaftler die Ergebnisse ihrer Gruppenarbeit den anderen darstellen. Jede Stammgruppe entsendet je ein Mitglied in die Expertengruppen. Um sicherzustellen, dass in den neuen Expertengruppen je ein Mitglied aus jeder Stammgruppe vertreten ist, werde ich die Arbeitsblätter, von denjenigen die eine Expertengruppe zusammen bilden sollen, auf eine entsprechende Farbe drucken. Die neu entstandenen Gruppen verteilen sich im Raum und tauschen ihre Informationen, Meinungen samt Argumenten aus. Falls die Anzahl der Lernenden nicht gleichmäßig ist, werden entweder zwei Personen einer Gruppe zugewiesen oder ich werde auf eine Gruppe verzichten müssen. Ich habe mich für diese Form der Präsentation entschieden, denn somit werden alle Schülerinnen und Schüler aktiviert Informationen aufzunehmen, da sie wissen, dass sie ihre Ergebnisse anschließend an andere weitergeben sollen. So wird dem bekannten Nachteil der üblichen Gruppenarbeit, dass nämlich Einzelne arbeiten und der Rest sich zurückhält, vorgebeugt. Alternativ könnte ich die Präsentation der Ergebnisse in einer Diskussionsrunde wie z.B. Fish -Bowl vornehmen. Da jedoch die Lernenden keinen Bezug und keine eigenen Erfahrungen mit dem Sachgegenstand, den sie vertreten sollen, haben, habe ich auf diese Form verzichtet. Anschließend sollen die Lernenden in ihren Expertengruppen zusammenfassen, was man zu Ötzis Beruf sagen kann. Dabei ist zu erwarten, dass einige der Lernenden bei ihrer Meinung bleiben, die anderen wiederum sich von den Argumenten der anderen Experten überzeugen lassen. Vielleicht werden sie bereits in dieser Phase feststellen, dass man auf diese Frage keine eindeutige Antwort geben kann. 12 Vgl. Henke-Bockschatz, G.: Forschend-entdeckendes Lernen, in: Schneider, G. u.a. (Hrsg.): Handbuch Methoden in Geschichtsunerricht, Schwalbach 2004, S. 15. 13 Vgl. Sauer, M.: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik, Seelze-Velber, 2008,S.139. 10 Nach einer vorgegebenen Zeit werden die Ergebnisse der einzelnen Expertengruppen in einem Unterrichtsgespräch präsentiert und diskutiert. Dabei erhoffe ich mir, dass die Lernenden (entweder in den Gruppen oder zwischen den Gruppen) sich auf einen einzigen Beruf nicht einigen können. Damit die Lernenden während des Gesprächs sich auf die Rekonstruktionszeichnung von Ötzi beziehen können, werde ich die Folie auf dem OHP projizieren. Die einzelnen Vorschläge werde ich an der Tafel notieren und mit den von den Schülern erarbeiteten Argumenten ergänzen. Falls die Zeit nicht ausreicht, verzichte ich auf diesen Schritt. In der Reflexionsphase werde ich die Lernenden auf die Ergebnisse ihrer Diskussion hinweisen und fragen, warum sie sich nicht einigen konnten. Möglicherweise gelangt die Gruppe selbst zu der Erkenntnis, dass das Wissen über die Vergangenheit nicht nur auf den Funden (Quellen) basiert, sondern oftmals durch Vermutungen ergänzt werden muss. Falls sie nicht selbstständig zu dem Ergebnis kommen, lenke ich ihre Aufmerksamkeit auf die Resultate der Forschung. Das Ergebnis werde ich an die Tafel schreiben. Falls die Zeit ausreicht werde ich zum Schluss der Gruppe erneut zwei Bilder von Ötzi zeigen und die Frage stellen, was man nicht 100%ig beantworten kann. Dies soll als Transferleistung sowie Ergebniskontrolle dienen. Als didaktische Reserve bzw. Hausaufgaben bekommen die Schülerinnen und Schüler einen kurzen Text zum Thema Was war Ötzi von Beruf?- Die Forscher auf der Spur der Gletschermumie, zu dem sie einen Leserbrief verfassen sollen. Das Ziel dieser Aufgabe ist, sich mit verschiedenen Theorien zu Ötzis Beruf auseinanderzusetzen und eine eigene Stellungnahme dazu abzugeben. 6. Angestrebter Kompetenzzuwachs • Die Schülerinnen und Schüler stärken ihre historische Wahrnehumgskompetenz, indem sie sich mit dem archäologischen Fund Ötzi beschäftigen und Fragen an ihn stellen. • Sie entwickeln ihre historische Analysekompetenz, indem sie einzelne Ausrüstungsgegenstände Ötzis erforschen und ihre Vermutungen über den mutmaßlichen Beruf Ötzis anstellen. • Sie entwickeln ihre historische Urteilskompetenz, indem sie sich auf einen Beruf einigen und diesen mit den entsprechenden Argumenten untermauern. • Sie entwickeln ihre historische Orientierungskompetenz, indem sie zum Ergebnis kommen, dass es bei der Interpretation archäologischer Funde gleichwertig plausible Interpretationslinien gibt und feststellen, dass die Quellen (archäologische Funde) uns dabei helfen, Geschichte zu rekonstruieren, aber nicht alle Fragen beantworten können. 11 7. Verlaufsplan: Zeit Phase Inhalt Sozialform/ Methode Medien Einstimmung: ca. Die Lehrperson präsentiert auf der OHP-Folie eine Abbildung des Plenum Folie 5 Min. mumifiziertem Ötzi. Die Lernenden äußern sich spontan zu dem stummer Impuls (Anlage 1), Gesehenen. OHP Mögliche Schüleräußerungen: Wandkarte, Leiche, Schnee, Ötzi, Mumie roter Punkt, Die Lehrkraft gibt einen kurzen Input. Lehrervortrag Zettel mit dem Fundort Hinführung: ca. Die Lehrkraft deckt die Rekonstruktionszeichnung von Ötzi ab, wartet Plenum Folie 4 Min. kurz ab und sagt: Das ist er! Welche Fragen könnten die Forscher an Schüleraktivität (Anlage 1), Ötzi stellen? OHP Mögliche Schüleräußerungen: Wo hat er gelebt? Was hat er gemacht? Wozu brauchte er seine Ausrüstung? Die Lehrerin schreibt das Thema an die Tafel: Was war Ötzi von Tafel Beruf? ca. 10 Min. Erarbeitungsphase: Die Lehrperson erklärt die Aufgabe. Gruppenarbeit Die Schülerinnen und Schüler lesen die Texte und setzen sich mit ihren Expertengruppen Gegenständen auseinander. Sie beschreiben sie, ihre Funktion und (Gruppenpuzzle) schließen daraus auf Ötzis mutmaßlichen Beruf. ca. 10 Min. Präsentationsphase: Die Lernenden verlassen ihre Stammgruppen und bilden neue Gruppenarbeit/ Expertengruppen. Sie tauschen ihre Informationen, Meinungen samt Expertengruppen Argumenten aus. Sie fassen zusammen, was man zu Ötzis Beruf sagen (Gruppenpuzzle) kann. Ergebnissicherung: ca. Die Lehrkraft stellt die Frage: Zu welchem Ergebnis seid ihr Plenum/ Unterrichts6 Min. gekommen? gespräch Die Schülerinnen und Schüler äußern ihre Meinungen. Mögliche Schüleräußerungen: Ötzi war ein Jäger, weil er Pfeil und Bogen dabei hatte. Er war ein Anführer, weil er ein Kupferbeil dabei hatte. Reflexionsphase: ca. Die Lehrkraft fragt, warum die Lernenden sich nicht einigen konnten. Plenum/ Unterrichts7 Min. Mögliche Schüleräußerungen: Weil er Sachen dabei hatte, die man sowohl zum Jagen als auch als gespräch Hirte brauchte. Weil die Sachen alt sind. Die Lehrperson fragt: Überlegt, was sagen die Archäologen zu Ötzis Beruf? Mögliche Schüleräußerungen: Sie können auch keine klare Antwort geben. Sie müssen auch vermuten. Die Lehrkraft schreibt das Ergebnis an die Tafel. ca. Den Schülerinnen und Schülern wird die Folie erneut gezeigt und die 3 Min. Frage gestellt: Denkt darüber nach, was wir noch nicht 100%ig über Ötzi sagen können? Mögliche Schüleräußerungen: sein Aussehen, sein Alltag Zeit (-): Falls die Zeit nicht ausreicht,verzichte ich auf letzten den Schritt Zeit (): Als didaktische Reserve bzw. Hausaufgabe bekommen die Arbeitsblätter (Anlage 3-7) Bilder mit den Gegenständen (Anlage 2) Arbeitsblätter (Anlage 3-7) Bilder mit den Gegenständen (Anlage 2) Folie (Anlage 1), OHP evtl. Tafel Tafel Folie (Anlage 1), OHP Arbeitsblätter (Anlage 8) 12 Schülerinnen und Schüler ein Arbeitsblatt mit der Aufgabe, einen Leserbrief zu verfassen. 8. Literaturverzeichnis: Egg, M.: Der Mann im Eis. Zur Ausrüstung der Gletschermumie aus den Ötztaler Alpen, in: Praxis Geschichte 6/1999, S. 22-26. Engeln, H.: Ötzi- Der Mann aus der Steinzeit, in: GEO 10/1996, S. 68-94. Hackenberg, W.; Schalück, A.: „Er stand uns in nichts nach Ötzi und seine Welt, in: Praxis Geschichte 70/1999, S. 46-50. Henke-Bockschatz, G.: Forschend-entdeckendes Lernen, in: Schneider, G. u.a. (Hrsg.): Handbuch Methoden in Geschichtsunerricht, Schwalbach 2004, S. 15-29. Hessisches Kultusministerium: Lehrplan Geschichte, Bildungsgang Realschule, Jahrgangsstufen 5 bis 10, Wiesbaden 2002. Hessisches Kultusministerium: Handreichung zur Arbeit mit den Lehrplänen der Bildungsgänge Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Gesellschaftslehre an schulformübergreifenden (integrierten) Gesamtschulen und Förderstufen, Wiesbaden. Hessisches Kultusministerium: Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue Kerncurriculum für Hessen. Sekundarstufe I- Realschule. Entwurf Geschichte, Wiesbaden 2010. Mathis, Ch.: Gruppenpuzzle, in: Günther-Arndt, H.: Geschichts-Methodik. Handbuch für die Sekundarstufe und II, Berlin 2007, S. 221-223. Raetzel-Fabian, D.: Die Geschichte vor Geschichte. Basisartikel, in: Geschichte lernen 70/1999, S.19-26. Sauer, M.: Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik, Seelze-Velber, 2008. Sulzenbacher, G.: Ötzi und Juanita- Fenster in die Vergangenheit, in: Praxis Geschichte 2/2000, S. 29-34. 13 Anlage 1: 14 ANLAGE 2 Abbildungen: GRUPPE 1: KUPFERBEIL GRUPPE 2: PFEIL UND BOGEN GRUPPE 3: GEFÄßE AUS BIRKENRINDE GRUPPE 4: RETUSCHEUR (DRUCKSTAB) GRUPPE 5: KLEIDUNG 15 ANLAGE 3-7 Forscherteam 1 Ötzis Kupferbeil 1. Schaut euch die Abbildung genau an und lest den Text gründlich durch. 2. Markiert die wichtigsten Merkmale des Kupferbeils. 3. Schreibt stichwortartig, wozu Ötzi das Kupferbeil hätte benutzen können. 4. Überlegt und schreibt, welchen „Beruf Ötzi hätte haben können. Begründet eure Antwort! . Das rund 60 cm lange Kupferbeil ist weltweit das einzige vollständig erhaltene Beil der Urgeschichte. Die Klinge sitzt in einem Holzgriff und wurde mit einer Lederschnur umwickelt. Interessant ist vor allem die Klinge, deren Schneide Gebrauchsspuren zeigt. Sie ist aus Kupfer angefertigt. Kupfer war damals ein sehr kostbares und begehrtes Metall. Da Kupfer ein weiches Metall ist, bezweifelten einige Wissenschaftler die Tauglichkeit von Ötzis Beil als Werkzeug oder Waffe. Aber ein Experiment mit einem nachgebildeten Kupferbeil erbrachte den Beweis: In knapp 45 Minuten gelang es, einen Baum damit zu fällen. Vielleicht war es ein Hinweis darauf, dass er ein wichtiger Mann war. Metallgegenstände wie Beile und Dolche waren in der Kupferzeit Zeichen der Macht von Kriegern und Anführern. 16 Forscherteam 2 Ötzis Pfeil und Bogen 1. Schaut euch die Abbildung genau an und lest den Text gründlich durch. 2. Markiert die wichtigsten Merkmale von Pfeil und Bogen. 3. Schreibt stichwortartig, wozu Ötzi seine Pfeile und seinen Bogen hätte benutzen können. . 4. Überlegt und schreibt, welchen „Beruf Ötzi hätte haben können. Begründet eure Antwort! Der Bogenstab ist der größte Gegenstand aus Ötzis Ausrüstung. Er ist 1,82 lang und aus Eibenholz. Allerdings ist dieser Bogen noch nicht einsatzbereit: Es fehlen das Griffteil und die Kerben der Sehnenschlaufen. Diese Arbeit wäre schnell erledigt gewesen – allerdings ist Ötzi vorher gestorben. Außerdem wurden 14 Pfeile bei Ötzi gefunden, aber auch diese waren noch nicht funktionstüchtig (ohne Spitzen und Federn) oder zerbrochen. Vielleicht waren Pfeile und Bogen als Jagdausrüstung für Ötzi sehr wichtig oder er nutzte sie zur Verteidigung seiner Herde gegen Raubtiere und Räuber. Er hatte noch versucht, sie durch neues Gerät zu ersetzen oder zu reparieren. Wissenschaftler haben den Bogenstab von Ötzi nachgebaut und festgestellt, dass man mit ihm bequem und zielgenau auf 40 Meter Entfernung Tiere erlegen kann. 17 Forscherteam 3 Ötzis Gefäße aus Birkenrinde 1. Schaut euch die Abbildung genau an und lest den Text gründlich durch. 2. Markiert die wichtigsten Merkmale der Gefäße aus Birkenrinde. 3. Schreibt stichwortartig, wozu Ötzi die Gefäße aus Birkenrinde hätte benutzen können. . 4. Überlegt und schreibt, welchen „Beruf Ötzi hätte haben können. Begründet eure Antwort! . Die Gefäße aus Birkenrinde, die Ötzi dabei hatte, eigneten sich vorzüglich für seinen Gang ins Hochgebirge. Im Gegensatz zu Tonwaren waren diese viel leichter und bei weitem nicht so bruchanfällig. Eines der Birkenrinden-Gefäße des Ötzis war innen geschwärzt. Es wurde benutzt, um Glut oder Holzkohleteile zu tragen, die in Ahornblätter eingewickelt und mit feuchtem Gras abgedeckt wurden. Ötzi trug also offenbar immer die Glut des letzten Lagerfeuers mit sich. Ötzi war für längere Aufenthalte im Hochgebirge gut ausgerüstet. Dies könnte darauf hinweisen, dass seine Anwesenheit in den Alpen nicht zufällig war. In unmittelbarer Nähe des Fundortes von Ötzi, befanden sich schon zu seiner Zeit ausgedehnte Weidegebiete. 18 Forscherteam 4 Ötzis „Retuscheur (Druckstab) 1. Schaut euch die Abbildung genau an und lest den Text gründlich durch. 2. Markiert die wichtigsten Merkmale des Retuscheurs. 3. Schreibt stichwortartig, wozu Ötzi den Retuscheur hätte benutzen können. . 4. Überlegt, welchen „Beruf Ötzi hätte haben können. Begründet eure Antwort! . . Beim Retuscheur handelt es sich um ein Werkzeug, das bei der Bearbeitung von Feuerstein verwendet wurde. Auf den ersten Blick ist der Retuscheur ein unscheinbares Gerät. Die Form erinnert ein bisschen an einen Bleistift. Er ist aus Holz. Vorne ragt, wie die Mine aus einem Bleistift, eine Spitze aus Hirschgeweih heraus. Das Gerät ist insgesamt fast 12 cm lang. Der Retuscheur ist ein sehr präzises Werkzeug. Ötzi hat mit diesem Druckstab unter anderem Feuersteinklingen geschärft und neue hergestellt. Diese verwendete er selbst oder konnte sie gegen andere Waren eintauschen. Zu Ötzis Zeit erwarben die Menschen Waren durch Tauschhandel. Sie hatten schon damals über das Gebirge hinweg Kontakt und trieben Handel miteinander. 19 Forscherteam 5: Ötzis Kleidung 1. Schaut euch die Abbildung genau an und lest den Text gründlich durch. 2. Markiert die wichtigsten Merkmale der Kleidung Ötzis. 3. Schreibt stichwortartig, warum Ötzi so gekleidet war. 4. Überlegt und schreibt, welchen „Beruf Ötzi hätte haben können. Begründet eure Antwort! . Ötzi war für einen längeren Aufenthalt im Hochgebirge perfekt ausgerüstet. Ein knielanger Fellmantel und eine Bärenfellmütze schützten Ötzi gegen Wind und Kälte. Außerdem trug er lederne Beinkleider. Diese lange Strümpfe ohne Füßlinge boten optimale Bewegungsfreiheit. Ötzis Kleidung ist hauptsächlich aus Ziegenfell gemacht worden. Bei Regen und Schnee legte er eine kunstvoll geflochtene Grasmatte um seine Schultern: Auf diese Weise perlten die Tropfen ab und die darunter liegende Fellkleidung konnte sich nicht mit Wasser voll saugen. Ötzis Fußbekleidung war ebenfalls an die Wetterbedingungen in den Alpen gut angepasst: Sie bestand aus einem Innen- und einem Außenschuh. Der Innenteil war ein Grasnetz, in das Heu gestopft wurde – als Schutz vor Kälte. Der Außenschuh bestand aus robustem Hirschleder- als Schutz vor Feuchtigkeit. Zudem war seine gesamte Ausstattung auf ihn zugeschnitten und sehr schön verarbeitet. Alles war mit feinen regelmäßigen Stichen genäht und mit Stickereien geschmückt. Zu Ötzis Zeit trug nicht jeder so eine Kleidung. 20 ANLAGE 8 Arbeitsblatt: 1. Es gibt viele Theorien über Ötzis Beruf. Lies den Zeitungsartikel. Neandertaler Zeitung Düsseldorf, 25.11.2010 Was war Ötzi von Beruf?- Die Forscher auf der Spur der Gletschermumie Schon damals trieben Schafhirten ihre Herden im Sommer zu den Hochweiden des Ötztals. Aber nichts, was Ötzi bei sich hatte, weist darauf hin, dass er Schafhirte war. So trug er z.B. keine Wollkleidung, hatte keinen Hirtenstab und wurde wohl auch nicht von einem Hund begleitet. Eine Zeit lang dachte man, dass er Kupferschmied war, denn in seinen Haaren hatte man starke Kupferrückstände gefunden, aber dann stellte man fest, dass an seinem Fundort Pflanzen wachsen, die sehr kupferhaltig sind. Eine andere Theorie besagt, dass er Jäger war, denn er besaß einen Langbogen und einen Köcher voller Pfeile. Allerdings war sein Bogen nur halb fertig und einige Pfeile waren zerbrochen. Er könnte auch mit Feuerstein gehandelt haben, denn er hatte mehrere bearbeitete Stücke sowie einen Retuscheur14 dabei. Die Forscher zerbrechen sich den Kopf. 2. Du bist der Ötzi- Experte. Schreib einen Brief an die Neandertaler Zeitung und hilf den Forschern diese rätselhafte Frage zu lösen. . . . . . 14 Ein Werkzeug, das bei der Bearbeitung von Feuerstein verwendet wurde. 21 22