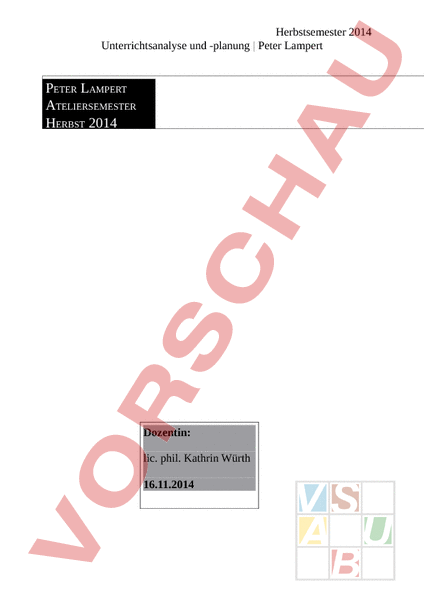Arbeitsblatt: Unterrichtseinheit Poetry-Slam
Material-Details
Unterrichtseinheit mit Sachanalyse über Poetry-Slam in der Schule für die Oberstufe. Schwerpunkt liegt bei der Mündlichkeit.
Deutsch
Vorlesen / Vortragen / Erzählen
8. Schuljahr
33 Seiten
Statistik
139955
2645
91
18.12.2014
Autor/in
Peter Lampert
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Herbstsemester 2014 Unterrichtsanalyse und -planung Peter Lampert PETER LAMPERT ATELIERSEMESTER HERBST 2014 DESH-LEISTUNGSNACHWEIS Dozentin: lic. phil. Kathrin Würth 16.11.2014 PETER LAMPERT SR12 [DESH-LEISTUNGSNACHWEIS] Herbstsemester 2014 Inhalt 1. Sachanalyse 1.1 Sprachlernthema: Sprechen, Präsentieren, Erzählen Ich habe mich bewusst für drei Sprachlernthemen entschieden, da mein Sachthema PoetrySlam verschiedene Kompetenzfelder im mündlichen Sprachgebrauch aufgreift und vermischt. Je nach Ausrichtung der Performance werden unterschiedliche Sprachlernthemen beansprucht und daher lassen sie sich nur schwer voneinander abgrenzen und sollten nicht isoliert betrachtet werden. Nur so ist eine sinnvolle Verknüpfung der beiden Bereiche möglich. Zuerst ist es aber wichtig zu wissen, welche Kompetenzen die allgemeine mündliche Sprachkompetenz auszeichnen. Die mündliche Sprachkompetenz lässt sich durch folgende Aspekte beschreiben: -Es ist ein absichtsgeleitetes, inhalts- und mitteilungsbezogenes Sprechen. -Es ist ein Verstehen und adäquates, spontanes, situationsangemessenes Reagieren mit Blick auf den Adressaten. -Es ist eine komplexe Interaktion im fremdkulturellen Kontext. (vgl.Hornung 2009) Senn (2007) unterteilt mündliche Sprachkompetenzen grundsätzlich in dialogische und monologische Situationen. Demnach wird das Präsentieren eines Sachverhaltes oder das Erzählen einer Geschichte als Charakteristika einer monologischen mündlichen Kommunikationssituation verstanden. In monologischen Sprachsituationen können die Bereiche Produktion und Rezeption eindeutig voneinander getrennt werden. Dies ermöglicht für die Lernenden eine nachvollziehbare Isolierung einzelner Aspekte der mündlichen Kommunikation. Demzufolge lassen sich Aspekte des Vortragens, des Präsentierens und des Erzählens vor allem in monologischen Situationen gezielt fördern. Für die monologischen Sprechsituationen unterscheidet Senn für die Sprachhandlung Sprechtechnik, Erzählen/Nacherzählen und Präsentieren jeweils drei Teilkompetenzen, welche mit verschiedenen Strategien gründlich gefördert werden können. (vgl. Senn 2007, S.1-3.) Sprechtechnik Deutliche Aussprache Stimmführung Sprechfluss Deutlich und angemessen laut sprechen Die Rede mit der Stimme wirkungsvoll gestalten In einem angemessenen Tempo flüssig und ohne störende Stockungen sprechen Tabelle 1: Kompetenzen Sprechtechnik (Senn 2007, S.2.) Erzählen/Nacherzählen Deutliche Aussprache Stimmführung Erzählfluss und Pausen Inhaltliche Strukturierung Deutlich und angemessen laut sprechen, die Geschichte mit den Mitteln der Stimme wirkungsvoll gestalten In einem angemessenen Tempo flüssig und ohne störende Stockungen erzählen, Pausen gezielt In einer sinnvollen Reihenfolge erzählen, spannungsvolle Ab-folge, das Wichtige der PETER LAMPERT SR12 [DESH-LEISTUNGSNACHWEIS] Herbstsemester 2014 einsetzen Geschichte erzählen, zusammenhängend, ohne störende Sprünge erzählen Tabelle 2: Kompetenzen Erzählen/Nacherzählen (Senn 2007, S.2.) Präsentieren Sprachlicher Ausdruck Auftreten Inhaltliche Strukturierung Deutlich und angemessen laut sprechen, sich verständlich und präzis ausdrücken, Stimme wirkungsvoll einsetzen Sicher und bestimmt auftreten, den (Blick-) Kontakt suchen, Medien fachkundig einsetzen Wesentliche Aspekte des Themas darstellen, sinnvoll und nachvollziehbar geordnet, übersichtlich gegliedert Tabelle 3: Kompetenzen Präsentieren (Senn 2007, S.3.) Um die Sprachlernthemen mit dem Poetry-Slam zu verknüpfen, gehe ich hier auf die Sprachfunktionen im mündlichen Sprachgebrauch, welche mit Poetry-Slam umgesetzt werden, ein. Nach Anders (2011) gehört der Lernbereich Texte präsentieren (vorlesen, vortragen)/ Erfundenes erzählen zum Sprechakt eines Poeten auf der Bühne. Die Sprachfunktion ist in erster Linie am Sprachspiel, aber auch am Hörer orientiert. Des Weiteren verweist sie auf den Lernbereich Erlebtes erzählen/Über Themen und Probleme sprechen, welcher sich in erster Linie auf die persönlichen Erfahrungen des Poeten bezieht. Auch das Kompetenzfeld Rollen spielen/Schildern passt zum Slam Poetry, wenn zum Beispiel ein Poet sehr expressiv und hörerorientiert performt. Das Kompetenzfeld Zusammenfassen/Erklären wird erwähnt, wenn Poeten ihre eignen Gefühle, Situationen oder gesellschaftliche Beobachtungen zu erklären versuchen. Zudem proklamiert sie, dass sich die Tätigkeiten im mündlichen Sprachgebrauch des Informierens oder Berichtens und Erzählens oft vermischen und ergänzen. Gerade bei den gesellschaftkritischen Texten wird eine weitere wichtige Funktion der Auseinandersetzung mit dem sozialen Umfeld und dem Sprechen über Wahrnehmung zugeschrieben, da die Poeten oft ihr Sprach- und Sachwissen erweitern müssen. (vgl. Anders 2011, S.94.) „‘Die Sprache wird dann zum kognitiven Medium des Lernens und der Sach- und Fachunterricht wird zum Sprachunterricht.‘ (Switalla 1993, zit. nach Anders 2011, S.94.) Zum Lernbereich Sprechen gehören die fachlichen Schwerpunkte anderen etwas mitteilen und situations-, partnergerecht und wirkungsbezogen erzählen, berichten und beschreiben und kürzere Beiträge in freier Rede liefern. (vgl. Berthold 2003, S. 152.) Berthold meint, dass die systematische Schulung der mündlichen-kommunikativen Kompetenzen eher vernachlässigt wird (vgl. Berthold 2003, S. 148) und schlägt deshalb zur Umsetzung der Bildungsstandards zum Beispiel vor, dass der Redeunterricht durch die Analyse vorbildlicher Redner ergänzt wird und dass der Erwerb der rhetorischen Fähigkeiten in der freien Rede auf Aktivitäten wie Rhetorik-Arbeitsgemeinschaften oder Theateraufführungen verlagert wird. (vgl. Berthold 2003, S. 152.) Da die Wahrnehmung der eigenen Sprache zur literarischen Kompetenz gehört, lässt sich das adressatenbezogene Reden in den Deutschunterricht integrieren. Im Handlungsfeld Poetry-Slam sprechen Jugendliche über aktuelle Anlässe ihrer Lebensumwelt. Dies liefert angemessenes Analysematerial für gekonntes Reden und Raum für Verbesserungsvorschläge in der Darbietungsform. (vgl. Anders 2011, S.99.) Beim Poetry-Slam kann die körperliche Dimension der Sprache ausprobiert und folgende Redekompetenzen trainiert werden: -Parasprache, -Kinesik, -die Verwendung von Emblemen, -Regulatoren und Illustratoren, -Prosodie, -Kanaldiskrepanz und -Konvergenz und Divergenz zum Publikum. (vgl. Anders PETER LAMPERT SR12 [DESH-LEISTUNGSNACHWEIS] Herbstsemester 2014 2011, S.100.) Daraus lassen sich für die Sprechhandlung folgende überprüfbare Teilkompetenzen ableiten: • Flüssigkeit der Rede • Stimmführung und andere paraverbale Signale • Gesten und andere nonverbale Signale, Konkretionsgrad (Details, z.B. akustische, optische, haptische Eindrücke) • Ausgestaltung der erzählerrolle, z.B. durch Kommentare • Reagieren auf die Zuhörer, z.B. durch Fragen‘ (Abraham 2008, zit. nach Anders 2011, S.100.) Der Lernbereich Präsentieren beim Poetry-Slam, also eine Slam-Poetry Darbietung, verlangt Anforderungen in den Teilbereichen Konzipieren, Texterstellung, sprachlich-mediale und nonverbale Umsetzung. Dennoch gibt es einige Unterschiede zu herkömmlichen Präsentationen wie zum Beispiel, dass Präsentationen informierende Textsorten und PoetrySlams literarische Textsorten zum Inhalt haben. ‚Präsentationen gelingen, wenn Schüler in der Planungsphase möglichst kohärent formulieren, um während der Präsentation nicht durch gleichzeitige Umplanungen und Formulierungsarbeit unter Druck zu geraten. Die Stichwörter in der Sprechvorlage sollten umsetzungsnah gestaltet werden.‘ (Berkmeier 2006, zit. nach Anders 2011, S. 95.) Der Lernbereich Erzählen beim Poetry-Slam ist gekennzeichnet durch extrem monologisches Erzählen. Es sind Geschichten die punktuell auf einen Höhepunkt ausgerichtet sind. Der Performer hat das alleinige Rederecht und setzt rhetorische, stilistische Mittel ein, um dem institutionellen Kontext gerecht zu werden. (vgl. Anders 2011, S. 97.) Eine erlebte oder erfundene Geschichte sollte demnach nachvollziehbar, spannend, hörerbezogen und wirkungsvoll vorgelesen oder erzählt werden. (vgl. Anders 2011, S. 96.) Da beim PoetrySlam die prosaischen Texte Alltagsituationen ähneln, können die Erzähl-Phasen in folgende Teilschritte gegliedert werden: • „Orientierung: Ort, Zeit, Situation und die auftretende Person werden vorgestellt. • Exposition: Der Sprecher überträgt sein Wissen in das des Zuhörers. • Komplikation: Die eigentlichen Ereignisse werden geschildert. • Auflösung und Schluss: Die Ereignisse der Komplikation werden gelöst und zu einem Ergebnis gebracht. (Anders 2011, S.96-97.) Laut Senn (2007) sollten Schülerinnen und Schüler ein reichhaltiges Angebot an Gesprächsformen erhalten. (vgl. Senn 2007, S.2.) Poetry-Slam schafft diese Reichhaltigkeit und verlangt deshalb auch einen durchmischten Bereich der Sprachlernthemen. 1.2 Sachthema: Lyrik- Poetry-Slam „Es gibt Leute, die Texte schreiben und auch vorlesen wollen, die eine Reaktion erwarten, Inspiration, Widerspruch, Anregung oder bloß vielleicht Aufregung. Das ist Spoken Word. Bedenke: Der Poet die Poetin hat fünf Minuten () Es handelt sich um eine wilde Mischung aus Performance, Poesie, Komödie, Spiel, purem Scherz und reiner Wahrheit, aus feuchten Dichterhänden und ekstatisch applaudierendem Publikum. Wer an einem solchen Abend dabei ist, wird es nicht so schnell vergessen. Die Jury des Abends wird aus dem Publikum ausgesucht. Ja, es gibt eine Jury, obwohl wir alle wissen, daß die Poesie nichts mit harten Regeln eines Wettstreits gemein hat. So what? Es wird keine Verlierer geben. wer liest, hat bereits gewonnen. PETER LAMPERT SR12 [DESH-LEISTUNGSNACHWEIS] Herbstsemester 2014 POETRY SLAM IST DIE AKTIVE SEITE DER POESIE.1 Dieses Zitat drückt kurz und knapp das aus, worum es bei einem Poetry-Slam geht: PoetrySlam bezeichnet eine moderierte, regelmässig stattfindende Veranstaltung, bei der jeder selbstverfasste Texte vor einer von dem Moderator des Poetry-Slams willkürlich bestimmten Publikumsjury aus meist zehn Personen vortragen kann. Die Jury vergibt nach dem Vortrag per Stimmtafeln Punkte von 1 (schlechteste Note) bis 10 (Bestnote). Von den zehn Jurynoten werden jeweils die beste und die schlechteste gestrichen und die übrigen acht Noten zusammengezählt. Zudem ist der Vortrag meistens durch ein Zeitlimit von fünf Minuten begrenzt und der Vortragende darf prinzipiell keine Requisiten einsetzten. Der Text kann vorgelesen oder auswendig vorgetragen werden. Wer am Ende des Poetry-Slams die höchste Gesamtpunktzahl hat, gewinnt einen symbolischen Preis. (vgl. Anders 2011, S.7.) Poetry-Slam ist der Begriff der Aufführung des Dichterwettbewerbs und wird auf Deutsch auch mit Dichterwettkampf oder Dichterschlacht übersetzt. Mit Poetry oder Slam Poetry wird die im Wettbewerb veranstaltete Dichtung bezeichnet. (vgl. Anders 2011, S.9.) Das Wort Slemma und Slämma stammt aus dem norwegischen bzw. schwedischen Sprachraum, steht lautmalerisch für das Zuknallen einer Tür und ging als slam in die englische Sprache ein. (vgl. Anders 2006, S. 14.) Das Wort slam wird im Wörterbuch mit Begriffen wie donnern, (eine Tür) zuknallen, schlagen, jemanden heruntermachen und schmettern übersetzt, was auch mit der Bedeutung im Schwedischen und Norwegischen kongruiert. Am ehesten kennt man den Begriff aber aus dem Sport: Der Begriff slam dunk, der im Basketball das Hineinschmettern des Balles von oben in den Korb meint oder der Begriff Grand Slam, der einen Sieg im Tennis bezeichnet, zeugt davon. So übernahmen auch die Veranstalter der Dichterwettbewerbe dieses Wort und formten daraus den PoetrySalm. (vgl.Anders 2011, S.9.) Die Idee des Dichterwettstreits ist nicht neu. Böttcher (2009) verweist dazu auf das Meistersingertum im 16ten Jahrhundert (vgl. Böttcher 2009, S.88.) und Gans (2008) auf die Rhetorik der griechischen Antike um 700 v. Chr. Er deutet darauf hin, dass dort bereits viele Ähnlichkeiten zu finden sind, welche sich auch auf den heutigen Poetry-Slam beziehen. Die Ähnlichkeiten lassen sich vor allem beim Verfassen von Slam Poetry nachweisen: das Erfinden (elocutio), das Einprägen (memoria) und schlussendlich das Vortragen bzw. das Performen (pronuntiatio-actio). (vgl. Gans 2008, S. 24.) Auch wenn sich die Geschichte des Dichterwettstreits weit in die Vergangenheit zurückverfolgen lässt, so stellt sich dennoch eine jüngere Geschichte des Poetry Slams heraus, die ihre Anfänge in den USA hat. Die ersten Grundsteine in Richtung Poetry-Slam wurden im New Yorker Cafe Nuyorican Poets gelegt. Es fanden Lesungen, genauso wie Jazzkonzerte und Theaterprojekte statt. Gegen Ende der Siebziger Jahre fanden sich an diesem Ort immer mehr Dichter ein. 1985 wurde von dem Bauarbeiter Marc-Kelly Smith und weiteren Poeten das Performance-Poetry-Team Chicago Poetry Ensemble gegründet. Im Green Mill Jazz Club veranstaltete Smith den ersten Poetry-Slam der Welt mit dem Namen The Uptown Poetry Slam. (vgl. Hager 2006, S.7.) Heute lässt sich der Poetry-Slam einerseits im Hip-Hop, andererseits in der gegenwärtigen Pop-Literatur verorten. Anders (2011) verweist, dass Poetry-Slam ein Club-Event ist und sich aus dem Alltag speist. „Die eher lyrische, mündliche kommunizierte Spielart scheint der ansonsten eher episch ausgerichteten Pop-Literatur einen Platz zu erobern.(Anders 2011, S. 45.) Zudem werden in beiden Literaturströmungen jugendkulturelle und populäre Begriffe benutzt. Auch die für die Pop-Literatur typische Nähe zur Musik lässt sich im Poetry-Slam finden. „Ein Poetry-Slam ähnelt in der Raum – und Sprechinszenierung einem Pop-Konzert – oder der Struktur einer Hitparade; die Länge der einzelnen Beiträge orientiert sich an der 1 Anonym. Online verfügbar unter: (besucht am 30.10.2014). PETER LAMPERT SR12 [DESH-LEISTUNGSNACHWEIS] Herbstsemester 2014 Länge von üblichen Pop-songs.(Anders 2011, S.45.) Des Weiteren verbindet sich die PopLiteratur mit dem Poetry-Slam in der Erklärungsperspektive der Autoren. Sie lassen sich das eigene Leben nicht mehr von einer Elterngeneration erklären, sondern von ihrer eigenen Generation. Die Autoren haben zu ihren vorgetragenen Inhalten, also zu ihren Erfahrungen, einen zeitlich geringen Abstand, da sie diese gerade selbst erleben. (vgl. Anders 2011, S. 45) Die Abgrenzung der Pop-Literatur von Poetry-Slam basiert hauptsächlich auf der Rolle der Performance. Beim Slam Poetry wird bewusster auf lyrische Gestaltungsmittel zurückgegriffen, während Pop-Literatur fast auschliesslich episch ist. (vgl. Anders 2011, S. 45.) Das Genre Slam Poetry lässt sich nur schwer einordnen, da die Texte lediglich an den zeitlichen Rahmen gebunden sind, sich daher durch kürze auszeichnen. Die USamerikanische Autorin OKeefe Aptowicz meinte, dass das einzige gemeinsame Merkmal das laute Vortragen eines Textes einer Einzelperson sei. (vgl. Anders 2011, S.21.) Dennoch gibt es gewisse Merkmale, die den Poetry-Slam eingrenzen: Oft weisen sie ein hohes Mass an Klanglichkeit und Rhythmus auf und zeichnen sich durch Intertextualität, Publikumsinteraktion, Kürze sowie durch Aktualität aus. Des Weiteren sind die Texte verhältnismässig einfach aufgebaut, da sie dem Publikum unmittelbar zugänglich sein müssen, denn der Rezipient kann jeden Beitrag nur einmal hören. Zudem wird Slam Poetry meistens aus der Ich-Perspektive performt, was dazu führt, dass das Publikum oft annimmt, dass die Texte Verarbeitungen von Situationen sind, die der Slam-Poet selbst erlebt hat. (vgl. Anders 2011, S. 22-23.) „Die Grenze zwischen Rolle und Sprecher, zwischen Verfasser und Erzähler verschwimmt.(Anders 2011, S.22.) Das Hauptmerkmal ist allerdings die Oralität. Rhythmik, Klang, Assonanz, Dynamik sind auf Poetry-Slams von essenzieller Bedeutung und lösen einen Text aus seiner Passivität. „Im Gegensatz zur schriftlichen Kommunikation können Autoren bei gesprochenen Texten auch metasprachliche Zeichen wie Intonation nutzen. () Durch das mündliche Präsentieren der Texte kehren Slam-Poeten zum Ursprung der Dichtung, bei der der öffentliche Vortrag dominierte, zurück.(Hager 2006, S.27.) Im Slam Poetry existiert noch keine ausführliche Zusammenstellung formeller Gestaltungsmittel. Denn oft variieren die Gattungs-und Stilvorlieben der Slam-Poeten. Die Poeten verfassen lyrische Texte wie auch Erzählungen, sie stimmen daher ihre Performance auf den jeweiligen Text ab. (vgl. Anders 2008, S.7.) Zusammenfassend trifft man bei PoetrySlams oft auf folgende Formate: Lyrik (Balladen, Heikus, Sonette), Lautpoesie bzw. Klangspiele, (vgl. Schütz 2009, S. 45.) a-capella Rap (Hip-Hop), Freestyle-Texte, Erzählgeschichte (Kurzkrimi, Kurzgeschichte) (vgl. Anders 2008, S.7.) literarische Comedy, interaktive Texte, Team-Texte und Aufzählungstexte. (vgl. Schütz 2009, S.54.) Beim Slam Poetry werden Themen aus allen Lebensbereichen behandelt und dementsprechend werden auch verschiedene Stilmittel genutzt: Die Anmoderationen, welche bereits zur Rhetorik des Textes gehören und das Publikum auf den nächsten Text vorbereiten, die Performance, welche zu den signifikantesten Merkmalen des Slam Poetrys gehört, alle Bereiche der non-und paraverbalen Kommunikation repräsentiert und sich nicht nach dem Muster von richtig und falsch, sondern von Gelingen und Scheitern vollzieht (vgl. Anders 2011, S.29.) die Alltagssprache, die Reime, die Intertextualität, die Interaktionen durch Anrede mit dem Publikum, die Metaphern, die Personifikationen, die Hyperbeln, die rhetorischen Mittel wie Ironie, Sarkasmus, Zynismus, der Satzbau, die Rhythmik, Dialekte und Repetitionen (Refrain ). „‘Mündlichkeit ist durch „Flüchtigkeit und „unauffällige Omnipräsenz charakterisiert; Slam Poetry ist etwas anders gelagert: Sie ist ein „Zwitter aus Mündlichkeit und Schriftlichkeit, ‘ (Abraham 2008, zit. nach Anders 2011, S.93.) auf der Bühne mündlich, aber als Text vorhanden, teilweise auch per Filmmitschnitt mehrmals rezipierbar.(Anders 2011, S.93.) PETER LAMPERT SR12 [DESH-LEISTUNGSNACHWEIS] Herbstsemester 2014 Persönlich bin ich der Meinung, dass sich das Sachthema Poetry-Slam optimal mit dem Sprachlernbereich Präsentieren, Erzählen und Sprechen verknüpfen lässt. „‘Im Poetry-Slam geht es vor allem um den Aufbau von Kompetenzen, in denen sprachliche und sozial-kommunikative Fähigkeiten einander ergänzen und um die Beherrschung von Arbeitstechniken beim Präsentieren. ‘ (Abraham 2008, zit. nach Anders 2010, S.231.) Zudem kann Poetry-Slam eine Vielzahl von Funktionen bei den Schülerinnen und Schüler erfüllen. Der Redner befreit sich beim Reden selbst von Gefühlen und Affekten (kathartischer Effekt), er erklärt sein eignes Denken, indem er über einen Sachverhalt spricht (heuristische Funktion) und er speichert seine Denk-Ergebnisse im eigenen Gedächtnis (mnemotechnische Funktion), indem er Texte auswendig oder wiederholt performt. (vgl. Anders 2011, S. 94.) Ferner bietet sich auch eine authentische Situierung der Aufgaben an. Auch die Präsentation, das Erzählen und das Vortragen haben eine essenzielle Bedeutung für eine gelingende Slam Poetry. Exemplarisch lassen sich anschliessend die erworbenen Performance-Kompetenzen auch auf andere Selbstinszenierungssituationen wie zum Beispiel Bewerbungsgespräche übertragen. 1.3 Konzept des Sprachlernens: Strukturskizze 1.4 Sachthema: Strukturskizze 2.Fachdidaktische Analyse 2.1 Zielanalyse 2.1.1 Grobziele Bei der Unterrichtseinheit zum Thema Sprechen, Präsentieren und Erzählen orientiere ich mich hauptsächlich am Themenbereich 2 „Mündliche Kommunikation des Zentralschweizerischen Lehrplans Deutsch (2.Auflage, 2002) für das 7.-9. Schuljahr. (vgl. EDK 2006) Zusätzlich orientiere ich mich am Lehrplan 21 in dem Bereich D. 3 Sprechen (A, und D), wobei ich mich für spezifische Teilbereiche entscheide, die für meine Unterrichtseinheit relevant sind. (vgl. EDK 2013) 2. Mündliche Kommunikation –Lehrplan Bildungsregion Zentralschweiz 2.1. Situationsgerechte mündliche Kommunikation Wortwahl, Satzbau und Tonfall richten nach der Gesprächssituation dem Partner der Partnerin den persönlichen Bedürfnissen. Der Fokus meiner Unterrichtseinheit liegt eindeutig auf diesem Richtziel. Für die Präsentation, das Erzählen, das Sprechen und der mit einhergehenden Selbstinszenierung sind diese Ziele wegweisend. 2.2. Auf die Partnerin den Partner eingehen, Hörverständnis Andere möglichst verstehen wollen, indem man sich auf das Gesagte konzentriert, die Partnerin den Partner und die Situation beachtet, bei Unklarheiten nachfragt. Dieses Richtziel ist vor allem wichtig, weil die Schülerinnen und Schüler durch die bewusste Beobachtung und des sich Einlassens auf die Situation ihr eigenes Präsentationsverhalten reflektieren sollten, um eigene (Kompetenz-) Adaptionen zu vollziehen. 2.3. Mündliche Textformen, Diskussionen führen Verschiedene Formen mündlicher Texte kennen und selber gestalten, Diskussionen führen können. Dieses Richtziel kongruiert wiederum mit dem Lernbereich Präsentieren, Erzählen, Sprechen, da gerade beim Poetry-Slam die Selbstgestaltung mündlicher Texte fundamental ist. 2.4. Gepflegter Ausdruck in Mundart und Standardsprache Sich in Standardsprache und Mundart deutlich und fliessend ausdrücken, die Standardsprache gepflegt aussprechen. Sprechen, Erzählen und Präsentieren zeichnen sich prinzipiell durch einen deutlichen und fliessenden Sprachgebrauch aus, wobei beim Poetry-Slam Freiheiten gelassen werden können, wenn sie bewusst als stilistisches Inszenierungsmittel verwendet werden. 2.5. Besonderheiten der eigenen Mundart Sich interessieren für die eigene Mundart, ihre Besonderheiten in Wortschatz und Klang. Dieses Richtziel kann dank dem Sachthema Poetry-Slam angestrebt werden. Beim Slam-Poetry darf auch Mundart als Präsentations-, Erzähl-, bzw. Sprechmittel bewusst verwendet werden. Gerade wenn klangliche und wortspielerische Aspekte hervorgehoben werden. D.3. Sprechen Lehrplan 21 A. Grundfertigkeiten: Die Schüler und Schülerinnen können ihre Sprechmotorik, Artikulation, Stimmführung angemessen nutzen. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um angemessen flüssig zu sprechen. Die Schülerinnen und Schüler: A.b: können ihren produktiven Wortschatz aktivieren, um sich in verschiedenen Themen und Situationen sprachlich angemessen auszudrücken. A.c: können nonverbale (z.B. Gestik, Mimik, Körperhaltung) und paraverbale Mittel (z.B. Atmung, Intonation, Sprechfluss) angemessen verwenden. A.d: verfügen über einen zunehmend reichhaltigen Wortschatz, um sich präzis auszudrücken. A.e: -können das Zusammenspiel von Verbalem, Nonverbalem und Paraverbalem zielorientiert einsetzen (z.B. Vorstellungsgespräch). -können Standardsprache flüssig sprechen, wobei diese mundartlich und erstsprachlich gefärbt sein darf. -können ihr Sprechtempo, die Sprechweise der Situation angemessen steuern -können Wörter, Wendungen und Satzmuster in für sie neuen Situationen angemessen verwenden. A.f: können ihr Sprechtempo und ihre Stimmführung gezielt variieren. All diese Teilkompetenzen sind wichtige Mittel für das Darbieten, also Präsentieren, Erzählen und Sprechen beim Poetry-Slam. Gerade die nonverbalen Kompetenzen und deren Zusammenspiel mit den Verbalen und Paraverbalen macht die Inszenierung lebendig und spiegelt die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, sich den Rahmenbedingungen des institutionellen sprachlichen Kontextes anzupassen. B. Monologisches Sprechen: Die Schüler und Schülerinnen können sich in monologischen Situationen angemessen und verständlich ausdrücken. Die Schülerinnen und Schüler: B.a: können ihre Gefühle und Gedanken sowie Erlebnisse und Erfahrungen verbal oder nonverbal mit Unterstützung zum Ausdruck bringen. Erlebtes in Worte fassen und dies zum Ausdruck bringen ist ein wichtiger Zweig des Präsentierens, Erzählen und Sprechen. Das Erlebte ist durch die direkte Teilhabe geprägt und weist wenig Abstraktion auf. Wenn eine emotionale Bindung zu einem Thema besteht, ist der Prozess des Verinnerlichens, hier auch von Abläufen, intensiver, was das Darbieten vereinfachen kann. B.c: können kurze Gedichte vortragen (z.B. Abzählverse, Reime, Sprüche) B.d: können mithilfe eines Schemas ihre Arbeitsergebnisse und Gedanken vortragen (z.B. vorgegebene Textbausteine, Ablauf). Das Schema wäre in Bezug auf meine Unterrichtseinheit die Mittel der Performance, also zum Beispiel einen vorbereiteten Text. B.e: können ein Erlebnis mit einem erkennbaren Spannungsbogen erzählen. können eine erfundene Geschichte erzählen (z.B. mithilfe von Bildern, einer Skizze, einer Erzählpartitur). Diese Kompetenzen können ideal mit dem Poetry-Slam gefördert werden. B.f: können Gedichte und Kurztexte vor einem Publikum wirkungsvoll vortragen. B.g: können mit Unterstützung Sachthemen in Büchern und im Internet recherchieren, auswählen, strukturieren und ihr Wissen präsentieren (z.B. Sachvortrag, Beschreibung, Bericht, Podcast). Da meine Unterrichtseinheit auf eine individuelle Aufarbeitung des Themas PoetrySlam ausgerichtet ist, sind diese Kompetenzen auch von wichtiger Bedeutung. B.h: können Arbeitsergebnisse und Sachthemen der Klasse strukturiert präsentieren und die wesentlichen Aspekte hervorheben sowie dabei Medien ziel- und adressatenorientiert nutzen. Hier wiederum ist wiederum die Adressatenorientierung mit Hilfe eines Mediums im Zentrum, was beim Darbieten fundamental ist, damit die Rezipienten überhaupt interagieren. B.i: können eine Präsentation mit geeigneten sprachlichen Mitteln (z.B. rhetorische Frage, Wiederholungen, Stimme) und angemessenem Medieneinsatz gestalten. Dies ist meiner Meinung nach die schwierigste Kompetenz und sollte angestrebt, aber nicht als Voraussetzung betrachtet werden. D. Reflexion über das Sprech-, Präsentations- und Gesprächsverhalten: Die Schüler und Schülerinnen können ihr Sprech-, Präsentations- und Gesprächsverhalten reflektieren. Die Schülerinnen und Schüler: D.c: -können über Sinn und Funktion von Gesprächsregeln nachdenken. -können mithilfe von Kriterien über eine Präsentation und ihre Wirkung nachdenken (z.B. adressatengerecht). -können sich darüber austauschen, welche (emotionale) Wirkung ein Gesprächsbeitrag auf sie hat. -können ihre Fortschritte in Bezug auf ihr Sprechverhalten in Präsentation und Gespräch mithilfe von Leitfragen beschreiben. D.d: können unter Anleitung darüber nachdenken, in welcher Art und Weise sie selber den Gesprächsverlauf beeinflusst haben. D.e: -können mithilfe von Kriterien eine eigene Präsentation beurteilen. -können über die gewählten Gesprächsformen nachdenken und über deren Angemessenheit sprechen (z.B. Mundart-Standard-Wechsel, Höflichkeit, Jugendsprache). Beim Präsentieren, Erzählen und Sprechen sollte, um den Lerneffekt zu erhöhen, die Darbietung immer reflektiert werden. In meiner Unterrichtseinheit arbeite ich mit einem Konzept, welches sich auf eine kriteriengeleitete Aufarbeitung von Inhalten konzentriert. Die stetige Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernen verlangt diese aufgelisteten Teilkompetenzen. 2.1.2 Feinziele Die Feinziele basieren in hohem Mass auf den Grobzielen der bereits erwähnten Lehrpläne. Insbesondere bei den kognitiven und bei den instrumentellen Feinzielen sollen bewusst Sprachlernziele verfolgt werden. 2.1.2.1 Kognitive Ziele • Die SuS können die grundsätzlichen Regeln des Poetry-Slams nennen. (K1) • Die SuS können ihren produktiven Wortschatz unter Anleitung differenzieren. (K1) • Die SuS können mindestens einen Grund aufzählen, weshalb das Performen eines Poetry-Slam für den Lebensalltag wichtig ist.(K1) • Die SuS wissen, welche Kriterien beim Präsentieren, Erzählen und Sprechen eines Poetry-Slams wichtig sind. (K2) • Die SuS können die wichtigsten Kriterien des Präsentierens, Erzählens und Sprechens mit eigenen Worten erklären. (K2) • Die SuS können einordnen, welcher Performance-Stil in welchem Kontext angebracht ist. (K2) • Die SuS können Präsentationsformen je nach Kontext gezielt anwenden. (K3) • Die SuS sind in der Lage, eine Präsentation oder Erzählung möglichst zuhörergerecht zu performen. (K3) • Die SuS können stilistische Sprachmittel verwenden, um die Zuhörer zu aktivieren. (z.B. Überraschungseffekte) (K3) • Die SuS können die Absichten der Performer deuten und in einen relevanten Kontext einbetten. (K4) • Die SuS können ihre Leistung anhand der vorgegebenen Kriterien reflektieren und sich selber einschätzen. (K5) 2.1.2.2 Instrumentelle Ziele • Die SuS können sich nach dem Performen hilfreiche Notizen machen, welche für Optimierungsprozesse genutzt werden. (K1, K3) • Die SuS können sich eine Meinung über den Inhalt der eigenen und fremden Performance bilden. (K1) • Die SuS kennen Strategien, welche sie beim Präsentieren eines Poetry-Slams unterstützen und wenden diese auch an. (K1, K3) • Die SuS erarbeiten selbständig eine modernisierte Performance. (K3) • Die SuS präsentieren eine ihre Texte vor dem Plenum. (K3) • Die SuS entwickeln selbständig Beurteilungskriterien für die präsentierte Performance. (K5) • Die SuS reflektieren über die Wirkung der präsentierten Beiträge.(K6) • Die SuS können ihre Mitschülerinnen und Mitschüler anhand des erarbeiteten Kriterienraster beurteilen. (K6) • Die SuS können Kriterien eruieren, welche sich für die Performance am besten eignen. (K6) • Die SuS können Hilfsmittel benennen, welche sich für die Performance am besten eignen. (K6) 2.1.2.3 Affektive Ziele • Die SuS fühlen sich von der Thematik Poetry-Slam angesprochen und weichen dieser auch nicht aus.(K1) • Die SuS können sich in die Situation eines Performers versetzten. (K2) • Die SuS können ihre eigenen Gefühle nach dem Performen schildern. (K3) • Die SuS lernen ihre Ängste vor Präsentationen zu überwinden und reflektiert vor eine Gruppe zu treten. (K3) • Die SuS können die Wichtigkeit einer situationsbezogenen Performance werten. (K3). • Die SuS können ihr eigene Performance-Kompetenz einschätzen und erkennen den Alltagsbezug zu diesen Kompetenzen. (K4) • Die SuS können die selbsterarbeiteten vorgetragenen Texte der Mitschülerinnen und Mitschüler vergleichen, die Kriterien kritisch-konstruktiv anwenden und treffen eine Entscheidung hinsichtlich eigener Nützlichkeit. (K6) • Die SuS können ihren Lernzuwachs reflektieren und beurteilen, indem sie die Kriterien der eigenen bevorzugten Performance schriftlich festhalten. (K6) 2.2 Begründungsanalyse 2.2.1 Gegenwartsbedeutung Viele Jugendliche finden auch ohne die Institution Schule den Weg zum Poetry-Slam und geniessen dieses Veranstaltungsformat in ihrer Freizeit. Diese Eigenmotivation sollte sich der Unterricht zu Nutze machen, denn verschiedene Aspekte wirken anziehend auf Jugendliche. Die Gegenwartsbedeutung findet sich also schon darin, dass für einige Schülerinnen und Schüler Poetry-Slam ohnehin bereits eine Bedeutung besitzt. Für andere kann die Eigenwelt durch einen neuen Einfluss erweitert werden, indem sie sich mit einer aktuellen Jugend- bzw. Subkultur befassen, die sie vielleicht noch nicht kennen und deren Intentionen die Schülerinnen und Schüler zu verstehen versuchen. Weiterhin setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit einer aktuellen Repräsentationsform der Literatur auseinander, die sie vielleicht wieder der Literaturrezeption näherbringt und Lesefreude entwickeln lässt. Bei Schülerinnen und Schülern aus benachteiligten Familien herrscht oft eine hohe Unlust am Schreiben vor, auch eine Lesemotivation ist oft nicht vorhanden. Dennoch rezipieren die Schülerinnen und Schüler gerne Texte auditiv. Wenn sie eine Geschichte spannend vorgelesen bekommen, so sind sie solange die Dauer des Vortrags sie nicht überfordert mit ganzer Aufmerksamkeit bei einem Text dabei. Gerade Poetry-Slam bietet sich hinsichtlich dieser Aspekte an, um eine Annäherung nach Literatur zu schaffen: Die Texte sind mit einer Dauer von fünf bis sieben Minuten sehr kurz gehalten, mittels der Performance und den stimmlichen Variationen während eines Vortrags fällt es den Schülerinnen und Schüler leicht, dem Inhalt zu folgen. Auch sind die Themen, die oft dem Alltag entspringen, interessant und nachvollziehbar für Schülerinnen und Schüler aufbereitet. Bei dem Verfassen eigener Texte ist es deutlich motivierender für Schülerinnen und Schüler, wenn sie sich mit Inhalten auseinandersetzen können, die ihre Lebenswelt betreffen. Schulische Erwartungen des Aufsatzunterrichts gemäss einer sozialen Erwünschteste werden bei Slam Poetry zumindest teilweise aufgehoben: Es ist beispielsweise durchaus möglich, Fäkalsprache zu verwenden oder sexuelle Thematiken in den Mittelpunkt des eigenen Textes zu stellen. Gerade das kann für Jungen positiv sein und sie zum Schreiben motivieren, denn Jungen lesen nicht nur anders (vgl. Sommer 2007) sie schreiben auch über andere Themen. Gerade die Dominanz der Männer auf Poetry-Slam-Bühen kann daher Schüler überzeugen, das Prädikat ,,uncool in Bezug auf Literatur zu revidieren. Selbstverständlich können auch Mädchen ein geeignetes Thema für sich in diesem Genre finden und sich von den weiblichen oder männlichen Performance-Poetinnen inspirieren lassen. Dass neue Medien und Online-Angebote eine immer bedeutendere Rolle im Leben der Schülerinnen und Schüler spielen, ist bekannt. Doch muss der Umgang mit den neuen Medien geübt werden, da wichtige Grundkompetenzen sowie die kritische Betrachtung (Medienkritik) noch nicht ausgeprägt wurden. Mit der Online-Recherche beim Poetry-Salm können ihre Fähigkeiten diesbezüglich trainiert und verbessert werden. 2.2.2 Zukunftsbedeutung Das Schreiben als Kulturtechnik besitzt in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert und wird den Schülerinnen und Schüler auch immer wieder begegnen. Sich schriftlich und zielgerichtet ausdrücken zu können, ist daher eine Kompetenz, die auch durch kreatives Schreiben gefördert werden kann. Im besten Fall entwickeln die Schülerinnen und Schüler sogar Freude am Schreiben und im Präsentieren eigener Texte, was zu einem Abbau der Ängste und Schreibhemmungen führen kann. Gerade für das Selbstvertrauen und das eigene Auftreten können Performance-Übungen sinnvoll sein und die Schülerinnen und Schüler bestärken. An Gymnasien und Oberstufen kann die Verwendung von Sprache vor dem Hintergrund von Slam Poetry und der Werke der Hochkultur untersucht werden, um so ein Gefühl für die eigene Sprache und Sprachästhetik zu schaffen. Der Umgang mit Intertexten in der Literatur und mit Hypertexten im Internet, der für die heutige Gesellschaft prägend und besonders wichtig ist, kann besonders an Slam Poetry bearbeitet werden, da sich die SlamPoeten sowohl auf andere Werke aus Film, Fernsehen, Internet und Literatur beziehen, als auch untereinander immer wieder aufeinander verweisen. Doch bedeutend wichtiger an Schulen ist es, den Schülerinnen und Schüler Anregungsfelder für neue Betätigungsfelder aufzuzeigen, in denen sie sich kreativ darstellen können, da sich die Institution Schule „immer noch zu weiten Teilen unsensibel für die Sprache, für Foren und Möglichkeiten des Ausdrucks, für Lebensstile, kulturelle Interessen und Gepflogenheiten von Kindern und Jugendlichen (Mack, 2004, S. 338.) verhält. Poetry-Slam bietet zumindest die Möglichkeit, diesen Lebensstilen und Interessen unter Verwendung der eigenen Sprache Ausdruck zu verleihen, sich Gehör zu verschaffen und den eigenen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Ein ästhetischer Umgang der Sprache kann durch das Vermitteln von Slam Poetry gefördert werden. Auch die Arbeit mit den modernen Medien wird immer wichtiger für die Zukunft der Schülerinnen und Schüler. Textverarbeitung und Grundkenntnisse in der Benutzung des Internets sind Basisfähigkeiten, die jeder Schulabgänger beherrschen sollte. Viel zu selten sind diese neuen Medien allerdings Teil der täglichen Arbeit an Schulen. Gerade im Umgang mit dem Internet, zu dessen effizienter Benutzung mehr Kenntnisse gehören als oft angenommen, existieren meist noch grosse Wissenslücken. So wird die Google Suchleiste im Browser sehr oft als Adressfenster benutzt, indem bei Google statt eines Suchwortes eine Internetseite eingegeben wird. Das ist nicht weiter tragisch, da die Schülerinnen und Schüler trotzdem, wenn auch über einen langen Umweg, auf die gewünschte Website gelangen, aber es zeigt, dass bereits einfachste Grundkenntnisse in der Bedienung neuer Medien oft fehlen. Auch die nötige Medienkritik und das bewerten verschiedener Ergebnisse einer Suchanfrage während einer Internetrecherche werden viel zu selten geübt. Aus diesem Grund ist das Verwenden neuer Medien ein wichtiger Teil in der Unterrichtseinheit über Poetry-Slam. 2.2.3 Exemplarische Bedeutung Mit dem Schreiben von Slam-Poesie wird das zielgerichtete Schreiben und das Ausdrücken von Wünschen, Zielen und Ideen erlernt. Es geht darum, ein Gefühl für die Sprache aufzubauen oder die Sprache zu ästhetischen Zwecken nutzen zu können. Diese Kompetenzen in der zielgerichteten Benutzung der Schriftsprache oder der vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten können daher auch auf die orale Kommunikationssituation übertragen werden, denn auch bei dieser geht es darum, sich adäquat äussern und ausdrücken zu können. Der Prozess des Schreibens erfüllt drei Hauptaufgaben (die psychische, soziale und kognitive Schreibabsicht) (vgl. Fix 2006, S.41.), deren Chancen Schülerinnen und Schüler erkennen und selbst erproben sollten. Erst dadurch, dass ihnen Raum zum selbstständigen Schreiben geboten wird, werden sie in der Lage sein, diese Schreibfunktionen auch für sich nutzbar zu machen. Poetry-Slam kann ein Weg in diese Richtung sein, da all diese drei Funktionen prinzipiell durch diese Texte erfüllt werden können. Ähnliches gilt für die kommunikative Grundfunktion von Texten (vgl. Fix 2006, S.73.), die zu grossen Teilen durch Slam Poetry erfüllt werden könnten. So kann Slam Poetry einen appellativen, informativen und/oder einen ästhetischen Charakter besitzen. Weiterhin lernen die Schülerinnen und Schüler mittels der Einheit zur Performance ihren Körper hinsichtlich der nonverbalen Kommunikation besser kennen und erfahren, wie man mit Hilfe der Mimik und Gestik Gesagtes unterstreichen und verstärken kann. In Bewerbungsgesprächen und vielen anderen Situationen des gesellschaftlichen Lebens ist dies von Bedeutung. 2.2.4 Identitätsbildung Identität entsteht durch den Austausch der eigenen Wahrnehmung mit dem sozialen Umfeld und der Reifung der genetischen Anlagen. Schülerinnen und Schüler, die sich in der Persönlichkeitsentwicklung in der Identitätsfindung befinden, erproben oft neue soziale Rollen. Um eine Identität zu erlangen, müssen die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen aus der Kindheit mit den Veränderungen seines Körpers ebenso in Einklang bringen, wie mit den jetzt aktuellen Anforderungen und Möglichkeiten der Gesellschaft. Poetry-Slam fördert in einem bewussten Prozess die Erprobung von verschiedenen sozialen Rollen. Die Selbstinszenierung während des Präsentierens zielt darauf ab, die Identitätskonstruktion der Schülerinnen und Schüler zu erleichtern, indem sie ihre Rollen bewusst dem institutionellen Kontext anpassen. Zudem können die Schülerinnen und Schüler dank der Erprobung von Rollen sich mit spezifischen Verhaltensweisen identifizieren. Diese Identifikation legt die Grundbausteine der späteren Persönlichkeitsmerkmale in Bezug auf Selbstinszenierungen fest. 2.3 Unterrichtsmaterialien Ich arbeite hauptsächlich mit einem von mir erstelltem Konzept (vgl. Kap. 2.4), welches die Schülerinnen und Schüler dazu anregt, möglichst selbständig zu arbeiten. Es basiert auf Prinzipien der individuellen Förderung wie der Schülerselbstbeurteilung (vgl. Bohl 2008, S. 159-163.) und dem Portfolio-Ansatz. (vgl. Fiegert 2008, S. 145- 149.) Es lässt somit einen grossen Spielraum in Bezug auf die Auswahl und Festlegung von Unterrichtsmaterialen. Demnach können die Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsmaterialen selbständig auswählen. Ich stelle aber Unterrichtsmaterialen zur Verfügung und verweise auch auf mögliche Quellen, welche bei der Erarbeitung der Kriterien nützlich sind. Standortbestimmung: Um den Ist-Zustand zu ermitteln, wird zuerst eine Standortbestimmung durchgeführt. Diese Verfahren ist ein induktiver Einstieg und beruht auf Ansätzen des dialogischen Lernens. Die Standortbestimmung beinhaltet fast alle Kriterien, die für die Aufarbeitung des Inhalts relevant sind. In meinem Fall sind es die Kriterien, welche die Lernbereiche Präsentieren, Erzählen und Sprechen abdecken. Die SuS erhalten eine angeleitete Standortbestimmung, welche sie auffordert, ohne Vorwissen ein Poetry-Slam zu produzieren. Zudem werden sie über spezifische Eigenheiten des Poetry-Slams abgefragt. Die Standortbestimmung enthält auch Lernbereiche wie Schreiben, usw. diese sind aber für die Erarbeitung der mündlichen Sprachkompetenz nicht relevant und deshalb werden sie auch nach der Standortbestimmung nicht mitgeteilt. Kriterienraster: Die SuS erhalten, wie gesagt, nach der Standortbestimmung ein Kriterienraster, welches die Sprachlernbereiche und allgemeinen Lernziele auflistet und in Teilbereiche A, B, C, D, hierarchisch aufgeteilt ist, wobei die schwierigsten Kompetenzen und die Basiskompetenzen verkörpern. Diese dient den SuS zur individuellen Evaluation der persönlichen Kompetenzen in diesen Bereichen. Sie sind nun aufgefordert, eine individuelle Lernplanung zu gestalten: Sie formulieren eigene Lernziele und Kriterien, um die Kriterien der Sprachlernbereiche zu erfüllen. Portfolio: Die SuS arbeiten eigentlich mit einem produktorientierten Portfolio. Hier ist es wichtig, dass die SuS Orientierungspunkte haben und angeleitet werden. Ich habe deshalb ein Beispielportfolio vorbereitet, welches aber sehr offen gestaltet ist, gleichzeitig Fragen aufwirft und die SuS dazu anregen sollte, einen eigenen Weg zu planen. Die SuS müssen ihren individuellen Weg in das mit Fragen geleitete Portfolio aufschreiben. Sie sollten sich also überlegen, mit welchen Kriterien und Methoden sie die Kriterien der finalen summativen Prüfung erreichen. Selbstbeurteilungsinstrument: Das Portfolio beinhaltet auch ein Selbstbeurteilungsinstrument, welches sie ständig begleitet und nach dem Erreichen von einzelnen Kompetenzen abfragt, denn mir persönlich ist es wichtig, dass die Lernenden nicht nur auf einer kognitiven oder affektiven Ebene angesprochen werden, sondern auch dass ihre metakognitiven Kompetenzen geschult werden. Kriterienblatt des Portfolios: Für die Bewertung des produktorientierten Portfolios habe ich auch ein kriterienorientiertes Raster erstellt, welches von dem Ist-Zustand ausgeht, sich dann aber hauptsächlich auf die Selbstbeurteilung bezieht. Mir ist wichtig, dass ich transparent arbeite und die SuS über alle Bewertungen informiere, damit sie sich orientieren können. Einstiegsvideo: Dieser habe ich gewählt, damit die SuS vor der Standortbestimmung eine Idee des Prozesses haben. Vorschläge für Unterrichtsmaterialen: Bücher, Hefte: Hoffmann, S. (2006). Lyrik zum Anfassen. Produktionsorientierter Unterricht mit Gedichten in der Sekundarstufe 1. Horneburg:Persen Verlag GmbH. Dieses Übungsheft beinhaltet viele Ideen und Aufgaben, die für die Erreichung der Kriterien hilfreich sind. Anders, (2011). Poetry Slam. Unterricht, Workshops, Texte und Medien. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH. Auch von diesem Buch stelle ich eine Auswahl an von möglichen Übungen zusammen, die vor allem auf das Performen ausgerichtet sind. Anders, (2010). Poetry Slam im Deutschunterricht. Aus einer für Jugendliche bedeutsamen kulturellen Praxis Inszenierungsmuster gewinnen, um das Schreiben, Sprechen und Zuhören zu fördern. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH. Dieses Buch enthält eine CD, welche einige Übungen anleitet und einige Poetry-Clips aufzeigt. Internetseiten: www.uni-bamberg.de/fileadmin/./Praesentation_Poetry_Slam.ppt Diverse Arbeitsblätter: Diese werden auch den SuS bereit gestellt. Zudem werden die Arbeitsblätter den Kriterien entsprechend hierarchisiert. 2.4 Handlungsmodell für den Unterricht Abbildung: Modell der ressourcenorientierten Lernkontrolle für die Erfassung der inhaltlichen, metakognitiven und arbeitstechnischen Kompetenzen. 3. Unterrichtsplanung 3.1 Grobplanung 1-2 Thema/Inhalte Schwerpunkt: Standortbestimmung Einführung: -Es wird ein Poetry-Slam simuliert: Der Klassenraum wird in einen Zuschauerraum verwandelt, in dem Slam-Poeten via Beamer auftreten. -Die LP schlüpft in die Rolle des Moderators und erklärt die Regeln. -Wenn der Poetry-Slam vorbei ist, startet die Standortbestimmung. Erarbeitung: -Die SuS werden aufgefordert eine schwach angeleitete Standortbestimmung zu lösen, welche sich hauptsächlich auf die Sprachlernbereiche Präsentieren, Erzählen und Sprechtechnik bezieht, um den IstZustand zu ermitteln. -Die SuS sollten also selbständig Kriterien für Lernziele -Die SuS fühlen sich von der Thematik Poetry-Slam angesprochen und weichen dieser auch nicht aus.(K1) -Die SuS können sich eine Meinung über den Inhalt der fremden Performance bilden. (K1) -Die SuS können die grundsätzlichen Regeln des Poetry-Slams nennen. (K1) -Die SuS können ihren produktiven Wortschatz unter Anleitung differenzieren. (K1) -Die SuS entwickeln selbständig Beurteilungskriterien für die präsentierte Performance. (K5) -Die SuS reflektieren über die Wirkung der präsentierten Beiträge.(K6 -Die SuS kennen die Regeln des Portfolios und Methodisch-Didaktisches -Induktiver Einstieg mit Alltagsbezug um das Interesse der SuS zu wecken. Sinnstiftende Wirkung: Themaorientierte Adaption. authentische Einführung. -Standortbestimmung um den IstZustand zu erhellen Orientierungsinstrument für die SuS Selbsteinschätzungsförderung(Identit ätsaufbau) -Die SuS erhalten Kompetenzorientierung. -Selbstbeurteilungsinstrument wiederum für die Entwicklung der Persönlichkeit und Förderung der Organisatorisches -Beamer -Youtube Video -Flip Chart mit Themen der einzelnen Poetry Slam Texten und Auflistung der Performer. -Mikrofon ähnliches Objekt -Stimmkarten -Prüfungsblatt -A4 Blatt mit vorbereiteten Fragen -Kriterien liste die mündliche Kommunikation formulieren, einige Fragen zum Poetry-Slam beantworten und selber schon slamen. -Die Standortbestimmung wird gerade im Anschluss mit geleiteten Fragen reflektiert. -Seitens der LP werden die bewertungsbezogenen hierarchischen Kriterien ausgeteilt, damit die SuS ihre Kriterien mit diesen vergleichen können. Die SuS haben nach dem Vergleich die Möglichkeit, Kriterien zu hinterfragen und zu verändern. -Kriterien welche in der Liste noch nicht vorhanden sind werden nach dem Einsammeln der Standortbestimmungen in einem späteren Schritt eventuell der Kriterienliste hinzugefügt. -Einführung und Erklärung der individuellen Lernplanung-Die SuS bekommen das Portfolioraster. -Austeilung der Kriterien für die Bewertung der des individuellen Arbeitens. Die SuS kennen den Plan der nächsten Lektionen und können ihre Zeit selber einteilen. -Die SuS können das Vorgehen der Planarbeit erklären. metakognitiven Kompetenzen. -Fachbezug wird hergestellt. Eigene Einschätzung wird mit Theorie verglichen. Dadurch Überlegungen für Strategien, um die fachlichen Kriterien zu erreichen. -Transparenz durch Deklarierung der Bewertungskriterien, sollte eine sinnstiftende Wirkung haben. -Ernstnehmen und Stärken des Selbstwertgefühls der SuS. -Kriterienliste hat die Funktion der individuellen Schwerpunktsetzung für den Kompetenzerwerb. Austeilung des Beispielportfolios: Imitatives Lernen-Lernen am Modell -Strukturierende Massnahmen (Kriterienheriarchie) als Hilfestellung für die SuS. Optimierung des Lernprozesses. -Ergebnissicherung als Kontrollinstrument -Modell für die weitere Erarbeitung der Kriterien. -Wandtafel -Portfolio Beispiel -Raster zum erstellen eines Portfolios -Bewertungs Kriterienblätter -Übungsmaterial welches den Kriterien der einzelnen Teilbereiche entspricht und zugeteilt ist. -Raster zur Erstellung des Portfolios 2-3 Portfolios. -Austeilung der Kriterien für die Bewertung der formativen Prüfung. -Austeilung eines Beispielportfolios -Bereitstellung des Übungsmaterials, welches ähnlich wie bei einer Lernwerkstatt den jeweiligen Kriterien entsprechend bereit gestellt wird. Ergebnissicherung: -Die SuS beginnen mit der individuellen Lernplanung und formulieren im angeleiteten Portfolio mindestens drei an die Sprachlernbereiche gekoppelte, überschaubare, individuelle an den Kriterien orientierte Lernziele. Schwerpunkt: individuelles Arbeiten Einführung: -Die SuS schauen eine Performance auf YouTube: watch?v34VNA3HcP5U. und versuchen diese in Bezug auf die Kriterienliste zu analysieren und halten ihre Eindrücke im Portfolio -Die SuS kennen Strategien, welche sie beim Präsentieren eines Poetry-Slams unterstützen und wenden diese auch an. (K1, K3) -Die SuS können mindestens einen Grund aufzählen, weshalb das Performen eines Poetry- -Anwendung eigener Strategien durch Modell, um Kompetenzbereiche zu ermitteln. -Der Filmausschnitt soll exemplarisch aufzeigen, dass auch wenn alle SuS das Gleiche hören, unterschiedliche Vorstellungen evoziert werden. Das Vorwissen zur Thematik ist dabei entscheidend und hilft bei der Orientierung. -Zwischenbilanz -Youtube Film -Portfolio -Sitzplätze können täglich gewechselt werden -Der Klassenraum darf durch die SuS selbstständig fest. -Einige SuS werden aufgefordert der LP mitzuteilen, welche Kriterien sie schon wie erarbeitet haben. Erarbeitung: -Die SuS erarbeiten individuell die Kriterien mit Hilfe des Portfolios und den Übungsmaterialien. -Die SuS beurteilen sich im Portfolio konstant selbst. -Die LP stellt bewusste Zeitgefässe für die Besprechung individueller Anliegen zur Verfügung. Exemplarisch stelle ich kurz eine Übung aus den Übungsmaterialein vor: -Die SuS formulieren einen (autobiographischen) Prosatext in einen lyrischen Text um. Satz für Satz werden Kerngedanken aus dem Fliesstext in eine detailreiche, konkrete, lautmalerische Sprache übertragen. (Hier folgt ein vorgefertigtes Beispiel). Der Text sollte Klangwörter, Umgangssprache, elliptische Strukturen und metaphorische Mittel Slam für den Lebensalltag wichtig ist. (K1) -Die SuS erarbeiten selbständig eine modernisierte Performance. (K3) -Die SuS können sich nach dem Performen hilfreiche Notizen machen, welche für Optimierungsprozesse genutzt werden. (K1, K3) -Die SuS können die wichtigsten Kriterien des Präsentierens, Erzählens und Sprechens mit eigenen Worten erklären. (K2) -Die SuS können einordnen, welcher Performance-Stil in welchem Kontext angebracht ist. (K2) -Die SuS können ihre eigenen Gefühle nach dem Performen schildern. (K3) -Die SuS können sich in die Situation eines Performers versetzten. (K2 -Die SuS können die Absichten der Performer deuten und in einen relevanten Kontext einbetten. (K4) -Die SuS können ihre -Selbstgesteuertes Lernen: Prinzip der minimalen Hilfe, welche die echte Lernzeit erhöht. -Lernbemühungen kommen zum Ausdruck, -Bewusste Reflexion -Förderung der Urteilsfähigkeit -Transparente nachvollziehbare Bewertungsprozesse -Portfolioansatz: Sammlung, Auswahl, Reflexion, Konsequenzen, Präsentation -Produktorientiertes Portfolio: -Förderung der arbeitstechnischen Kompetenzen. Leistungsdruck durch punktuelle Überprüfung wird abgemildert, Erhöhung der Beurteilungsgerechtigkeit, starke innere Differenzeirung, welcher der Anteil an echter Lernzeit erhöht. -Das Portfolio ist hauptsächlich für die Erarbeitung der Sprachlernbereiche zuständig. Es enthält unter anderem selbst verfasste Texte, angeleitete Sprechübungen, etc. Selbstbeurteilungsinstrument: -Förderung der metakognitiven Kompetenzen für die Optimierung der Lerntechnik und –strategien. -Ergebnissicherung als Kontrolle für die LP. umgestaltet werden. -LP ist Coachperson -Redefreiheit für die SuS -Portfolio Übungsmaterialie 4 enthalten. Die SuS suchen sich einen Partner und präsentieren ihren Text, indem sie aber Rücken an Rücken stehen. Die SuS äussern ihren Eindruck nach den folgenden Leitfragen: -War der Text akustisch zu verstehen? -Welche Wirkung hat er erzeugt? -Welche Stimmung wurde deutlich? -Um welches Thema oder Motiv drehte sich der Text? -Wie wurde der Zuhörer einbezogen? Nach dem Feedback erfolgt eine zweite Runde, bei der sich beide gegenüberstehen und die körperlichen Stilmittel zur Wirkung kommen, welche wiederum analysiert werden, usw. Ergebnissicherung: -Die SuS haben in den Teilbereichen E, D, des Kriterienrasters mindestens je 3 Kriterien bearbeitet. Schwerpunkt: Zwischenbilanzierung Einführung: -Hier erfolgt eine formative Leistung anhand der vorgegebenen Kriterien reflektieren und sich selber einschätzen. (K5) -Die SuS können ihren Lernzuwachs reflektieren und beurteilen, indem sie die Kriterien der eigenen bevorzugten Performance schriftlich festhalten. (K6) (Bei der Zwischenbilanzierung sollten alle Lernziele der Lektionen 2-3 erarbeitet -Formative Zwischenprüfung in der 4er Gruppen Form. äussere Differenzierung. -Texte der SuS 5-6 Prüfung, welche die Teilbereiche E, und des Kriterienrasters aufgreift. Erarbeitung: -Die SuS präsentieren einzeln nur vor einer 4erGruppe und der LP einen eigenen Text und wenden gezielt die Kriterien der Sprachlernbereiche an. --Selbst- und Fremdreflektion. -Die restlichen SuS arbeiten individuell an dem Portfolio bis sie an der Reihe sind. Ergebnissicherung: Die formative Prüfung dient als Zwischenbilanz und kann als Grundlage für die Eruierung weiterer Schritte in Betracht gezogen werden. Schwerpunkt: individuelles Arbeiten Einführung: -Die SuS haben die Möglichkeit ihre Portfolios zu vergleichen und diese auch gegenseitig zu bewerten. Erarbeitung: -Die SuS erarbeiten individuell die Kriterien sein, wobei dies nur eine Orientierung für die LP ist, da die SuS die Aufarbeitung der Lernziele individuell gestalten.) Zusammenfassend werden folgende Kompetenzen erwartet: -Selbst und Fremdreflexion für die Optimierung der Lernstrategien. -4er Gruppe weil es einfacher ist, vor einer Kleingruppe zu präsentieren und trotzdem bereits Präsentationskompetenzen erwartet werden können. -LP sollte viel loben. positive Verstärkung erhöht den Lernerfolg. -Zeigt Lern- und Verhaltensfortschritte auf -Deckt frühzeitig Lücken und Probleme auf -Zeigt ob der ideale Lernweg eingehalten werden kann. Die SuS wissen, welche Kriterien beim Präsentieren, Erzählen und Sprechen eines PoetrySlams wichtig sind. (K2) -Die SuS können Präsentationsformen je nach Kontext gezielt anwenden. (K3) -Die SuS sind in der Lage, eine Präsentation oder (Vgl. Individuelles Arbeiten, Lektionen 2 und 3) (Vgl. Individuelles Arbeiten, -Hausaufgabe als Vorbereitung auf die Lektionen 2 und 3 summative Lernkontrolle, konkreter Einbezug der Sprachlernbereiche: Präsentieren, Erzählen und -Portfolio Sprechtechnik. Vorbereitungszeit für die Einübung der Performance. Realitätsbezug. Sinnstiftende Wirkung mit Hilfe des Portfolios und den Übungsmaterialien. -Die SuS beurteilen sich im Portfolio konstant selbst. -Die LP stellt bewusste Zeitgefässe für die Besprechung individueller Anliegen zur Verfügung. -Die SuS verfassen als Hausaufgabe einen eigenen Text den sie bei der summativen Prüfung anwenden werden, also präsentieren und erzählen. Ergebnissicherung: -Die SuS haben alle Teilbereiche des Kriterienrasters bearbeitet und geben eine Kopie des Portfolios der LP ab. Erzählung möglichst zuhörergerecht zu performen. (K3) -Die SuS können stilistische Sprachmittel verwenden, um die Zuhörer zu aktivieren. (z.B. Überraschungseffekte) (K3) -Die SuS lernen ihre Ängste vor Präsentationen zu überwinden und reflektiert vor eine Gruppe zu treten. (K3) -Die SuS können die Wichtigkeit einer situationsbezogenen Performance werten. (K3). -Die SuS können ihr eigene PerformanceKompetenz einschätzen und erkennen den Alltagsbezug zu diesen Kompetenzen. (K4) -Die SuS können ihre Mitschülerinnen und Mitschüler anhand des erarbeiteten Kriterienraster beurteilen. (K6) -Die SuS können Kriterien eruieren, welche sich für die Performance am besten eignen. (K6) -Die SuS können Hilfsmittel benennen, welche sich für die Performance am besten eignen. (K6) -Die SuS können die selbsterarbeiteten vorgetragenen Texte der Mitschülerinnen und Mitschüler vergleichen, die Kriterien kritischkonstruktiv anwenden und treffen eine Entscheidung hinsichtlich eigener Nützlichkeit. (K6) 7-8 Schwerpunkt: Slam Poetry Einführung: -Hier wird wiederum ein Poetry-Slam simuliert: Das Klassenzimmer wird in einen Zuschauerraum verwandelt und die LP übernimmt die Rolle des Moderators. Erarbeitung: -Die SuS lösen eine schriftliche Prüfung zum Thema Poetry-Slam welche ca. aus 3 Aufgaben besteht. -Die SuS performen ein Poetry à 2min. vor der ganzen Klasse und werden dabei filmisch aufgenommen. Sie sollten die erarbeiteten Kriterien -Die SuS präsentieren eine ihre Texte vor dem Plenum. (K3) -Die SuS lernen ihre Ängste vor Präsentationen zu überwinden und reflektiert vor eine Gruppe zu treten. (K3) -Die SuS sind in der Lage, eine Präsentation oder Erzählung möglichst zuhörergerecht zu performen. (K3) -Die SuS können ihre Leistung anhand der -Klassenraum wird wiederum in eine Bühne verwandelt, um einen Realitätsbezug herzustellen. -Veränderte Pultordnung -Prüfung durch Anwendung des deklarativen Wissens und prozeduralem Wissen über PoetrySlam vor dem Plenum, damit ein nachhaltiger Lernprozess stattfindet. -Schriftliche Prüfung -Plenum -Kamera -Die SuS sollen sich selbst beurteilen, damit LP sieht, ob der Arbeitsprozess mit dem Portfolio zu einer kompetenten Selbsteinschätzung geführt hat. Erfassung der metakognitiven Kompetenzen. -Summative kriteriengeleitete Lernkontrolle formative Zwischenbllanz Portfolio mit integrierter Selbstbeurteilung -Aufgenommene Filme -(Stimmkarten) möglichst anwenden. -Nach der Performance beurteilen sich die SuS selbst. Sie bekommen den Film und geben sich selber eine Note. (Variation: Stimmkarten werden ausgeteilt und die SuS bewerten sich nach den offiziellen Regeln selbst.) Ergebnissicherung: -Die erarbeiteten Kriterien in allen Teilbereichen werden kompetenzorientiert geprüft. vorgegebenen Kriterien reflektieren und sich selber einschätzen. (K5) Ganzheitliches Bild der Leistung 3.2 Feinplanung der Einstiegsdoppellektion Praxislehrperson: Peter Schuler Fach: Deutsch Name der/des Studierenden: Peter Lampert Datum: 07.01.2014 Thema: Poetry-Slam Voraussetzungen: Lernziele: -Die SuS fühlen sich von der Thematik Poetry-Slam angesprochen und weichen dieser auch nicht aus.(K1) -Die SuS können sich eine Meinung über den Inhalt der fremden Performance bilden. (K1) -Die SuS können die grundsätzlichen Regeln des Poetry-Slams nennen. (K1) -Die SuS können ihren produktiven Wortschatz unter Anleitung differenzieren. (K1) -Die SuS entwickeln selbständig Beurteilungskriterien für die präsentierte Performance. (K5) -Die SuS reflektieren über die Wirkung der präsentierten Beiträge.(K6) -Die SuS kennen die Regeln des Portfolios und des individuellen Arbeitens. Die SuS kennen den Plan der nächsten Lektionen und können ihre Zeit selber einteilen. -Die SuS können das Vorgehen der Planarbeit erklären. Phasen Lehr-Lernhandlungen o . o m Zeit EI/ER/ES Aktivitäten der Lehrperson und der Schüler/innen U E / A G 20‘ EI Erster Schübelbach-Buttikon-Slam: -Es wird ein Poetry-Slam simuliert: Der Klassenraum wird in einen Zuschauerraum verwandelt, in dem SlamPoeten via Beamer auftreten. Dazu wird seitens der LP ein Flipchart vorbereitet, auf der eine motivierende Ankündigung mit Lokalbezug steht (z.B. „Erster Schübelbach-Buttikon-Slam) und auf der bereits die Slam-Poeten stehen, die die moderierende LP im Vorfeld zur Präsentation ausgesucht hat. U Medien Didaktischer Kommentar Begründung der Planung mit Blick auf die Lernprozesse Mikrofon Flipchart Stimmkarten-Sets. Die Simulation des Poetry-Slams sollte eine möglichst realitätsnahe Umgebung schaffen und die SuS mit Hilfe eines Überraschungseffekt motivieren. Es stellt einen induktiven Zugang dar, welcher auf Prinzipien des dialogischen Lernens basiert. Die SuS -Variation: Die SuS äussern Wünsche bezüglich des Themas, des Genres oder ob Team oder Einzelbeiträge gesehen werden sollen. Die LP sollte dann aber passende Beispiele griffbereit haben. -Die moderierende LP teilt fünf vorbereitete Stimmkarten-Sets mit Zahlen von 1 bis 10 willkürlich an 5 SuS aus. -Die SuS werden aufgefordert nach jedem Poetry-Clip die Stimmkarten-Sets weiterzugeben. -Die LP schlüpft nun in die Rolle eines Slam-Moderators und erklärt wie beim Poetry-Slam kurz die Regeln: Selbstverfasstes, Zeitlimit, Kostümverbot, Abstimmungsmodus. Anschliessend werden die Stimmtafeln verteilt und zeigt einen Poetry-Clip. Die LP bittet die Jury, ihre Noten zeitgleich und ohne abzugucken beim Nennen der Zahl drei hochzuhalten. Höchste und niedrigste Zahlen werden gestrichen. Ohne das Ergebnis zu diskutieren, beginnt der Simulations-Slam, bei dem der Moderator nacheinander 5 bis 6 Beispiel-Performances per Beamer zeigt und nach jeder Performance die Punktbewertung ermittelt. Für den besten Poeten ist ein virtueller Preis vorgesehen. Wenn der Poetry-Slam vorbei ist, startet die Standortbestimmung. YouTube Beamer sollten die Themenhinführung selber entdecken: Der offene Zugang zum Thema wird bewusst gewählt, damit die SuS Vermutungen und Vorurteile in Bezug auf die zu erarbeiteten Ziele elaborieren. Dies sollte eine emotionale Spannung erzeugen und so die Aufmerksamkeit der SuS auf das Thema lenken. In Bezug auf die Aufarbeitung des Themas sind diese Schritte fundamental, da die Inhalte des Themas während dieses Vermutens auf das eigene Selbstbild projiziert werden und durch die Offenheit des Einstiegs nie ganz abgeschlossen sind. Normalerweise ist es bei der Identifikation mit einem Thema bei einem deduktiven Vorgang für die SuS schnell klar, ob die Inhalte für ihr Selbstbild relevante Bezüge enthalten oder nicht. Beim induktiven Einstieg verändern sich diese Bezüge immer wieder und die SuS sind grundsätzlich interessierter, da sie immer neue Identifikationen ausleben. Die Flipchart und der Lokalbezug sollten Identifikationsmittel schaffen, welche auf gesellschaftlichen Sozialisationsprozesse basieren, der Lokalbezug ist für die Partizipation in der Gesellschaft ein grundlegendes Instrument und könnte deshalb auch in diesem Kontext das Interesse und die Motivation erhöhen. Anschliessende Lernprozesse werden dank der intrinsischer Motivation intensiviert und dadurch der Lernerfolg erhöht. Die Variation basiert auf dem demokratischen Lernen. Die SuS können eigene Wünsche und Interessen kundgeben und in den Unterricht miteinfliessen lassen. Dieser Prozess fungiert als positiver Verstärker und sollte das Interesse und somit den Lernerfolg erhöhen. Die Stimmkarten und die Moderation der LP schafft einen Realitätsbezug, engt aber gleichzeitig das Themenfeld ein, was inhaltliche Klarheit verschafft aber auch Interessen vermindern könnte. -Die SuS als Jury zu bestimmen, sollte die SuS dazu anregen, sich schon Gedanken über gelungene bzw. nicht gelungene Slams zu machen. Sie bewerten unbewusst mit schon impliziten Kriterien die Performance, was für den späteren Vergleich (Kriterienliste mit eigenen Kriterien) wichtig ist. In diesem Zusammenhang urteilen sie über mündliche Kompetenzen und sie werden langsam zum Thema hingeführt. Das Weitergeben der Stimmkarten erhöht die kognitive Partizipation der SuS und sollte zu einem positiven Klassenklima beitragen. 20‘ ER Standortbestimmung: Ist-Zustand -Die SuS lösen eine Standortbestimmung, welche einige Fragen über die Regeln des Poetry-Slam beinhaltet, die SuS dazu auffordert, eigene Kriterien für die Präsentation, für das Erzählen und für die Sprechtechnik zu formulieren. -Die Formulierung der eigenen Kriterien wird unterstützt durch eine Aufgabe, i