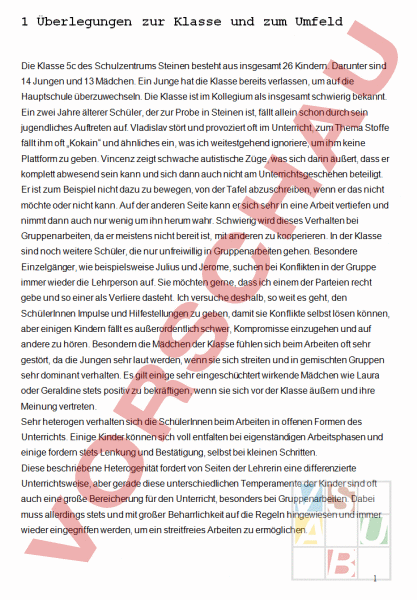Arbeitsblatt: Stofftrennung
Material-Details
Stofftrennung "Auslesen" bei Brausepulver
Chemie
Gemischte Themen
5. Schuljahr
15 Seiten
Statistik
15006
2634
6
31.01.2008
Autor/in
Ina Nass
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
1 Überlegungen zur Klasse und zum Umfeld Die Klasse 5c des Schulzentrums Steinen besteht aus insgesamt 26 Kindern. Darunter sind 14 Jungen und 13 Mädchen. Ein Junge hat die Klasse bereits verlassen, um auf die Hauptschule überzuwechseln. Die Klasse ist im Kollegium als insgesamt schwierig bekannt. Ein zwei Jahre älterer Schüler, der zur Probe in Steinen ist, fällt allein schon durch sein jugendliches Auftreten auf. Vladislav stört und provoziert oft im Unterricht, zum Thema Stoffe fällt ihm oft „Kokain und ähnliches ein, was ich weitestgehend ignoriere, um ihm keine Plattform zu geben. Vincenz zeigt schwache autistische Züge, was sich darin äußert, dass er komplett abwesend sein kann und sich dann auch nicht am Unterrichtsgeschehen beteiligt. Er ist zum Beispiel nicht dazu zu bewegen, von der Tafel abzuschreiben, wenn er das nicht möchte oder nicht kann. Auf der anderen Seite kann er sich sehr in eine Arbeit vertiefen und nimmt dann auch nur wenig um ihn herum wahr. Schwierig wird dieses Verhalten bei Gruppenarbeiten, da er meistens nicht bereit ist, mit anderen zu kooperieren. In der Klasse sind noch weitere Schüler, die nur unfreiwillig in Gruppenarbeiten gehen. Besondere Einzelgänger, wie beispielsweise Julius und Jerome, suchen bei Konflikten in der Gruppe immer wieder die Lehrperson auf. Sie möchten gerne, dass ich einem der Parteien recht gebe und so einer als Verliere dasteht. Ich versuche deshalb, so weit es geht, den SchülerInnen Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit sie Konflikte selbst lösen können, aber einigen Kindern fällt es außerordentlich schwer, Kompromisse einzugehen und auf andere zu hören. Besondern die Mädchen der Klasse fühlen sich beim Arbeiten oft sehr gestört, da die Jungen sehr laut werden, wenn sie sich streiten und in gemischten Gruppen sehr dominant verhalten. Es gilt einige sehr eingeschüchtert wirkende Mädchen wie Laura oder Geraldine stets positiv zu bekräftigen, wenn sie sich vor der Klasse äußern und ihre Meinung vertreten. Sehr heterogen verhalten sich die SchülerInnen beim Arbeiten in offenen Formen des Unterrichts. Einige Kinder können sich voll entfalten bei eigenständigen Arbeitsphasen und einige fordern stets Lenkung und Bestätigung, selbst bei kleinen Schritten. Diese beschriebene Heterogenität fordert von Seiten der Lehrerin eine differenzierte Unterrichtsweise, aber gerade diese unterschiedlichen Temperamente der Kinder sind oft auch eine große Bereicherung für den Unterricht, besonders bei Gruppenarbeiten. Dabei muss allerdings stets und mit großer Beharrlichkeit auf die Regeln hingewiesen und immer wieder eingegriffen werden, um ein streitfreies Arbeiten zu ermöglichen. 1 Die SchülerInnen sind einige naturwissenschaftliche Arbeitsweisen gewohnt. Sie können Versuchsprotokolle schreiben und sich Materialien selbständig für die Durchführung holen. Diese Arbeitsweise braucht allerdings auch viel Zeit und der Unmut über das viele Schreiben bei Versuchen wird deutlich gezeigt. Deshalb ist es für sie um so schöner ab und zu Arbeitsblätter zu bekommen, auf die sie ihre Lösungen und Beobachtungen schreiben können ohne jedes Mal selbst ein Protokoll anfertigen zu müssen. Mein Verhältnis zur Klasse würde ich als gut und offen beschreiben. Für mich als Lehrperson ist es allerdings sehr anstrengend, die in jeder Gruppenarbeitsstunde auftretenden Streitereien zu schlichten. Dies kostet viel Zeit und Mühe und behindert immer noch stark den sachlichen Lernprozess. Der NWA-Unterricht am Freitag findet im Biologiesaal statt. Die Tische stehen dort in der Regel in Reihen, nur für Gruppenarbeiten werden sie zusammen geschoben. Es gibt eine feste Gruppeneinteilung mit jeweils 4 Kindern, die über mehrere Wochen bleibt, bevor gewechselt wird. Außer bei der Einteilung zu kleineren oder größeren Gruppen, wird neu für die jeweilige Stunde eingeteilt. Die Ausstattung des Biologiesaals ist gut. Standardmäßig befinden sich dort Waschbecken, Stromanschlüsse, ein Tageslichtprojektor und ein großes Pult mit Schutzglas. 2 2 Überlegungen zum Unterrichtsgegenstand Farbe, Härte, Geschmack, Schmelz- und Siedetemperatur und so weiter sind Stoffeigenschaften. Durch ihre unterschiedlichen Eigenschaften kann man die einzelnen Stoffe voneinander unterscheiden. Außerdem wird zusätzlich zwischen Reinstoffen und Stoffgemengen unterschieden. Ein Reinstoff besteht aus einer einzelnen Stoffart. Durch bestimmte Versuche kann herausgefunden werden, ob ein Stoff ein Reinstoff ist oder nicht. Charakteristisch für Reinstoffe sind ihre konstanten Eigenschaften: Schmelz- und Siedetemperatur, Farbe, Geruch, Geschmack und so weiter sind immer die gleichen. Wirkliche Reinstoffe sind jedoch sehr schwer herzustellen, auch in reinem Zucker oder Salz sind noch geringe Mengen von anderen Stoffen enthalten. Auch in der Natur sind die meisten Reinstoffe durch winzige Mengen anderer Stoffe verunreinigt. Wenn aber die Eigenschaften dieser leicht verunreinigten Stoffe fast konstant sind, spricht man dennoch von Reinstoffen. Ein Stoffgemenge oder ein Gemisch besteht aus mehreren Stoffarten, die nebeneinander vorliegen. Die Eigenschaften der Gemische ändern sich, wenn die Stoffe des Gemisches in verschiedenen Mengen vorhanden sind. Deshalb gibt es auch für Gemische keine Schmelzund Siedepunkte sondern Schmelz- und Siedebereiche. Farben, Geruch und Geschmack von Gemischen sind veränderlich. Stoffgemenge (Gemische) werden außerdem eingeteilt in heterogene und homogene Gemische. In einem heterogenem Gemisch sind die einzelnen Stoffe des Gemisches gut zu erkennen. Diese Gemenge sehen uneinheitlich aus. Ein homogenes Gemisch hingegen sieht einheitlich aus, das heißt, man kann die einzelnen Stoffe des Gemisches weder mit dem bloßen Auge noch mit dem Mikroskop erkennen. Diese Gemenge sehen aus wie Reinstoffe. Stoffgemenge können durch Trennverfahren in ihre einzelnen Reinstoffe aufgetrennt werden • Unter Sedimentieren versteht man das Absinken von feinen unlöslichen Feststoffteilchen in einer Flüssigkeit. • Unter Dekantieren versteht man das Abgiessen einer Flüssigkeit, welche sich über einem unlöslichen Feststoff oder einer unlöslichen Flüssigkeit befindet. Die Dekantation ist keine sehr genaue Trennmethode. • Durch eine Filtration kann man eine Flüssigkeit von einem in ihr unlöslichen Feststoff trennen. Um ein Gemisch zu filtrieren, gießt man das Gemisch durch ein Sieb oder ein Filterpapier. 3 • Zum Zentrfugieren wird ein spezieller Apparat benötigt, eine Zentrifuge. Eine Zentrifuge besteht hauptsächlich aus einer Achse, an der man an zwei beweglichen Seitenarmen dickwandige Reagenzgläser anbringen kann. • Durch Abscheiden in einem Scheidetrichter kann man zwei ineinander unlösliche Flüssigkeiten trennen • Durch Abdampfen eines homogenen Gemisches (löslicher Feststoff in einer Flüssigkeit) kann man den löslichen Feststoff von der Flüssigkeit trennen. • Unter Extrahieren versteht man das Herauslösen von Stoffen mithilfe eines Lösungsmittels. Man kann sowohl eine bestimmte Flüssigkeit aus einer anderen Flüssigkeit herauslösen, als auch lösliche Feststoffe aus Flüssigkeiten oder aus anderen Feststoffen herauslösen. • Mit einer einfachen Destillation kann man sehr leicht lösliche Feststoffe von einem Lösungsmittel trennen. • Durch Chromatografie kann man sehr komplizierte Gemische, wie zum Beispiel Farbstoffgemische, in ihre Bestandteile auftrennen. • Eisen kann man mithilfe eines Magneten von anderen Feststoffen oder Flüssigkeiten abtrennen. • Durch Auslesen werden Stoffgemenge, bei dem mit dem Auge oder optischen Hilfsmitteln die Reinstoffe unterschieden werden können, getrennt. So kann zum Beispiel Brausepulver mithilfe einer Lupe und Zahnstochern in seine Bestandteile ausgelesen werden: Natriumhydrogencarbonat, Weinsäure mit Farbstoff und Zucker. Brausepulver Das von Kaufmann Theodor Beltle erfundene Brausepulver besteht also aus Zucker, Natriumhydrogencarbonat, Weinsäure, Aromen und Farbstoffen. Es schäumt in Wasser stark auf, da es Kohlensäure und in einem zweiten Schritt Kohlenstoffdioxid bildet. Da mehr Kohlenstoffdioxid gebildet wird, als im Wasser löslich ist, entweicht es aus der Flüssigkeit und wirbelt die Feststoffe durch das Lösungsmittel. Nach dem Aufschäumen bleibt ein Säureüberschuss vorhanden, um einen guten Geschmack garantieren zu können. 4 3 Angestrebte Unterrichtsziele und Kompetenzen Kompetenzen Das übergeordnete Ziel dieser NWA-Stunde ist, den Schülern und Schülerinnen im Bereich „Stoffe und ihre Eigenschaften den Unterschied zwischen Reinstoffen und Stoffgemischen bewusst zu machen. Sie können durch das Trennverfahren „Auslesen ein Stoffgemisch nachweisen und in seine Reinstoffe trennen. Sie sollen „durch exemplarisches Wissen und Erfahrungen mit der Vielfalt der Stoffe eigenverantwortlich umgehen können. Sie können selbstständig die Phänomenologie von Stoffen beschreiben und haben grundlegende Kenntnisse über Eigenschaften von Stoffen. Stoffe, die im Alltag wichtig sind, „können sie „experimentell () darstellen;1 Fachliche Ziele Die Schülerinnen sollen • Die Unterschiede von Reinstoffen und Stoffgemischen erklären können. • Brausepulver als Stoffgemisch erkennen und seine Reinstoffe benennen. Methodische Ziele Die Schülerinnen sollen • naturwissenschaftliche Versuche selbständig durchführen. Personale Ziele Die Schülerinnen sollen • sich konzentriert und motiviert dem Unterrichtsgegenstand zuwenden. • ihre feinmotorischen Fähigkeiten schulen, indem sie mit dem Zahnstocher auslesen. Soziale Ziele Die Schülerinnen sollen • 1 in gegenseitiger Wertschätzung und Hilfsbereitschaft zusammenzuarbeiten. vgl. Bildungsplan 2004 5 4 Didaktische Überlegungen Bezug zum Bildungsplan Die Unterrichtsstunde ist die Einführungsstunde in Stofftrennungen innerhalb der Unterrichtseinheit „Umgang mit Stoffen aus dem Alltag. Die Kompetenzen und Lernziele führe ich in Punkt 3 auf. Gegenwartsbedeutung Die Schülerinnen kennen Brausepulver vermutlich aus ihrem Alltag und wissen um den Geschmack und das Gefühl des Prickelns auf der Zunge. Bisher haben sie sich auf der stofflichen Ebene aber noch nicht mit dem Thema auseinander gesetzt. Sie kennen schon unterschiedliche Stoffeigenschaften und können diese wahrscheinlich anwenden, wenn sie die unterschiedlichen Inhaltsstoffe beispielsweise auf ihre Löslichkeit überprüfen werden, mit Stoffgemischen sind sie aber noch nicht bekannt. Es ist anzunehmen, dass sie die Unterschiede zwischen Reinstoffen und Stoffgemischen aber problemlos verstehen werden, da sie durch die alltägliche Stofftrennung, wie zum Beispiel beim Kaffee etc. Vorkenntnisse besitzen. Zukunftsbedeutung Das Trennverfahren „Auslesen ist das erste Trennverfahren, das die Kinder in dieser Stunde kennen lernen. Sie lernen auch für die kommenden Trennverfahren, dass eine genaue Untersuchung des Stoffes wichtig ist und dass die Stoffeigenschaften eine entscheidende Rolle spielen, um ein Trennverfahren zu entwickeln. Die Feinmotorik wird sehr beansprucht beim Auslesen des Brausepulvers und Geduld ist ein Muss bei diesem Versuch. Die SchülerInnen lernen also, dass es bei naturwissenschaftlichen Versuchen wichtig ist, ordentlich und geduldig zu sein. Außerdem werden sie feststellen, dass nicht immer das gewollte Ergebnis herauskommt und, dass sie dazu weitere Recherchen anstellen müssen, um das Ergebnis zu erreichen, das sie sich erhoffen. Diese Kompetenzen werden sie auch in Zukunft im Fach NWA benötigen und weiterhin einüben. Einbettung in Stoffverteilungsplan Die beschriebene Stunde folgt direkt nach einer Klassenarbeit zum Thema Stoffeigenschaften. Diese Stunde ist die Einführung in das Thema Stoffgemische. Die SchülerInnen lernen die Definition von Stoffgemischen und das erste Trennverfahren kennen. In der nächsten Stunde werden die SchülerInnen Lernstationen zu weiteren 6 Trennverfahren durchlaufen und im Anschluss unterschiedliche Stoffgemische, wie die Emulsion, Rauch, Nebel usw. kennen lernen, um im Anschluss daran den Brennerführerschein zu machen, um das Eindampfen durchführen zu können. Didaktische Reduktion Stoffgemische werden unterteilt in heterogene und homogene Stoffgemische. Darüber hinaus handelt es sich bei Stoffgemischen in der Natur fast nie um komplette Reinstoffe. Die Kinder sollen jedoch nur wissen, dass es einen Unterschied zwischen Reinstoffen und Stoffgemischen gibt, um sie anfangs nicht zu überfordern. Das erste Trennverfahren steht exemplarisch für weitere, die sie noch kennen lernen werden. Das Thema ist insofern didaktisch reduziert, dass die Reaktion, welche die Inhaltsstoffe im Brausepulver eingehen, keine Rolle spielen, sondern, dass lediglich interessiert, dass es überhaupt unterschiedliche Bestandteile im Brausepulver gibt und die SchülerInnen so erkennen können, dass es sich um ein Gemenge handelt. 7 5 Methodische Überlegungen Einstieg: Als Einstieg schreibt die Lehrerin das Thema der Stunde an die Tafel: Reinstoffe und Stoffgemische. Daraufhin präsentiert sie, ohne eine weitere Erklärung, Müsli und Mehl in Bechergläsern. Die SchülerInnen werden sich daraufhin melden und anhand der Beispiele versuchen, die Begriffe zu klären. Sie erkennen Müsli als ein Gemisch. Dieser Einstieg veranschaulicht auf einfache Weise den Unterschied der beiden Stoffe. Als weiterer Einstieg wäre es möglich reines Wasser und Salzwasser probieren zu lassen, damit die SchülerInnen erkennen, dass ein weiterer Stoff im Wasser sein muss, aber da die Kinder daran gewöhnt werden sollen, nichts zu probieren im Fachraum, stellt dieser Versuch keine Alternative dar. Gelenkstelle: Lehrerin sagt, sie möchte nur Reinstoffe haben. Gibt eventuell Impulse. Daraufhin kommen die SchülerInnen nach vorne und lesen aus. Es ist zu erwarten, dass die Kinder schnell auf die Unterschiede zwischen dem Mehl und dem Müsli kommen. Aber an dieser Stelle ist es wichtig das Lehrer-Schüler-Gespräch nicht in eine andere Richtung gleiten zu lassen, sondern den Schülern durch möglichst wenig Worte Hilfen zu geben. Fixierung: Die Lehrerin verteilt daraufhin ein Arbeitsblatt mit einem Lückentext als Fixierung der Definition von Reinstoffen und Stoffgemischen. Von einem bloßen Anschreiben der Definition möchte ich hier absehen, da der Behaltenseffekt vermutlich größer ist, wenn die Schüler sich selbst Gedanken machen. Es ist gut wenn sie nun in Einzelarbeit für sich selbst noch einmal wiederholen, was in der Einführung in einem Unterrichtsgespräch im Plenum bereits angesprochen wurde. Anschließend folgt eine kurze Besprechung der Lösung. Die Fixierung mit dem Arbeitsblatt wähle ich so früh bereits nach dem Einstieg, damit allen Schülern und SchülerInnen die Definitionen bewusst sind. Aufgrund der großen Heterogenität der Klasse, ist es mir wichtig, dass alle die Begriffe so weit verinnerlicht haben, dass eine weitere Erarbeitung möglich ist. Erarbeitung: Die Lehrerin präsentiert einen neuen unbekannten Stoff, indem sie eine Beschreibung des Stoffes vorstellt. Die Aufgabe der SchülerInnen ist es, zu erraten, um welchen Stoff es sich 8 handelt. Die Kinder sollen strecken, wenn sie meinen, ihn erraten zu haben. Sie werden aber darauf hingewiesen, es nicht herauszurufen, sondern abzuwarten, bis die Beschreibung zu Ende gelesen ist. Daraufhin stellt die Lehrerin die Frage in den Raum, ob das Brausepulver ein Reinstoff oder ein Stoffgemisch ist und verteilt nach dem Sammeln von Vermutungen ein weiteres Arbeitsblatt. Die SchülerInnen können die Antwort herausfinden, wenn sie die Versuche durchführen. Die SchülerInnen bekommen auf dem Arbeitsblatt die Anweisung das Brausepulver mit der Lupe zu untersuchen und in seine Bestandteile zu trennen und mit Wasser zu vermischen. Die SchülerInnen erkennen hier, dass es einer genauen naturwissenschaftlichen Untersuchung bedarf, um herauszufinden, ob es sich um einen Reinstoff handelt. Die Kinder bearbeiten das Arbeitsblatt in Partnerarbeit und können sich so gegenseitig unterstützen. Gruppenarbeit eignet sich für das filigrane Auslesen nicht. Es könnte an dieser Stelle zu Schwierigkeiten kommen, wenn die SchülerInnen die unterschiedlichen Bestandteile nicht erkennen können oder ihnen die feinmotorischen Fähigkeiten fehlen. Beim Eintreten dieser Probleme können sich die Kinder die Inhaltsstoffe auf einem Foto anschauen, um anschließend ein Bild davon zu haben, inwiefern die Inhaltsstoffe unterschiedlich aussehen. Mit dieser Hilfe müssten sie es schaffen, die Bestandteile zu trennen. Ihnen müsste es zumindest möglich sein, zwei davon zu erkennen. Wenn sie das Pulver mit Wasser mischen ohne umzurühren, sehen sie die Unterschiede in der Löslichkeit der Bestandteile. Bei dieser Erarbeitung des Themas erkennen die Schüler, dass Stoffgemische nicht nur allein mit dem Auge wahrgenommen werden können. Sondern, dass Stoffe genau untersucht und durch naturwissenschaftliche Versuche getestet werden muss, ob es sich um ein Gemisch oder einen Reinstoff handelt. Ich habe davon abgesehen arbeitsteilige Gruppen mit Präsentationen zu machen, da es sich um die Einführungsstunde zu Stoffgemischen handelt und die Schüler zuerst erkennen sollen, dass es überhaupt Gemische gibt. Lernzielkontrolle: Nachdem die SchülerInnen ihre Beobachtungen notiert haben, kommen sie an das Lehrerpult, um die Inhaltsstoffe auf der Verpackung des Brausepulvers zu lesen. Zusätzlich können sie ein vergrößertes Bild der Brause mit Beschriftung sehen, um die unterschiedlichen Bestandteile noch einmal ganz deutlich sichtbar zu machen. Die SchülerInnen übertragen die Inhaltsstoffe ebenfalls auf ihr Arbeitsblatt. Diese Phase ist außerordentlich wichtig, um sicherzustellen, dass alle SchülerInnen dasselbe Ergebnis haben. Da die Beobachtungen durchaus unterschiedlich sein können, sollte das Ergebnis am 9 Ende gleich sein. Die Selbstkontrolle ermöglicht es den Kindern unterschiedlich schnell zu arbeiten und ermöglicht so eine gewisse Differenzierung. Die schnellen Schüler können bereits mit der Hausaufgabe beginnen. Puffer oder Hausaufgabe: Die Kinder erhalten ein Übungsblatt und müssen darauf unterschiedliche Stoffe als Reinstoffe oder Stoffgemische deklarieren. Diese Aufgabe ist sowohl eine Übung, als auch ein Kontrolle des Verständnisses. Außerdem wird die bisher exemplarische Vorgehensweise nun auf andere Stoffe übertragen und ist so die Grundlage für die kommenden Stunden. 10 6 Verlaufsplan Zeit Phase Einstieg 7.45 – 7.50 Gelenkstelle 7.50 – 7.53 Lehrer – Schüler – Interaktion Geplantes Lehrerverhalten Erwartetes Schülerverhalten L. schreibt die Begriffe S. äußern erste Ideen zum „Reinstoff und Zusammenhang der Begriffe Stoffgemisch an die und der Stoffe. Tafel und präsentiert Müsli und Mehl. L. sagt sie möchte nur S. kommen nach vorne und lesen Reinstoffe haben. aus. Fixierung 7.53 – 8.00 L. verteil Arbeitsblatt. S. bearbeiten die Arbeitsblätter. Erarbeitung 8.00 – 8.15 L. liest Beschreibung von Brausepulver und verteilt Arbeitsblatt „Brausepulver. S. bearbeiten Aufgaben: Trennen das Pulver und mischen es mit Wasser. Schreiben Beobachtungen auf. S. lesen am Pult die Inhaltsstoffe und vergleichen das Bild mit ihren eigenen Beobachtungen. S. ordnen Stoffe zu den Kategorien Reinstoff und Stoffgemisch zu. Lernziel -kontrolle 8.15 – 8.20 Puffer/Haus aufgabe 8.20 – 8.25 L. verteilt Übungsblatt. Lernziele Medien S. erkennen den Tafel, Müsli, Mehl, sichtbaren Unterschied Bechergläser vom Gemisch Müsli und dem Mehl. S. erkennen das Trennverfahren „Auslesen als Methode um Reinstoffe zu erhalten. S. wiederholen und fixieren die Definition von Stoffgemischen und Reinstoffen. Tafel, Müsli, Bechergläser S. erkennen, dass das Brausepulver ein Stoffgemisch ist. Arbeitsblätter, Brause, Petrischalen, Bechergläser, Zahnstocher, Lupe S. lernen die Inhaltsstoffe vom Brausepulver kennen. Blatt zur Lernzielkontrolle S. üben die Zuordnung von Reinstoffen und Stoffgemischen. Übungsblatt Arbeitsblätter „Stoffgemisch und Reinstoff 11 7 Literaturangaben ESCHENHAGEN, D.; KATTMANN, U.; RODI, D. 2003). Fachdidaktik Biologie. Köln: Aulis Verlag Deubner. GRAF, ERWIN (Hrsg.) (2004). Biologiedidaktik für Studium und Unterrichtspraxis. Donauwörth: Auer. PRISMA NWA 1 (2004) Baden Württemberg. Schüler- und Lehrerband. Stuttgart: Klett. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg: Bildungsplan Realschule, Ditzingen: Philipp Reclam Jun. GmbH, 2004. Internetquellen vom 11.1.08: www.wdr.de/themen/panorama/9/80_jahre_brause.jhtml www.old.uni-bayreuth.de/departments/didaktikchemie/experimente.de Reinstoffe und Stoffgemische Aufgabe: Fülle den Lückentext aus, indem du folgende Wörter an der richtigen Stelle einsetzt: Haferflocken einheitlich Reinstoffen Rosinen Stoffgemische Auslesen Nüssen Reinstoffe sind aufgebaut. „Stoffgemische bestehen aus unterschiedlichen_.können durch verschiedene Trennverfahren in Reinstoffe getrennt werden. Müsli besteht zum Beispiel aus_, und und es kann durch getrennt werden. Was ist ein Reinstoff, was ein Stoffgemisch? Aufgabe: Verbinde die Stoffe durch Linien mit den Begriffen „Reinstoff oder „Stoffgemisch. Brausepulver Kochsalz Müsli Eisenfeilspäne Wasser Salzwasser Zucker Viel Spaß!!! Wir untersuchen Brausepulver Material: • • • • Brausepulver Zahnstocher Lupe Petrischalen Durchführung: 1. Schütte die Hälfte des Brausepulvers in die Petrischale und betrachte es mit der Lupe. 2. Versuche verschiedene Bestandteile zu erkennen. Lese sie mit Hilfe des Zahnstochers aus. 3. Gib nun zwei Finger hoch Wasser in ein Becherglas und gib die verbliebene Hälfte Brausepulver im Tütchen hinein. Warte kurz und schwenke das Becherglas leicht, so dass du den Boden erkennen kannst. Beobachtung: Bestandteile des Brausepulvers: Nachdem ihr eure Beobachtungen beschrieben habt, könnt ihr ans Pult gehen und auf der Verpackung lesen, welche Bestandteile im Brausepulver sind. Die drei wichtigsten Stoffe sind: und Inhaltsstoffe: Natriumhydrogencarbonat (kleine weiße Kristalle) Weinsäure (kleine unregelmäßige Teilchen) Zucker (große farblose Kristalle)