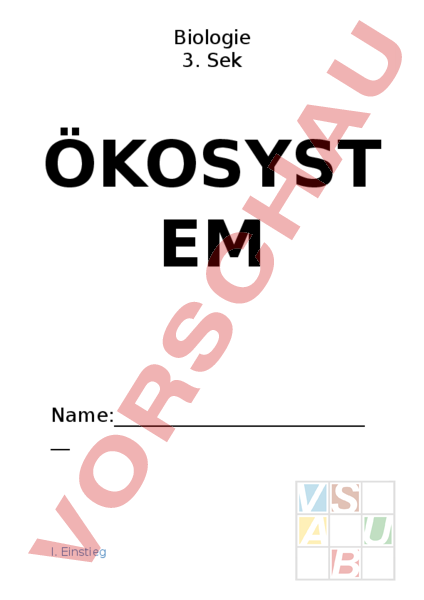Arbeitsblatt: BIO Ökosystem
Material-Details
Hier wird das Ökosystem Wald näher betrachtet
Biologie
Oekologie
8. Schuljahr
14 Seiten
Statistik
150540
1379
45
27.08.2015
Autor/in
Anthea Hartmann
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Biologie 3. Sek ÖKOSYST EM WALD Name: I. Einstieg Überlege: Welche Ökosysteme gibt es? Definitionen: Ökologie: ökologisch Ökosystem: Es gibt drei wesentliche Eigenschaften, mit denen sich Ökosysteme beschreiben lassen: 1. Ökosysteme sind offen Ökosysteme gehen nahtlos in andere Ökosysteme über. Lebewesen können zwischen den Ökosystemen wechseln und interagieren. Es besteht ein Energiefluss zwischen den Ökosystemen. 2. Ökosysteme sind dynamisch Ökosysteme können sich durch Einflüsse von Innen und Außen verändern. 3. Ökosysteme sind komplex 2 Biotische und abiotische Faktoren stehen in permanenter Wechselwirkung zueinander und sorgen für ein komplexes Geflecht zwischen Lebewesen und Umwelt. Lies im Buch „Erlebnis Biologie 2 die Seite 73. 3 II. Nicht alle Lebensräume sind gleich Biotop – Biozönose Ökosystem 4 Natürliche Ökosysteme:_ Künstliche Ökosysteme:_ Abiotische Faktoren: Biotische Faktoren: 5 III. Ökosystem Wald Lies im Buch S. 74 75 und beantworte anschliessend folgende Fragen: 1. Nenne vier verschiedene Waldtypen: 2. Mit welchen Bedingungen müssen die Bäume im Hochgebirge zurecht-kommen? 3. Welche Umweltfaktoren bestimmen das Vorkommen der einzelnen Baumarten? A. Die Stockwerke Waldes Anhand der maximalen Wuchshöhe von Pflanzen im Ökosystem Wald ergeben sich voneinander abgrenzbare Schichten. In diesem Zusammenhang wird in Analogie zu einem Haus, oft zwischen fünf verschiedenen Stockwerken unterschieden: Keller, Erdgeschoss, 1. Etage, 2. Etage und Dachgeschoss. 6 Die Stockwerke des Waldes sind im Folgenden logisch von oben nach unten geordnet. Lies die folgenden Texte zu den Stockwerken des Waldes. Fülle anschliessend die leeren Kästchen mit dem richtigen Begriff aus. Dachgeschoss: Baumschicht Die nach oben schliessende Baumschicht wird je nach Waldtyp von Laubäumen, Nadelbäumen oder beiden (Mischwald) gebildet. In der Regel schliesst das Blätterdach diese Schicht ab und verhindert, das grosse Mengen Licht den Waldboden erreichen. In den Höhen der Baumschicht sind nur noch Vögel, kletternde Tiere, Insekten und Kletterpflanzen anzutreffen. Höhe: 6 bis 30m vorkommende Pflanzen: Bäume (Eichen, Buchen, Fichten, Lärchen etc.) Tiere: Eichhörnchen, Eule, Fledermaus und Specht 7 2. Etage: Strauchschicht Die Strauchschicht besteht aus unterschiedlich hohen Sträuchern, Büschen aber auch jungen Bäumen. Normalerweise werden die Sträucher nur selten grösser als sechs Meter. In dieser Schicht befinden sich oft die Nester von brütenden Vögeln. Höhe: 2 bis 6m vorkommende Pflanzen: Büsche, Sträucher, junge Bäume Tiere: Amsel, Drossel, Hirsch und Schmetterling 1. Etage: Krautschicht Der Übergang zwischen Kraut- und Strauchschicht ist relativ fliessend und nur bei genauem Hinsehen zu erkennen. Meist können hier nur Pflanzen existieren, die entweder Frühblüher (Blüte im Frühjahr, noch ehe die Bäume ihr vollständiges Blätterdach ausbilden) oder Halbschatten-/Schattenpflanzen sind. Höhe: 0 bis 1m vorkommende Pflanzen: Gräser, Kräuter, kleine Pflanzen, Blumen, Farne Tiere: Fuchs, Hase, Reh und Wildschwein Erdgeschoss: Moosschicht Die Moosschicht beschreibt im Grunde nach nur jene Vegetation, die sich unmittelbar auf dem bewachsenen Boden befindet und auch kein sonderliches Höhenwachstum aufweist. Dazu gehören nur Moose, Flechten und kleine Pilze. In dieser Schicht, inklusive der angrenzenden Humusschicht im Boden, sind die meisten Insektenarten anzutreffen. Höhe: 0 bis 0,2m vorkommende Pflanzen: Flechten, Moose und Pilze Tiere: Ameise, Käfer, Spinne und Schlange Keller: Wurzelschicht Zur Wurzelschicht gehören sämtliche unterirdische Bereiche. Je nach Region kann die Wurzelschicht auch durchaus über 25 Meter betragen. Der Boden selbst besteht aus einer fruchtbaren Humusschicht. Höhe: -5 bis 0m 8 vorkommende Pflanzen: nur Wurzelwerk und Knollen Tiere: z.B. Feldhamster, Maus, Maulwurf und Regenwurm Zur Vertiefung: Lies im Buch S. 78 9 B. Tiere des Waldes Übung: Schneide die Tiere auf dem Zusatzblatt aus und ordne sie dem Stockwerk zu, welches sie bevorzugen, klebe sie ein. 10 C. Nahrungskette Nahrungsketten stellen den direkten und indirekten Zusammenhang der Nahrungsbeziehungen in einem Ökosystem dar. Dabei werden die einzelnen Organismen hinsichtlich ihrer Ebene im Stoffkreislauf in die drei Gruppen Produzenten, Konsumenten und Destruenten eingeteilt. Innerhalb dieser muss noch genauer differenziert werden, etwa zwischen Konsumenten I., II. und III. Ordnung. Beispiel Meer: Schadstoffanreicherung in der Nahrungskette: 11 D. Nahrungsnetze Nahrungsnetze stellen umfassend die Zusammenhänge der Nahrungsbeziehungen zwischen den Organismen in einem Ökosystem dar. Im Vergleich zu Nahrungsketten haben sie den Vorteil, dass Nahrungsbeziehungen mehrdimensional dargestellt werden. Damit repräsentieren sie in einem hohen Masse die tatsächliche ökologische Realität. Das folgende Beispiel zeigt ein Nahrungsnetz, das aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Nahrungsnetze haben im Gegensatz zu Nahrungsketten weder einen Anfangs-, noch Schlusspunkt. Die Ordnung von Produzenten, Konsumenten und Destruenten (siehe Stoffkreislauf) gilt aber selbstverständlich analog, nur liegt der Schwerpunkt in einem Nahrungsnetz auf der Darstellung eines möglichst umfassenden Verbindungsnetzwerks der Organismen. Jeder Pfeil steht stellvertretend für eine direkte Nahrungsbeziehung. Beispiel: zu den Spinnen führen die Pfeile von Ameisen, Wildschweinen, Vögeln und Igeln. Demnach werden sie von ihnen gefressen. Von den Spinnen weg führt ein Pfeil zu den Insekten, was bedeutet, dass sich Spinnen von Insekten ernähren. 12 Die Vorteile eines Nahrungsnetzes sind nahe liegend: Nahrungsnetze sind leicht verständlich, schnell erstellt und erlauben einen guten Überblick über die Nahrungsbeziehungen in einem Ökosystem. E. Stoffkreisläufe im Wald Der Stoffkreislauf beschreibt in Ökosystemen den sich wiederholenden Vorgang der zyklischen Umwandlung von organischen und anorganischen Stoffen. Zu den bekanntesten Kreisläufen zählen Kohlenstoff-, Stickstoffund Phosphorzyklus. Ursächlich für diese Stoffkreisläufe ist das Zusammenwirken der einzelnen Organismen im jeweiligen Ökosystem. Insgesamt lassen sich mit Produzenten, Konsumenten und Destruenten drei am Stoffkreislauf beteiligte Organismenarten unterscheiden. Lies im Buch S. 100 und betrachte die Bilder. Versuche anschliessend mit Hilfe des neuen Wissens den untenstehenden Lückentext auszufüllen. Produzenten (Erzeuger): 13 Die Produzenten Ökosystem. bilden die Ihre enorme stellt Nahrungsgrundlagefür für jedes Produktion die an massgebliche dar, und ist zugleich auch Beginn bzw. die kleinste Einheit jeder Nahrungskette. Zu den Produzenten zählen , in in terrestrischen aquatischen Ökosystemen Ökosystemen . Wesentliches Merkmal beider ist die Fähigkeit zur Selbsternährung (Autotrophie). Allein und anorganische Nährsalze genügen den Produzenten für ihr Wachstum, ganz ohne dabei auf weitere Nahrung angewiesen zu sein. Konsumenten (Verbraucher): Konsumenten sind im Vergleich zu Produzenten nicht in der Lage, zum Wachstum und zur Selbsterhaltung Nährsalzen zu nur aus generieren. Sonnenenergie Als und sogenannten Heterotrophen müssen sie sich durch Nahrungsaufnahme von anderen ernähren. Insgesamt lassen sich die Konsumenten in drei Grossgruppen einteilen: 1.konsumenten: Ernähren sich von Pflanzen Pflanzenfresser (z.B. Raupe) 2.konsumenten: Ernähren sich von anderen Konsumenten Fleischfresser (z.B. Vogel) 14 3. konsumenten: Ernähren sich von anderen Fleischfressern höhere Fleischfresser (z.B. Fuchs) Destruenten (Zersetzer): Produzenten entziehen durch ihr Wachstum der Umgebung laufend. Damit es aber auf Dauer nicht zu einem Nährstoffmangel kommt, müssen die von den Produzenten und Konsumenten aufgenommenen anorganischen Nährstoffe wieder zurück in ihren verwertbaren . Diese Aufgabe kommt den Destruenten zu: Sie wandeln organisches Material inNährsalze um, wodurch die Nährstoffe wieder für verfügbar/verwertbar werden. Diese Remineralisierung ist ein für das Ökosystem positiver Nebeneffekt: Denn in erster Linie sind die zur Gruppe der Destruenten gehörenden und auch selbst heterotrophe Konsumenten, weil sie sich von totem organischem Material (Blätter, Kadaver, Ausscheidungen) ernähren. Basis Produzenten Pilze Biomasse Bakterien Konsumenten Pflanzen totes Plankton Nährstoffe Ausgangszustand Sonnenlicht Energie Organismen anorganisches 15 F. Unterschiedliche Stoffkreisläufe 16 Fremdstoffe: Bemühungen des Menschen Fremdstoffe wieder zurückzuführen: G. Leistungen des Waldes Lies im Buch die S. 102 aufmerksam durch und beantworte anschliessend die Fragen. 1. Welche Leistungen bietet der Wald? Antworte in Stichworten. 17 2. Erläutere mit Hilfe der Abbildung 2 die Funktion der Wälder im Wasserhaushalt. 3. Notiere, was in eurem Haushalt alles aus Holz ist. 18 19