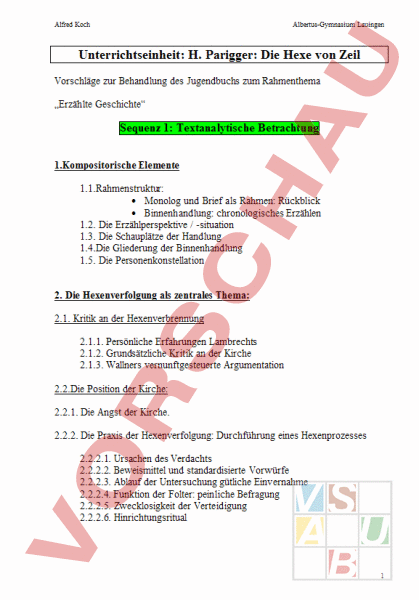Arbeitsblatt: Parigger: Die Hexe von Zeil
Material-Details
Unterrichtseinheit zum Thema Hexenverfolgung
Deutsch
Leseförderung / Literatur
7. Schuljahr
27 Seiten
Statistik
15455
2863
60
07.02.2008
Autor/in
Don Alfredo (Spitzname)
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Unterrichtseinheit: H. Parigger: Die Hexe von Zeil Vorschläge zur Behandlung des Jugendbuchs zum Rahmenthema „Erzählte Geschichte Sequenz 1: Textanalytische Betrachtung 1.Kompositorische Elemente 1.1.Rahmenstruktur: • Monolog und Brief als Rahmen: Rückblick • Binnenhandlung: chronologisches Erzählen 1.2. Die Erzählperspektive -situation 1.3. Die Schauplätze der Handlung 1.4.Die Gliederung der Binnenhandlung 1.5. Die Personenkonstellation 2. Die Hexenverfolgung als zentrales Thema: 2.1. Kritik an der Hexenverbrennung 2.1.1. Persönliche Erfahrungen Lambrechts 2.1.2. Grundsätzliche Kritik an der Kirche 2.1.3. Wallners vernunftgesteuerte Argumentation 2.2.Die Position der Kirche: 2.2.1. Die Angst der Kirche. 2.2.2. Die Praxis der Hexenverfolgung: Durchführung eines Hexenprozesses 2.2.2.1. Ursachen des Verdachts 2.2.2.2. Beweismittel und standardisierte Vorwürfe 2.2.2.3. Ablauf der Untersuchung gütliche Einvernahme 2.2.2.4. Funktion der Folter: peinliche Befragung 2.2.2.5. Zwecklosigkeit der Verteidigung 2.2.2.6. Hinrichtungsritual 1 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen 2.3. Ursulas Verhalten gegenüber der Kirche und im eigenen Prozeß 2.3.1. Protest und Hoffnung auf Befreiung des Vaters 2.3.2. Widerstand im Wort 2.3.3. Hilflosigkeit und Träume 2.3.4. Beziehung zu Anna (s.u.) 2.3.5. Widerstand und Ertragen der Folter 2.3.6. Das Sich-Fügen in sein Schicksal und Annahme der Hexenrolle (Traum) 2.4. Freunde und Helfer:Machtlosigkeit vs. Durchsetzungsvermögen 2.3.1. Protest des Vaters (Vgl. 2.1.) 2.3.2 Aufbegehren und Protest: Der Schreiber • Der Entschluss zur Hilfe und zur Flucht 2.3.2. Freund des Vaters: Wallner 2.3.3. Die Schwester: Barbara 2.3.4. Anna, die Mitgefangene Daraus ergeben sich folgende Stundenthemen, die sich auch zeitlich über zwei Unterrichtsstunden erstrecken können. 2 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Stundenthema: 1. Aufbau und Inhalt der Handlung (1-2 Stunden) Unterrichtsinhalte 1.Kompositorische Elemente 1.1.Rahmenstruktur: • Monolog und Brief als Rahmen: Rückblick • Binnenhandlung: chronologisches Erzählen 1.2. Die Erzählperspektive -situation 1.3. Die Schauplätze der Handlung 1.4.Die Gliederung der Binnenhandlung 1.5. Die Personenkonstellation Lernziele: Die Schüler sollen den Inhalt des Buches zusammenfassen und die Handlung strukturieren können. 3 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Unterrichtsverlauf: Fragen zum Text Über welchen Zeitraum erstreckt sich die eigentliche Handlung? Wichtige Textstellen Rahmen; S.9, 246-247; Betrachte im Vergleich dazu den Beginn bzw. den Schluß des Buches. Wer erzählt zu Beginn dto und am Ende? Wo werden in der Binnenhandlung Rückblicke gemacht? Versuche die Binnenhandlung in einzelne Abschnitte zu gliedern. Ordne Deiner Gliederung einzelne Zeitabschnitte und Schauplätze zu. Versuche an ausgewählten Abschnitten den jeweiligen Erzähler bzw. die Sichtweise zu bestimmen Ergebnisse Die Briefeschreiberin erinnert sich 1667 an die Zeit von 1627 bis 1631dem Höhepunkt und dem Ende der Hexenverbrennungen zurück Die Binnenhandlung erstreckt sich von 1628 über einige Wochen Informationen des Erzählers: Die Schreiberin ist reduziert auf Gespräch zwischen Lambrecht und Wallner Lambrecht im Malefizhaus Ursula Lambrechts Versuche, etwas über ihren Vater zu erfahren Ursulas Verhaftung Ursula als Hexe angeklagt Flucht aus dem Gefängnis Im Hause des Bürgermeisters Kloster der Dominikanerinnen Malefizhaus zu Zeil Vgl. TA 1: 4 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Stundenthema: 2. Kritik an der Praxis der Hexenverfolgung (Kirche) (1 Stunde) Unterrichtsinhalte 2.1. Der Grund des Besuchs von Wallner: erste Verdachtsmomente 2.2.Die Kritik an der Kirche: Das Gespräch zwischen Lambrecht und Wallner 2.2.1. Persönliche Erfahrungen Lamprechts 2.2.2. Grundsätzliche Kritik an der Kirche 2.2.3. Wallners vernunftgesteuerte Argumentation Lernziel: Die Schüler sollen die Positionen Lambrechts und Wallners gegenüberstellen und bewerten. Unterrichtsverlauf Fragen zum Text und Arbeitsauftäge In welcher Absicht kommt Wallner zu Lamprecht? Welche Position hat Lamprechtß Wie reagiert Wallner auf die Vorwürfe Lamprechts Textstellen Ergebnisse 5 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Tafelbild Folie Grund von Wallners Besuch bei Bürgermeister Lambrecht Warnung vor Maßnahmen der Kirche aufgrund vertraulicher Informationen aus dem bischöflichen Hof [übermittelt durch Hausmagd] [Hofmusiker des Bischofs] hört Gespräch zwischen Bischof und Malefizkommisären Bestätigung seines Unbehagens durch Brief des Bischofs an Lambrecht: • Verdacht der Zauberei • Gesetzesübertretung • Schädigung von Mensch und Tier 6 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Stundenthema: 3 4. Die Rolle der Kirche bei der Hexenverfolgung (3 Stunden) Unterrichtsinhalte 3.1. Die Angst der Kirche Gespräch zwischen Bischof und Weihbischof (Kapitel 5) 3.2.Die Praxis der Hexenverfolgung: 3.2.1. Verdachtsmomente und Ursachen des Verdachts 3.2.2. Beweismittel und standardisierte Vorwürfe 3.2.3. Ablauf der Untersuchung 3.2.4. Funktion der Folter 3.2.5. Zwecklosigkeit der Verteidigung 3.2.6. Hinrichtungsritual Lernziele: • Die Schüler sollen Begründung, Mechanismen und Methoden der Hexenverfolgung kennenlernen. 7 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Unterrichtsverlauf: 1. Die Ängste der Kirche (Gespräch zwischen Bischof und Weihbischof) Fragestellung Textstelle Wie werden die kirchli- S. 67 -69 chen Repräsentanten dargestellt? Ergebnisse Welche Mißstände pranger der Weihbischof an? Welche Konsequenz zieht er aus seiner Bestandsaufnahme? Welche Position vertritt der Bischof? Inwiefern besteht ein Gegensatz zwischen dem Inhalt des Gesprächs und der Gesprächssituation? 8 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen 2. Die Praxis der Hexenverfolgung 2.1. (2 Stunden) Erarbeitung der Entstehung von Verdachtsmomenten am Beispiel von Lambrechts Schicksal Fragestellung: • Weshalb wird Lambrecht eigentlich der Hexerei angeklagt? • Wie versucht die Kirche die Rechtmäßigkeit ihrer Anklage bzw. ihres Verdachts zu untermauern? Unterrichtsinhalte: • Die Denunziation als Mittel der Erhebung des Verdachts und der Anklage • Die Untermauerung des Verdachts durch scheinbare Beweise Lernziele: • Die Schüler sollen die Absurdität kirchlicher Beweisaufnahme sowie die wahren Gründe der Verhaftung erkennen 9 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Unterrichtsverlauf: Fragestellung: Äußere Vermutungen, weshalb Lambrecht der Hexerei angeklagt wird Mit welchen Beweisen arbeiten die Malefizkommissäre? Textstelle: Ergebnisse: L.äußert zum einen seinen persönlichen Hass auf die Kirche, der nach der Hinrichtung seiner Frau erfolgte. Sein Zweifel an der Rechtmäßigkeit (Unfehlbarkeit) kirchlichen Urteils macht ihn bereits verdächtig. Mit der Anklage und Verhaftung möchte man sich eines Kritikers entledigen, der in den Augen der Kirche gefährlich werden könnte. Zum einen spielt in der Beweisaufnahme kirchlicher Aberglaube eine entscheidende Rolle; zum andern zieht man die Denunzion (erzwungen und freiwillig) bewußt mit ein 10 Alfred Koch 2.2. Albertus-Gymnasium Lauingen Ursulas Verfahren: Fragestellungen: • Welche Beweise werden als rechtmäßig zugelassen und inwiefern ist dieses Verfahren fragwürdig? • Welche verschiedenen Stufen des Verfahrens lassen sich unterscheiden? • Mit welchen psychologischen Tricks wird gearbeitet, um den Widerstand des Angeklagten zu brechen? Unterrichtsinhalte: • Der Ablauf eines Hexenprozesse Lernziel: • Die Schüler sollen den Ablauf eines Hexenprozesses kennenlernen und die Erzwingung des Schuldeingeständnisses nachvollziehen können. 11 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Unterrichtsverlauf: 2.2.1. Verhaftung und Verdachtsmomente 2.2.2. Beweiserhebung und Ablauf der Untersuchung (Der Prozess) Das erste Verhör: Einschüchterungen: • • • • • • Ungewisse Wartezeit nach der Verhaftung Gezielte Mißachtung bei der ersten Begegnung im Verhör (117) Scheinbar förmliche Feststellung der Personalien bei gleichzeitiger Demütigung mit Fragen über das Schicksal der Eltern (118) Verfängliche Fragen: Beantwortung belastet automatisch logischerweise den Verdächtigen (119 121) Fragetirade würde differenzierte Beantwortung erfordern, die aber aufgrund der Situation nicht möglich ist. Notwendige Schuldverstrickung (122) Vorwegnahme der Schuld wg. Unfehlbarkeit der Anklage(123) Beweiserhebung Gegenüberstellung mit Zeugen, die Verbindung mit dem Teufel bestätigen Problem: Folter bei Zeugin hat Mitgefühl für Angeklagte verlorengehen lassen (126) Neid auf Schönheit der Jugend Unsicherheiten und mgl. Einwände werden übergangen Androhung weiterer Folter erzeugt Angst bei Zeugen (127, 128) Untersuchung auf Hexenmale: Demütigung durch erzwungene Nacktheit Auffindung einer Hautreizung als Beweis für Hexenmal Die Hexenprobe: Schmerzzufügung, ohne dass Blut entsteht und ohne dass Schmerzempfinden sichtbar wird (131) Vorführung der Folterinstrumente (132 133) 12 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Das zweite Verhör: der Beginn der Folter 1.) Der Fingerstock: (149) Die Fragen bei der Folter enthalten bereits Anschuldigungen, denen es bei ständig größer werdendem Schmerz zu widerstehen gilt (150 ff) Scheinbare Schmerzunempfindlichkeit als Schuldbeweis 2.) Die Beinschrauben (152) 3.) Der Zug (153 ff) zusätzliche Demütigung durch Entfernung der Kleider Tränen sind keine Entlastung Das dritte Verhör (201) Veränderung der Gefangenen: kein trotziges Aufbegehren Angebliches Schuldbekenntnis des Vaters als Beleg für Hoffnungslosigkeit Freiwilliges Bekenntnis; Beantwortung aller Fragen im Sinne der Vernehmenden Trotz Geständnisses erneute Folter, da keine Missetaten angegeben werden (204) Nach der abgebrochenen Folter Bekennung standardisierter Schandtaten Fragen, die die Antwort bereits in den Mund legen (205) 13 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Stundenthema. Ursulas Widerstand gegen Kirche und Anklage im Wort (1 Stunde) Fragestellung: • Mit welchen Argumenten versucht Ursula sich gegen die Vorwürfe zur Wehr zu setzen? • Weshalb muss eine rationale Auseinandersetzung scheitern? Unterrichtsinhalte: • Ursulas Aufbegehren gegen die Verhaftung des Vaters • Ihre Willensstärke beim ersten Verhör Lernziele: • Die Schüler sollen die Sinnlosigkeit eines Diskurses erkennen 14 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Unterrichtsverlauf: 1. Ursulas Versuche, ihrem Vater zu helfen: Fragestellung Auf welche Weise versucht Ursula etwas über ihren Vater in Erfahrung zu bringen? Wie steht die Schwester zur Verhaftung des Vaters? Wie verläuft die Begegnung mit Dr. Einwag und mit welchen Argumenten versucht U. ihn von der Unschuld ihres Vaters zu überzeugen? Textstelle Ergebnisse 29,30 Der Versuch, beim bischöflichen Rat (Schwarzkonz) Gehör zu finden, scheitert; sie wird bereits an der Tüt barsch zurückgewiesen. 39-43 Der Besuch bei der Schwester Barbara im Kloster endet enttäuschend, da Ursula auch von ihr keine Hilfe erwarten kann: Barbara nimmt selbst die Verhaftung ihres Vaters teilnahmslos zur Kenntnis, da sie an der Unfehlbarkeit der Kirche nicht zweifelt und ein tiefes Gottvertrauen besitzt, das sogar menschliche Verfehlungen (Richter, Vertreter der Kirche) außer Kraft setzt. Indirekt glaubt sie damit an die Schuld ihres Vaters, wobei sich am Ende Zweifel an der Gerechtigkeit der Kirche andeuten. 46 ff Ursula tritt ihm zunächst selbstbewußt gegenüber, da sie die Hausherrin ist, wird aber ängstlich als sie hört, wer ihr gegenübersteht, da E. einen besonderen Ruf hat. Behauptung: Unschuld des Vaters Forderung Bitte: Freilassung Beweis: Bezeugung der häuslichen Anwesenheit kein Besuch eines Hexensabbats möglich 2. Argument: Zeugen könnten getäuscht worden sein Weshalb entschuldigt sich 50ff Ihre Aussage wird durch die Anführung von Zeugen außer Kraft gesetzt, deren Wahrheitsgehalt aufgrund bereits erwiesener Schuld des Vaters außer Frage steht. Außerdem handele es sich nicht nur um Zeugen, die ebenfalls dem Teufel verfallen seien. Nach der persönlichen Beleidigung 15 Alfred Koch U.für ihr trotziges und unbeherrschtes Verhalten? Albertus-Gymnasium Lauingen und dem Vorwurf der unrechtmäßigen Bereicherung überkommen sie Selbstzweifel an der Richtigkeit ihrer Behauptung, vielleicht auch Angst aufgrund der indirekten Drohung; außerdem merkt sie, dass sie mit ihrem Aufbegehren ihrem Vater nicht weiterhelfen kann. Fazit: Ursulas Bemühungen müssen zwangsläufig fehlschlagen, da für die Kirche die Schuld ihres Vaters bereits erwiesen ist. Ursula lebt immer noch in der Hoffnung, mit rationalen Argumenten zu überzeugen; wo kirchlicher Aberglaube aber stärker ist, lässt sich auch mit Vernunftgründen nichts ausrichten. Zusätzlich versteht es Dr. Einwag auch geschickt, die Antastbarkeit seiner irrationalen Behauptungen dadurch zu relativieren, als er die Aussage eines bürgerlichen Zeugen anführt. Somit sieht sich Ursula in ihrer Zeugenaussage einem zweifachen Widerspruch gegenüber: dem kirchlichen Glauben an die Macht und den Verführungs- sowie Täuschungskünsten des Satans und der angebliche Zeugenaussage. Hinzu kommt eine Beweiserhebung im Hause des Vaters, die die Absurdität kirchlichen Aberglaubens dokumentiert und der U. selbst nur vernünftige Argumente entgegenzusetzen hat, die logischerweise auf taube Ohren stoßen müssen. Tafelbild 16 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen 2. Wie argumentiert Ursula beim ersten Verhör? Inwiefern zeigt sich eine Fortsetzung des ersten Teils? Fragestellung Textstelle Arbeite den Gegensatz zwi- S.117 schen Ursulas beabsichtigter Aussage und ihrer tatsächlichen „Argumentation heraus. 121 Wie antwortet Ursula, als 122 -123 sie sich wieder besinnt? Inwiefern wird ihr Glaube 123-124 an Gott auf eine Probe gestellt? Wieso prangert Ursula er- 127 neut die Praxis des Verhörs an? Ergebnisse Beabsichtigt hatte sie, auf die Unrechtmäßigkeit der Verhaftung und des Verdachts hinzuweisen. Unterstützen wollte sie ihre Behauptung durch den Verweis auf eine fragwürdige Zeugenaussage, die aufgrund einer persönlichen Rache erfolgte. Aufgrund der geschickten Verhörstrategie kommt sie statt dessen auf das Schicksal ihrer Eltern zu sprechen, so dass sie in eine emotionale Argumentation verfällt, in der sie unterliegen muss. In einem zweiten Schritt fühlt sie sich als Frau angegriffen; durchschaut zwar die Falle, in die sie zu tappen droht, findet aber aufgrund der gestellten Fragen kein Gegenmittel. D.h. ihre Vorsätze kann sie nicht einhalten, da das Gespräch einen von ihr nicht erwarteten Verlauf nimmt. Versuche, die unlautere Verhörmethodik Einwags zu kritisieren bleiben unbeachtet. Die Vielzahl der Fragen, die bereits Schuld voraussetzen, sind nicht in einer gedanklich klaren Argumentation zu beantworten. Sie beschwört, dass die erhobenen Vorwürfe unwahr seien, stößt aber wieder auf den Aberglauben der kirchlichen Vertreter, die sich jeder vernünftigen Argumentation verschließen In ihrer Not wendet sie sich an Christus; sie kann nicht glauben, dass ihr Gott dieses Unrecht zuläßt, sieht aber auch, dass Gottes Sohn eben gleiches Schicksal widerfuhr; sie projiziert dies auf das Schicksal ihres Vaters Die Zeugenbefragung ist erkennbar gelenkt und die Verwertung der Aussage läßt für jeden erkennbar die Unsinnigkeit der Beschuldigungen erkennen. Die von ihr ausgesprochene Verbitterung zeigt zugleich ihre Hilflosigkeit. 17 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Fazit: Ursula muss merken, dass jeglicher Diskurs erfolglos bleiben muss, da nicht von gleichberechtigten Gesprächspartnern ausgegangen werden kann, da das Argumentationsziel jeweils unterschiedlich ist und beide Parteien von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen. 18 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Stundenthema: Ursulas Schuldannahme: Traum und Bekenntnis (1 Stunde) Fragestellung: • Weshalb bekennt sich Ursula zu den Vorwürfen, der Hexerei verfallen zu sein? Unterrichtsinhalte: • Der Traum als auslösendes Moment der Schuldannahme • Ursulas Bewertung und ihr Schuldeingeständnis; ihre Selbstzweifel Lernziele: • Die Schüler sollen erkennen, dass Ursula durch die Folter seelisch so gebrochen wurde, dass sie keinen inneren Willen mehr aufbringt, sich gegen die Vorwürfe zu wehren bzw. der Folter zu widerstehen. 19 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Unterrichtsverlauf: Fragestellung Textstelle Wie begründet Ursula ge- 176 genüber Anna, dass sie selbst glaubt, eine Hexe zu sein? Fasse ihre Traumerlebnisse 167ff zusammen. Wie wird die Frage nach 171 dem Sinn christlichen Glaubens diskutiert? Inwiefern steckt in dieser 171 /172 Argumentation auch Kritik an der kirchlicher Lehre? Worin besteht also die Macht des Satans Welche Auswirkungen hat 172 173 diese „Botschaft auf Ursula im Traumgeschehen? Inwiefern fühlt sich Ursula 173ff der Teufelsgesellschaft trotzdem nicht zugehörig? Weshalb ist der Hexensab- 175 bat eine Fortsetzung der Folter? Ergebnisse Ursula hat den Traum wie Realität erlebt und sah sich selbst als Beteiligte am Hexensabbat. Fortbewegung auf dem Rücken eines Tieres durch die Lüfte; Ankunft beim Hexensabbat Männliche Begleitung Teufel in Bocksgestalt auf einem Thron Teufelsverehrung im Rahmen einer Messe Ausgelassenes Treiben Der Begleiter spricht den Menschen eine Autonomie im Handeln zu, die einer überirdische Existenz (Gott) gegenübersteht, diese aber zugleich überflüssig und wertlos macht. Lediglich dem Teufel wird Verehrung entgegengebracht. Begründung: Frei von Zwängen und von der Sünde Gebote engen ein und Schuldbewußtsein verhindert freie Entfaltungsmöglichkeiten in Selbstbestimmung Der Mensch lebt im Glauben niemandem verpflichtet zu sein und so frei und ungezwungen leben zu können. Sie fühlt sich beschwingt, fröhlich und ungebunden Sie hat keine Missetaten begangen und bekennt sich dazu Ursula wird geschlagen, da sie nicht gestehen kann; sie ist sich auch im Traum keiner Schuld bewußt. 20 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Welche Deutungs- bzw. Erklärungsmöglichkeit läßt dieses Erlebnis zu? 1. Ursula ist durch die Folter körperlich so geschwächt, dass sie auch innerlich zunehmend weniger Widerstand entgegensetzen kann. Allerdings fehlt ihr ein Schuldeingeständnis. Sie selbst ist sich keiner Schuld bewußt, sie weiß dass sie keine Hexe ist. 2. Im Bewusstsein, nicht mehr widerstehen zu können, läuft sie Gefahr, die erhobenen Vorwürfe als richtig anzunehmen. Dies geschieht nach dem Traumerlebnis. 3. Im Traum verarbeitet sie einerseits den herrschenden Aberglauben, andererseits genießt sie eine bisher nicht gekannte Freiheit. Im Traum kann sie erstmals frei von allen Zwängen das Leben genießen. 4. Diese Freiheit stellt sich aber als trügerisch heraus, da sie wieder bestraft wird dieses Mal aber für ein Nicht –.Begehen von Missetaten. Es ist die Umkehrung ihrer realen Situation. 5. Durch das Traumerlebnis kann Ursula sich nun zu ihren angeblichen Schandtaten bekennen, ohne ihre Selbstachtung zu verlieren. Sie sieht ihre Strafe als gerecht an und findet damit inneren Frieden. Tafelbild: 21 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Stundenthema: Ursulas Mitgefangene Anna und der Freund des Vaters Fragestellungen: • • • • Welche Ratschläge erteilt Anna? Wie kommt sie selbst mit ihrer Rolle zurecht? Weshalb begibt sie sich nicht mit auf die Flucht? Welche Ratschläge erteilt Wallner Ursula und weshalb kann sie diesen nicht folgen? • Welche Hilfsmöglichkeiten bieten sich nach der Flucht? Unterrichtsinhalte: • Strategien des Widerstands gegen die Anklage • Fürsorge und Menschlichkeit Lernziel: • Die Schüler sollen erkennen, wie auch in Extremsituationen Menschen Selbstachtung und Würde bewahren und dadurch anderen helfen können. • Sie sollen Wallners Verhalten kritisch beurteilen. 22 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Unterrichtsverlauf: Fragestellung Textstelle Welche innere Haltung 105besitzt Anna? Welches Ziel verfolgt sie? Wie lautet der erste 107 Ratschlag? Welche Ratschläge gibt 112 sie U. für das Verhör? Wie reagiert Anna auf 177ff Us. Selbstzweifel nach dem Traum und nach Us. Geständnis im Verhör 207ff Weshalb flieht Anna 212 215 nicht auch aus dem Gefängnis? Ergebnisse Hass und Mitleidlosigkeit angesichts der Trostlosigkeit aber auch Hilflosigkeit aufgrund körperlicher Schwächung; Andererseits kalkulierte Krafteinsparung durch Zähmung der Wut mit dem Ziel Gerechtigkeit zu erlangen. Nicht verzweifeln! Abstreiten (leugnen) und Würde angesichts der Demütigungen bewahren, den Anklägern niemals glauben, stärker sein und zur Gerechtigkeit zwingen durch Widerstand Anna sucht eine rationale Erklärung für Us. Selbstzweifel und möchte sie dadurch von ihren Wahnvorstellungen befreien. Anna spielt eine Verhörsituation durch und möchte U. aufrütteln indem sie ihr vorhält, dass sie nicht nur sich selbst, sondern auch Unschuldige in den Strudel der Anklage hineinzieht. Ein Fluchtversuch endete mit einer persönlichen Enttäuschung; sie hat niemanden, der ihr Unterschlupf gewährt. Die Flucht bedeutet für sie auch ein Schuldeingeständnis, da sie aber von ihrer Unschuld überzeugt ist, muss sie, um Gerechtigkeit zu erfahren, bleiben und widerstehen. Sie führt ihren (aussichtlosen) Kampf weiter. Bereits nach der Ver- S.33ff Wallner sieht, dass auch auf politi23 Alfred Koch haftung des Vaters rät S. 83ff Wallner zur Flucht bzw. zum Schweigen. Weshalb findet er bei U. kein Gehör? Albertus-Gymnasium Lauingen schem Wege keine Rettungsmöglichkeit für L. besteht. U. glaubt noch an göttliche Gerechtigkeit und an ihre Kraft zum Widerstand. Sie erkenntn nicht die Gefahr, in der sie sich befindet. W. selbst sieht sich in Gefahr und geht behutsam mit dem „Fall L. um. Er selbst bezeichnet sich als Feigling, er erkennt aber die herrschende Angst als Grund für die Verschwiegenheit der Leute und schätzt die Situation pragmatisch ein. Er rät U. zu schweigen –trotz des empfundenen Unrechts, aber aus Selbstschutz 24 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Stundenthema: Ursulas Fluchthelfer: der Schreiber Fragestellung: • Welche Motive hat der Schreiber, Ursula zu helfen und sie zu befreien? Unterrichtsinhalte: • Die Rolle des Schreibers beim Prozess gegen Ursula • Seine Einstellung bzgl. der Hexenprozesse im Allgemeinen Lernziel: • Die Schüler sollen die Handlungsmotive des Schreibers erkennen und bewerten bzw. kritisch hinterfragen 25 Alfred Koch Albertus-Gymnasium Lauingen Unterrichtsverlauf: Fragestellung Textstelle Ergebnisse Us. Aussage und sein ProtokollWelche Haltung des 120 Schreibers kommt bei den auftrag stimmen nicht überein; er Verhören zu Ausdruck? sieht den Unterschied und widerspricht; Auf die Zurechtweisung reagiert er beschämt und er fügt sich den Anweisungen 121 Bereits Blicke genügen, um ihn einzuschüchtern. 131 Der Schreiber empfindet Ekel angesichts der Untersuchungsmethoden und protokolliert nur mit Widerwillen; 154 Er möchte eigenmächtig Notizen machen, die U. entlasten könnten, wird aber zurechtgewiesen Wie gibt sich der Schrei- 142ff ber U. als Verbündeter zu erkennen? Weshalb reift in Christoph 178 ff Steiner der Entschluss, U. zu retten? Mit welcher Einstellung hat er seinen Dienst angetreten und weshalb änderte sich seine Meinung gegenüber Einwag? Er schreibt U. einen Brief und bietet seine Hilfe an; gleichzeitig ist aber auch seine Furcht zu erkennen; U. und A. bleiben noch skeptisch bzgl. der Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit des Schreibers, jedoch nährt der Brief etwas Hoffnung. Er war stolz, für den geachteten, gebildeten und unbestechlichen Dr. Einwag arbeiten zu dürfen; es war für ihn eine Auszeichnung; Zweifel an der Gerechtigkeit kommen ihm aber bei den Verhören, die gegen die Menschlichjkeit und Gerechtigkeit verstoßen; Er empfindet Mitleid gegenüber den gefolterten Angeklagten, möchte allerdings nicht seine sichere Stellung aufgeben und v.a. durch unbedachte Äußerungen 26 Alfred Koch Ist Chs. Hilfe personenge- 180ff bunden oder rebelliert er grundsätzlich? Wie versucht Ch. argu- 180 183 mentativ etwas bei Einwag zu erreichen und weshalb scheitert er mit seinem Versuch? Albertus-Gymnasium Lauingen selbst in Verdacht geraten. Schlüsselerlebnis war die Befragung gegen eine schwangere Frau; danach wollte er seinen Dienst aufkündigen. Die Verhaftung Us. läßt in ihm den Entschluss reifen, sich tatkräftig ,also aktiv gegen das Unrecht zu wenden. Zum Teil wird die Antwort bereits oben gegeben. Er kritisiert grundsätzlich die Verhörpraktiken, kommt aber über einen stummen Protst nicht hinaus. Sein aktives Eintreten für die Angeklagte ist an die Person Us. gebunden Die Diskussion über Recht und Rechtsgrundsätze scheitert, da Einwag ein höheres Recht anführt, das seiner Meinung nach über dem vom Menschen verfassten Recht steht; Durch sein Barsches zorniges Auftreten schüchtert er den Schreiber ein, dessen Möglichkeiten ohnehin begrenzt sind; er wird nicht ernst genommen und seine Unwissenheit und Nichtigkeit wird ihm vorgehalten. Ch. erkennt dass eine argumentative Lösung ausscheidet. Wie verläuft die Rettung und die Flucht? 27