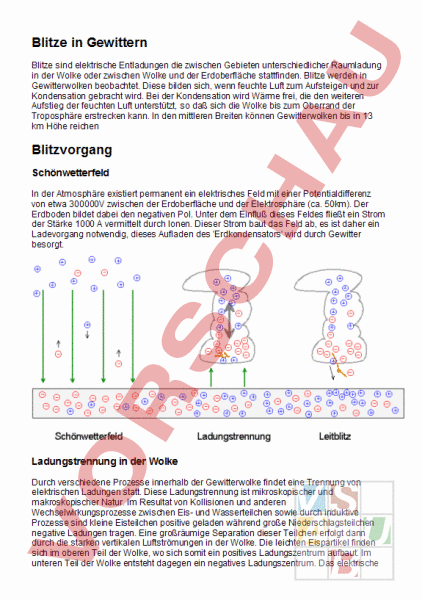Arbeitsblatt: Blitze
Material-Details
Entstehung von Blitzen erklärt. Kann als Grundlage verwendet werden, um diese Thema in der Schule zu behandeln.
Physik
Elektrizität / Magnetismus
4. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
15615
2430
20
11.02.2008
Autor/in
Stephanie Hafner
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Blitze in Gewittern Blitze sind elektrische Entladungen die zwischen Gebieten unterschiedlicher Raumladung in der Wolke oder zwischen Wolke und der Erdoberfläche stattfinden. Blitze werden in Gewitterwolken beobachtet. Diese bilden sich, wenn feuchte Luft zum Aufsteigen und zur Kondensation gebracht wird. Bei der Kondensation wird Wärme frei, die den weiteren Aufstieg der feuchten Luft unterstützt, so daß sich die Wolke bis zum Oberrand der Troposphäre erstrecken kann. In den mittleren Breiten können Gewitterwolken bis in 13 km Höhe reichen Blitzvorgang Schönwetterfeld In der Atmosphäre existiert permanent ein elektrisches Feld mit einer Potentialdifferenz von etwa 300000V zwischen der Erdoberfläche und der Elektrosphäre (ca. 50km). Der Erdboden bildet dabei den negativen Pol. Unter dem Einfluß dieses Feldes fließt ein Strom der Stärke 1000 vermittelt durch Ionen. Dieser Strom baut das Feld ab, es ist daher ein Ladevorgang notwendig, dieses Aufladen des Erdkondensators wird durch Gewitter besorgt. Ladungstrennung in der Wolke Durch verschiedene Prozesse innerhalb der Gewitterwolke findet eine Trennung von elektrischen Ladungen statt. Diese Ladungstrennung ist mikroskopischer und makroskopischer Natur. Im Resultat von Kollisionen und anderen Wechselwirkungsprozesse zwischen Eis- und Wasserteilchen sowie durch induktive Prozesse sind kleine Eisteilchen positive geladen während große Niederschlagsteilchen negative Ladungen tragen. Eine großräumige Separation dieser Teilchen erfolgt dann durch die starken vertikalen Luftströmungen in der Wolke. Die leichten Eispartikel finden sich im oberen Teil der Wolke, wo sich somit ein positives Ladungszentrum aufbaut. Im unteren Teil der Wolke entsteht dagegen ein negatives Ladungszentrum. Das elektrische Feld zwischen der Wolke und der Erdoberfläche ist dabei dem Schönwetterfeld entgegengerichtet und lokal wesentlich stärker. Leitblitz Wenn die Feldstärke einen kritischen Wert überschreitet beginnt sich aus der Wolke negative Ladungsträger in Form des sogenannten Leitblitzes (engl. Leader) gerichtet auf die Erdoberfläche zuzubewegen. Dieser Leitblitz bewegt sich in Sprüngen von einigen 10 Metern. Seine mittlere Geschwindigkeit beträgt etwa 1/20 der Lichtgeschwindigkeit. Er hinterläßt einen dünnen ionisierten Kanal, der kaum sichtbar ist und später vom Hauptblitz benutzt wird. Bei der Ausbildung des Leitblitzes entstehen auch die typischen Verästelungen. Hauptblitz Bei der Annäherung des Leitblitzes an die Erde erhöht sich die Konzentration positiver Ladungsträger im Erdboden nahe der Oberfläche. Wenn schließlich die lokale Feldstärke einen kritischen Wert überschreitet, kommt dem stepped leader vom Erdboden aus eine Fangentladung entgegen. Diese geht dabei meist von erhöhten Punkten wie Hausdächern oder Bäumen aus, da dort die maximalen Feldstärken erreicht werden. Wenn der Blitzkanal geschlossen ist, bewegt sich die Ladung entlang des durch den Leitblitz ionisierten Kanals. Durch den Stromfluß heizt sich der Kanal auf, dabei wird Luft ionisiert und somit die Leitfähigkeit erhöht, was wiederum den Strom verstärkt. Auf diese Weise bleibt der Stromfluß auf einen dünnen Kanal begrenzt in dessen Zentrum bis zu 30000 erreicht werden können. Der Strom kann über 100 kA betragen. Das erhitzte Plasma im Blitzkanal dehnt sich dann explosionsartig aus, es entsteht eine Schockwelle, an der intensive Schallwellen, der Donner, generiert werden. Durch adiabatische Abkühlung sinkt die Temperatur wieder, die ionisierten Gase rekombinieren sich, die Leitfähigkeit nimmt wieder ab. Ein Return-Stroke dauert meist nur einige Mikrosekunden an, es kann jedoch auch ein kontinuierlicher Strom für einige Millisekunden fließen. Abhängig ist dies vom Nachschub an freien Ladungsträgern und auch von der magnetohydrodynamischen Stabilität des Blitzkanals. Die transportierte Ladungsmenge liegt in der Regel bei einigen Coulomb, die elektrische Energie bei einigen GigaJoule. Die meisten Erdblitze bestehen aus mehreren return-strokes, die den Kanal des ersten Blitzes nutzen. Die Zeit zwischen den einzelnen Entladungen liegt bei 50-100 ms. Die Folge dieser Entladungen bilden das charakteristische Flackern des Blitzes. Wolkenauflösung Die meisten Blitze haben negative Ladung zur Erde transportiert, es verbleibt daher nach Wolkenauflösung eine größere Anzahl positiver Ladungsträger in der oberen Troposphäre. Durch die Blitzentladungen vom negativen Ladungszentrum im unteren Teil der Wolke wurde negative Ladung zur Erde transportiert. Blitzarten Blitzentladungen zwischen Wolke und Erde werden unterschieden nach der Polarität der zur Erde transportierten Ladung und Richtung des Leaders. negativer Wolke-Erde-Blitz positiver Wolke-Erde-Blitz negativer Erde-Wolke-Blitz positiver Erde-Wolke-Blitz Der größte Teil (etwa 90%) der Blitze zwischen Wolke und Erde werden in der Wolke initiiert, breiten sich und transportieren negative Ladung zur Erdoberfläche. Blitze, die von der Erde in Richtung Wolke verlaufen, gehen meist von hohen Bauwerken oder Berggipfeln aus. Die Feldstärke ist in der Umgebung dieser Spitzen besonders hoch, so daß ein Leitblitz nach oben ausgelöst werden kann. Vielfältige Entladungen finden innerhalb der Wolke statt und werden durch das Aufleuchten ganzer Wolkenbereiche sichtbar. Ein Teil dieser Entladungen kann in einen Erdblitz übergehen.