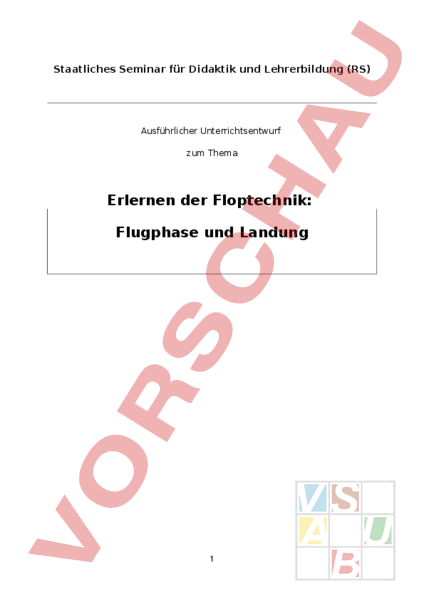Arbeitsblatt: Flop - Flugphase und Landung
Material-Details
Ausführlicher Unterrichtsentwurf
Bewegung / Sport
Anderes Thema
7. Schuljahr
25 Seiten
Statistik
159380
1012
9
04.04.2016
Autor/in
sabine Schuwerk
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (RS) Ausführlicher Unterrichtsentwurf zum Thema Erlernen der Floptechnik: Flugphase und Landung 1 Inhaltsverzeichnis 1.1Kennzeichen. 3 1.2Technik. 3 2.3 Vorsichtsmaßnahmen 5 3 Kompetenzerwerb und Lernziele7 4 Didaktische Reflexion und Entscheidungen.8 4.1 Legitimation des Themas auf Grundlage des Bildungsplans.8 4.2 Didaktische Analyse nach Klafki. 10 4.3 Bezug der Schülerinnen zum Thema und Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit zum Hochsprung. 12 5 Methodische Reflexion und Entscheidung.13 5.1 Begründung des Stundenverlaufs, der Materialien und Medien13 5.2 Begründung der gewählten Sozialform16 5.3 Planungsalternativen. 17 Literaturverzeichnis.18 Anhang19 1.1 Kennzeichen Kennzeichnend für den Hochsprung ist „dass sich der menschliche Körper durch einen Anlauf selbst beschleunigt und in einem anschließenden Flug über eine möglichst () große Höhe katapultiert.1 1 Güllich A. et al., SchülerLeichtathletik, PhilippkaSportverlag, 2008, S.90 2 In der geschichtlichen Entwicklung gibt es eine Vielzahl an Bewegungstechniken z.B. Frontalhocke, Schersprung, Wälzer, Flop usw Inzwischen hat sich der Flop flächendeckend durchgesetzt. In der Schule können andere Sprungtechniken gelegentlich zur koordinativen Sprungschulung eingesetzt werden. 1.2 Technik Die Hochsprungbewegung lässt sich in folgende Bereiche gliedern: Anlauf, Absprung, Flug und Landung. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Bereiche erläutert. Anlaufphase Die Bewegungsmerkmale des Hochsprunganlaufs sind ähnlich wie die des Sprints. Im Unterschied zum Sprint läuft der Hochspringer aber aufrecht mit weniger Vorlage 2. Beim Anlauf ist das Ziel eine optimale Geschwindigkeit zu erreichen. Grundvoraussetzung ist ein rhythmischer Anlauf auf den Fußballen und „sich in die Kurve legen können3. Der Absprung wird vorbereitet, indem der vorletzte Schritt verlängert wird und der Körper eine leichte Rücklage einnimmt. Hinsichtlich der Anlauflänge gibt es in der Literatur unterschiedliche Meinungen. Wastl und Wollny sprechen von 7 – 11 Schritten, anlauf. Beginnend mit 3 – 5 geradlinigen Schritten und dem anschließenden Übergang in den Kurvenverlauf4. Während Güllich et al. je nach Können von 2, 4, oder 6 geradlinigen Anlaufschritten sprechen 5. Killing ist der 2 vgl. Killing W.: Gekonnt nach oben, 1995, Philippka, S.28 3 Wastl P., Wollny R.: Leichtathletik in Schule und Verein, 2012, Hofmann Verlag, S.114 4 vgl. Wastl P., Wollny R.: Leichtathletik in Schule und Verein, 2012, Hofmann Verlag, S.114 5 vgl. Güllich A. et al., SchülerLeichtathletik, PhilippkaSportverlag, 2008, S.100 3 Meinung, dass in der Schülerleichtathletik ein längerer Anlauf als 8 Schritte zu Fehlern wie Vertippeln, Rhythmuswechsel und falschem Bogen führt6. Absprungphase Die Grundlage des Absprungs bilden die Sprungauslage und ein korrekter Fußaufsatz. Der Absprung erfolgt mit dem lattenfernen Bein. Der Fuß zeigt dabei in Richtung Hochsprunglatte und erfolgt im ersten Drittel der Hochsprungmatte. Das zuvor gebeugte Sprungbein wird im Kniegelenk gestreckt und das Schwungbein wird bis zur Waagerechten geführt. Die Armführung kann laut Wastl und Wollny in der Führerarmtechnik oder der Doppelarmtechnik erfolgen 7, wobei Kiling der Meinung ist, dass den Schülerinnen die Kraft für die Doppelarmtechnik fehle8. Flugphase Die Flugphase lässt sich in vier weitere Bewegungsphasen gliedern. Das Steigen, die Drehung um die Körperachse, das Kippen in die Waagerechte und das Einnehmen der Bogenspannung. Um die Flugphase erfolgreich bewältigen zu können gilt als wichtige Voraussetzung eine ausgeprägte Rumpfbeweglichkeit, sowie turnerische Grundfertigkeiten und die Orientierung im Raum. Landephase Die Landephase zeichnet sich durch gestreckte Kniegelenke, ein gebeugtes Hüftgelenk und die Landung auf Rücken und Schultern (LPosition) aus9. 6 vgl. Killing W.: Gekonnt nach oben, 1995, Philippka, S.28 7 vgl. Wastl P., Wollny R.: Leichtathletik in Schule und Verein, 2012, Hofmann Verlag, S.114 8 vgl. Killing W.: Gekonnt nach oben, 1995, Philippka, S.28 9 Ebd; vgl. Wastl P., Wollny R.: Leichtathletik in Schule und Verein, 2012, Hofmann Verlag, S.114f 4 2.3 Vorsichtsmaßnahmen Laut des Oberschulamtes Karlsruhe passieren 9 10 Prozent der Schulsportunfälle in der Leichtathletik 49,9 und davon 27,7 beim Hochsprung. Im Hinblick darauf kann durch geeignete Maßnahmen Unfällen vorgebeugt werden10. Checkliste zur Sicherheit beim Hochsprung Die Hochsprungständer müssen mit standfesten Füßen ausgestattet sein. Durch Aufstellen einer Markierung in der Mitte vor der Anlage kann ein falscher Absprungpunkt vermieden werden. Die Hochsprungmatte ist an den Seiten und nach hinten mit Matten zu sichern. Während des Übens soll regelmäßig überprüft werden, ob sich die Matten verschoben haben. Bei nassem Boden darf nicht gesprungen werden. Hinweise für Schülerinnen beim Hochsprung Die Landung soll auf dem ganzen Rücken erfolgen, nicht auf den Schultern oder dem Nacken. Die Körperspannung bleibt bis zur Landung erhalten, damit die Knie nicht das Gesicht berühren 10 vgl. Palatinusch, Heidi. Auszug aus dem SportInfo 1/2002 Heft 19. 5 3 Kompetenzerwerb und Lernziele Im Unterricht werden die Ziele in fachliche, personale, methodische und soziale Ziele differenziert. Im Hinblick auf den Hochsprung wie folgt: Fachliche Ziele: Die Schülerinnen Personale Ziele: Die Schülerinnen verbessern ihre motorische Leistungsfähigkeit durch Laufen erweitern ihre Bewegungs und und das Sprung ABC Körpererfahrungen können ihre Leistungsfähigkeit richtig einschätzen und wählen können ihre Leistungsfähigkeit einschätzen eine entsprechende Sprungstation aus sind bereit etwas zu wagen, in dem sie über die Zachariaslatte auf die können den Standflop Matte springen können eigenes Sporttreiben reflektieren und realistisch einschätzen Methodische Ziele: Die Schülerinnen Soziale Ziele: Die Schülerinnen können die Geräte auf und abbauen und können dabei Sicherheitsaspekte berücksichtigen. 6 können Regeln beim Spielen akzeptieren und einhalten zeigen beim Spielen Fairness 4 Didaktische Reflexion und Entscheidungen 4.1 Legitimation des Themas auf Grundlage des Bildungsplans In den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb geht es um die Qualifikation, das heißt um die Vermittlung grundlegender Fähigkeiten und motorische Fertigkeiten (Erziehung zum Sport), sowie um die Erziehung durch Sport, die die Persönlichkeitsbildung und somit die personalen und sozialen Ziele umfasst. Die Unterrichtseinheit lässt sich den Kompetenzen und Inhalten von Klasse 7/8 aus dem Bereich „Grundformen der Bewegung – Leichtathletik/Geräteturnen/Akrobatik Tanz/Schwimmen zuordnen. Daraus ergeben sich verschiedene Handlungsfelder: Die Schülerinnen verbessern ihre motorische und konditionelle Leistungsfähigkeit und können diese richtig einschätzen können Risiken abschätzen, sind bereit etwas zu wagen und verantworten Sicherheitsmaßnahmen können bei sportlichen Aktivitäten miteinander selbstständig kooperieren und in Wettkampf treten. Dabei zeigen sie Fairness, Rücksichtsnahme und die Bereitschaft Konflikte zu bewältigen. die allgemeinen Grundfertigkeiten aus Klasse 5 und 6 in den leichtathletischen Disziplinen anwenden und weiterentwickeln ihre Leistungsfähigkeit einschätzen die Geräte auf und abbauen, dabei Sicherheitsaspekte berücksichtigen11 11 Bildungsplan 2004, S. 127ff 7 8 4.2 Didaktische Analyse nach Klafki Exemplarische Bedeutung Die Schülerinnen sollen die leichtathletische Vielfalt exemplarisch am Beispiel Hochsprung kennen lernen. Außerdem hat der Sportunterricht die Aufgabe den Schülerinnen die verschiedenen Bereiche des Sports exemplarisch vorzustellen, so dass sie in der Lage sind, eine Sportart, die ihnen gefällt, weiterzuführen. Hochsprung ist eine geschlossene Fertigkeit, die exemplarisch für andere geschlossene Fertigkeiten aus der Leichtathletik wie z.B. dem Weitsprung, aber auch aus anderen Bereichen des Sports z.B. dem Schwimmen stehen kann. Überdies ist Hochsprung eine Individualsportart, die überwiegend auf der Leistung des Individuums basiert. Somit steht der Hochsprung exemplarisch für Individualsportarten wie z.B. Schwimmen, Tennis, Tischtennis, Turnen. Gegenwartsbedeutung Die Leichtathletik verliert aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen zunehmend an Bedeutung. Dem Hochsprung liegt die Sinngebung Anstrengung, individuelle Leistung und Wettkampf zugrunde. Der Schulsport hat die Aufgabe die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen durch leichtathletische Sinngebung zu fördern, sowie individuelle Körper und Bewegungserfahrung zu ermöglichen12. Zukunftsbedeutung Der Sportunterricht soll Schülerinnen zu lebenslangem Sporttreiben motivieren. Gefällt einem Schülerinnen der Hochsprung, so kann der Unterricht Schülerinnen dazu motivieren Hochsprung im Verein längerfristig zu betreiben. Die personalen, sozialen und methodischen Lernziele tragen langfristig zur Entwicklung der Persönlichkeit bei. 12vgl. S.5f, Wastl P., Wollny R.: Leichtathletik in Schule und Verein, 2012, Hofmann Verlag 9 10 4.3 Bezug der Schülerinnen zum Thema und Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit zum Hochsprung 28.4. (60 Min.) Sprung und Bewegungserfahrungen sammeln im Sprunggarten 5.5. (60 Min.) Auf und Abbau Anlaufen und Absprung Fr 8.5. (45 Min.) Auf und Abbau Flugphase und Landung Abbau der Hochsprunganlage Komplexe Übungen an der Hochsprunganlage, Zielübung Flop Auf und Abbau Unterrichtsbesuch 12.5. (60 Min.) Die Technik Flop als Ziel ist eine geschlossene Fertigkeit. Folglich wurde die serielle methodische Übungsreihe ausgewählt, um die Bewegung zu erlernen. Hierbei wird die Bewegung in Teilbewegungen vom Bewegungsanfang nach hinten zerlegt. So wird Überforderung vermieden und die Schülerinnen erleben Erfolge, die eine motivierende Wirkung haben. Die Schülerinnen haben keine Vorerfahrungen im Bereich Hochsprung. Aus den Klassen 5/6 kennen die Schülerinnen die Grundform der Bewegung springen. Laut Killing empfiehlt es sich im Alter von 9 – 14 Jahren einen Schwerpunkt auf den Erwerb neuer Bewegungsabläufe und Techniken zu setzen, da in diesem Alter Schülerinnen leicht neue Bewegungen erlernen 13. In der ersten Stunde konnten Schülerinnen anhand vorbereitender Übungen Sprungerfahrungen im Sprunggarten sammeln. Durch induktives Vorgehen können die Schülerinnen an Stationen Erfahrungen beim Überqueren von Hindernissen und beim Aufspringen auf Geräte sammeln. In der zweiten Stunde erlernten die Schülerinnen anhand von Vorübungen das Anlaufen und den Absprung an der Hochsprunganlage. 13 vgl. S.22, Killing W.: Gekonnt nach oben, 1995, Philippka 11 In der dritten Stunde, dem Unterrichtsbesuch, stehen lediglich 45 Minuten zur Verfügung. Die Schülerinnen erlernen durch vorbereitende Übungen und Vorübungen die nachfolgende Sequenz Flugphase und Landung. In der vierten Stunde werden die Vorübungen zusammengesetzt und die Schülerinnen werden an die Zielübung „Flop herangeführt. In der fünften Stunde können sie Schülerinnen üben, sich steigern und das gelernte vertiefen. Darüber hinaus erfolgt die Leistungsmessung. Grundsätzlich führen die Schülerinnen in allen Stunden den Auf und Abbau der Stationen und der Hochsprunganlage durch. 5 Methodische Reflexion und Entscheidung 5.1 Begründung des Stundenverlaufs, der Materialien und Medien Einstieg Das Aufwärmen erfolgt anhand eines Würfelspiels, das einen hohen Aufforderungscharakter besitzt. Hierbei wird das Absenken des Körperschwerpunktes beim Kurvenlaufen geübt. Im Anschluss folgt durch das Sprung ABC eine sportartspezifische Erwärmung. Hierdurch werden Schülerinnen auf die nachfolgende Belastung vorbereitet. Die Schülerinnen können ihre Sprungkraft und die Sprungtechnik verbessern. Das Laufen mit wechselnden Armhaltungen stellt eine koordinative Herausforderung dar. Darüber hinaus wird die Rhythmisierungsfähigkeit geschult. Der Erwerb motorischer Fertigkeiten und Fähigkeiten sind in der Leichtathletik untrennbar miteinander verbunden14. So stellt die beim sportartspezifischen Aufwärmen erworben Fähigkeit Koordination eine wichtige Grundlage für den späteren Erwerb der komplexen Fertigkeit Flop dar. 14 Vgl. Wastl P., Wollny R. Leichtathletik in Schule und Verein. Hofmann Verlag, 2012, S. 30 12 13 Hauptteil Der Hauptteil besteht aus vorbereitenden Übungen und Vorübungen zur Erarbeitung der Überquerungshaltung. Wichtig ist diesem Prozess Platz einzuräumen, da weitere spätere Bemühungen ansonsten nicht ihr Ziel erreichen werden. Die Fertigkeit Flop ist zu komplex und die Schülerinnen wären mit der Ausführung überfordert. Deshalb wird das Vereinfachungsprinzip angewandt und die Zielfertigkeit in kleine Abschnitte vom Bewegungsanfang nach hinten zerlegt 15. In der vorangegangen Stunde wurde bereits der Anlauf und Absprung erlernt. In dieser Stunde wird der Schwerpunkt auf Absprung und Landung gelegt. Die vorbereitenden Übungen dienen dazu, Fertigkeiten, die für die zu erlernende Technik grundlegend sind, zu erwerben. Hierzu wird die Einnahme der Landeposition „LPosition aus dem Standflop geübt und im Anschluss isolierte Fallübungen (gestrecktes Umfallen vom Kasten seitwärts und rückwärts aus dem Stand) durchgeführt. Aufgrund der ungewohnten Landung auf dem Rücken haben viele Schülerinnen zu Beginn Hemmungen sich beim Flop auf die Matte fallen zu lassen. Die Übungen werden von Schülerinnen oder der L demonstriert. Da das Erlernen der Floptechnik Mut und Vertrauen fordert, haben die Schülerinnen an den Stationen die Chance Ängste abzubauen und Selbstvertrauen zu entwickeln. Im Anschluss werden an zwei Hochsprunganlagen Vorübungen zur Erarbeitung der Überquerungshaltung durchgeführt, mit dem Ziel sich an die Zielübung anzunähern. Es erfolgt der Absprung vom Kastendeckel seitlich oder mit dem Rücken zur Matte. Durch die Absprunghilfe kann das Abtauchen hinter der Hochsprunglatte geübt werden. „In der Anfängerschulung ist darauf zu achten, dass das Erlernen der Technik durch Lernbedingungen nicht negativ beeinflusst wird.16 Dementsprechend wird zu Beginn die ZachariasLatte oder Zauberschnur verwendet. Das Ziel der Übung ist, nicht die maximal zu überquerende Höhe, sondern die richtige Rotation 15 Vgl. Wastl P., Wollny R. Leichtathletik in Schule und Verein. Hofmann Verlag, 2012, S.116 16 Unterrichtsbegleitende Skript, Deutsche Sporthochschule Köln, S.6 14 und Landung. Die Schülerinnen sollen sich daran gewöhnen, dass die Steigphase bis zur Latte nicht über der sicheren Matte stattfindet, sondern im Bereich zwischen Absprungstelle und Mattenkante. Differenziert wird an den Sprunganlagen: Eine Sprunganlage (mit 2 Kästen zum Absprung) ca. kniehoch, eine Sprunganlage (mit 2 Kästen zum Absprung) ca. hüfthoch. Nach zwei bis drei Durchgängen wird je ein Kasten an jeder Sprunganlage von der Matte weiter weggerückt. Aufgrund dessen, das es an den Sprungstationen zu Wartezeiten kommt haben die Schülerinnen die Zusatzaufgabe einfache turnerische Elemente (Rolle rückwärts, Rolle vorwärts, Rückenschaukel, abrollen über die Schulter) auszuführen. Mit diesen Zusatzübungen wird das Ziel verfolgt auf die ungewohnte Flugkurve „rücklings und die Rückenlandung vorzubereiten, sowie die Beweglichkeit zu schulen. Hierzu liegen an den Turnmatten Stationenkarten mit Bewegungsaufgaben aus. Wodurch die Selbstständigkeit der Schülerinnen gefördert wird. Schluss Im Anschluss folgt der Geräteabbau. Hierzu werden den Gruppen aus dem Aufwärmspiel Bereiche zugeteilt, so dass jedem Schülerinnen klar ist, welche Aufgaben zu erledigen sind. (Gruppe 1: Abbau Hochsprungstation 1, Gruppe 2 Abbau Hochsprungstation 2, Gruppe 3 Abbau Matten, Hütchen, Kästen) Zuletzt erfolgt die Reflexion. Schülerinnen lernen das körperliche Erleben in Worte zu fassen. Hierbei besteht die Möglichkeit die eigene Meinung zu finden und diese zu vertreten. Die Reflexion stellt ein Beitrag zur Entwicklung von personalen und sozialen Kompetenzen dar und ist somit ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Darüber hinaus erhält die Lehrperson eine Rückmeldung darüber, wie die Stunde bei den Schülerinnen angekommen ist. 5.2 Begründung der gewählten Sozialform 15 In der Stunde wird das Prinzip der wechselnden Gruppierung angewandt. Die Gruppeneinteilung erfolgt durch das Ziehen von Memorykarten. Dies ist eine Form der Gruppeneinteilung, die schnell geht. Die Schülerinnen können mit jeder Mitschülerin zusammen üben und spielen. Die sportartspezifische Erwärmung betrifft alle Schülerinnen und wird in der Großgruppe durchgeführt. Für die Vorübungen an den Hochsprunganlagen sollen sich die Schülerinnen zunächst gleichmäßig auf die zwei Anlagen verteilen. Diese Form gibt den Schülerinnen Freiheit sich z.B. mit einer Freundin an eine Station zu stellen und lockert den Unterrichtsrahmen auf. Anschließend erfolgt die Differenzierung, so dass die Schülerinnen sich entsprechend ihrem Können auf die unterschiedlichen Stationen verteilen. Hierbei müssen die Schülerinnen ihre Leistungsfähigkeit einschätzen und entsprechend ihrem Können an einer Anlage üben. Die Schülerinnen können hierbei das Risiko bezüglich der Schwierigkeit einer Station abschätzen und sind bereit etwas zu wagen. 5.3 Planungsalternativen Grundsätzlich kann die Floptechnik alternativ anhand der funktionellen Bewegungsanalyse nach Göhner vermittelt werden. Dabei ist aber die Schwierigkeit das die Schülerinnen unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. So das der Ansatz nur schwer in einsetzbar ist17. Sportartspezifische Erwärmung Eine Alternative zum SprungABC bieten Stabilisierungsformen zur Kräftigung der Rumpfmuskulatur, sowie Dehnübungen um die Beweglichkeit zu fördern. Vorbereitende Übungen an Stationen 17 vgl. hochsprung.pdf 16 Hier besteht die Möglichkeit die Stationen im Bereich der turnerischen Grundelemente weiter auszubauen z.B. Handstand, Handstandabrollen. Vorübungen an Stationen Bei den Vorübungen an Stationen gibt es die Möglichkeit weiter zu differenzieren, z.B. indem der Kasten zur Absprunghilfe durch ein Reutherbrett ersetzt wird. Diese Übung erfordert das Anlaufen mit einigen Schritten und stellt eine erhöhte Anforderung dar, indem Anlauf, Absprung, Flugphase und Landung bereits miteinander verbunden werden. Literaturverzeichnis Dr. A. Güllich, Prof. Dr. W.D. Heß, K. Jakobs, Dr. F. Lehmann, U. Mäde, F.Müller, K. Oltmann, R. Schön unter Mitarbeit der DLVArbeitsgruppe RTP Grundlagentraining. Schüler Leichtathletik. Münster: PhilippkaSportverlag, 2008. Schmees, Johannes Karl hochsprung.pdf (Zugriff am 21.4.2015) Killing, W. Gekonnt nach oben. Münster: Philippka Sportverlag, 1995. Köln, Deutsche Sporthochschule. „Unterrichtsbegleitendes Skript (PDF). kein Datum. koeln.de/imb/Individualsport/content/e40/e10480/e10515/e10528/e11637/Skri ptWeitsprung_ger.pdf (Zugriff am 20. 04. 2015). Ministerium für Kultus, J. u. (2004). Bildungsplan. Palatinusch, Heidi. Auszug aus dem SportInfo 1/2002 Heft 19. kein Datum. (Zugriff am 21. 04. 2015). 17 Wastl P., Wollny R. Leichtathletik in Schule und Verein. Schorndorf: Hofmann Verlag, 2012. Anhang 18 UnterrichtsVerlaufsskizze Name: Sabine Schuwerk Klasse: 7 Datum: 8.5.2015 Thema: Erlernen der Floptechnik: Absprung und Landung Fach: Sport Ziele Personale Ziele: Die Schülerinnen erweitern ihre Bewegungs und Körpererfahrungen; können ihre Leistungsfähigkeit einschätzen; sind bereit etwas zu wagen, indem sie über die Zachariaslatte auf die Matte springen. Fachliche Ziele: Die Schülerinnen verbessern ihre motorische Leistungsfähigkeit durch Laufen und das Sprung ABC; können ihre Leistungsfähigkeit richtig einschätzen und wählen eine entsprechende Sprungstation aus; können den Standflop. Methodische Ziele: Die Schülerinnen können Geräte abbauen und können dabei Sicherheitsaspekte berücksichtigen. Zeit struktur 11:10 – 11:13 11:13 – 11:23 Lernimpuls Lernaktivität Soziale Ziele: Die Schülerinnen können Regeln beim Spielen akzeptieren und einhalten; zeigen beim Spielen Fairness. Didaktische Überlegungen Sozialform Medien/Geräte/ Material Das Spiel hat einen hohen Aufforderungscharakter. Das Absenken des Körperschwerpunktes wird geübt. Einzel Start 1, Start 2 6 Reifen, zehnseitige Würfel, Hütchen zur Markierung Anwesenheitskontrolle, Schmuck ablegen (Erfolgt vor Stundenbeginn) Begrüßung Aufwärmen: Würfelspiel Die Schülerinnen starten an Start 1 oder Start 2 und laufen auf einem Rundkurs. Am Reifen halten die Schülerinnen an und würfeln. Die Schülerin, die als erste 100 Punkte erreicht, gewinnt. 19 11:23 – 11:30 Sportartspezifische Erwärmung: Sprung ABC, Hopserlauf, Fußgelenksarbeit, Steigesprünge, Steigesprünge an die Basketballkörbe, Ballenlauf wie beim Sprint Die Schülerinnen werden auf die nachfolgende Leistung vorbereitet. (Verbesserung der Sprungkraft und der Sprungtechnik, Laufen mit wechselnder Armhaltung: koordinative Herausforderung) Großgruppe 11:30 – 11:35 Hauptteil: Das Erlernen der Floptechnik erfordert Mut und Vertrauen. Die Schülerinnen werden durch die Übungen auf die technischen Elemente vorbereitet. Schülerinnen verteilen sich an die 2 Hochsprung stationen 6 Zusatz aufgaben, 6 Hütchen, 6 Matten, 4 Kästen mit 2 Teilen, 2 Zachariaslatten, 2 Weichboden matten, 1 Hochsprung matte Schülerinnen verteilen sich nach Können an die Hochsprung stationen zusätzlich 2 Matten – je Hochprung anlage, Zachariaslatte Kranke Schülerinnen bauen die Matten und Hütchen mit Hilfe des Hallenplans auf. Hinweis: Nicht auf dem Nacken, sondern auf dem Rücken landen!! Ziel ist das Kennenlernen der Landeposition und der Abbau von Hemmungen. Vorbereitende Übungen an Stationen: Einnahme der Landeposition LPosition als isolierte Fallübung: gestrecktes Umfallen vom Kasten seitwärts aus dem Stand. „Warum ist das Landen in der LPosition wichtig und sinnvoll? Zusatzaufgabe: Nachdem ihr an der Hochsprunganlage gesprungen seid, sucht ihr euch eine Station aus, an der ihr die Bewegungsaufgabe löst. 11:35 – 11:43 Sprungübungen zur Erarbeitung der Überquerungshaltung: Standflop Absprung vom Kastendeckel (Deckel 1 Element) seitlich zur Matte stehend. Hinweis: Kräftiger Armeinsatz, Hüfte zur Brückenstellung hochdrücken Vereinfachungsstrategie: Durch die erhöhte Absprungstelle kann das Abtauchen hinter der Hochsprunglatte geübt werden. Die Kästen stehen zunächst nahe an der Matte. Differenzierung: Sprunganlage 1: 20 Planungsalternative Absprung mit Reutherbrett und kurzem Anlauf niedrige Absprunghöhe (ca. Hüfthöhe oberhalb ab Kasten), ein Kasten nahe an der Matte, ein Kasten weiter weg Zusatzaufgabe: siehe oben Sprunganlage 2: höhere Absprunghöhe (20 30 cm höher), ein Kasten nahe an der Matte, ein Kasten weiter weg. 11:43 – 11:48 11:48 – 12:55 Schluss: Geräteabbau Reflexion anhand einer Blume, Verabschiedung Die Schülerinnen können das körperliche Erleben in Worte fassen und ihre eigene Meinung finden. Die L erhält eine Rückmeldung, wie die Stunde angekommen ist. 21 Reflexions blume Hallenbild 1 Langbank im Hallenplan: Sitzplatz für Frau Rieber und Herr Holl 22 Standort Lehrperson Hallenbild 2 23 Langbank im Hallenplan: Sitzplatz für Frau Rieber und Herr Holl Standort Lehrperson 24 Station 1 Bewegungsaufgabe 1: Rückenschaukel Station 2 Bewegungsaufgabe 2: Rolle rückwärts 25 Station 3 Bewegungsaufgabe 3: Rolle vorwärts 26 Station 4 Bewegungsaufgabe 4: Abrollen über Schulter rechts 27 Station 5 Bewegungsaufgabe 5: Abrollen über Schulter links 28 Station 6 29 Nimm die Brückenhaltung ca. 10 sec. ein. Spanne deine Bauchmuskeln an. Anschließend 30 sec. Pause. Wiederhole die Übung 3 mal. Achte auf deine Wirbelsäule! Führe die Bewegung langsam durch! 30