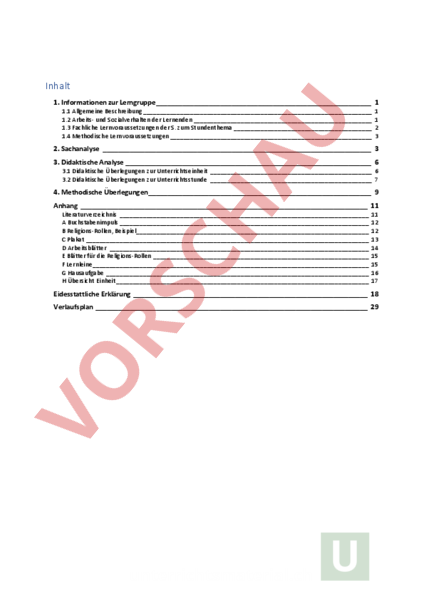Arbeitsblatt: Unterrichtsentwurf Goldene Regel
Material-Details
Unterrichtsentwurf zur Goldenen Regel in den Weltreligionen
Diverses / Fächerübergreifend
Gemischte Themen
4. Schuljahr
19 Seiten
Statistik
178185
2237
15
17.01.2018
Autor/in
Lisa Krüger
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Inhalt 1. Informationen zur Lerngruppe 1 1.1 Allgemeine Beschreibung 1.2 Arbeits- und Sozialverhalten der Lernenden 1.3 Fachliche Lernvoraussetzungen der S. zum Stundenthema 1.4 Methodische Lernvoraussetzungen 1 1 2 3 2. Sachanalyse 3 3. Didaktische Analyse 6 3.1 Didaktische Überlegungen zur Unterrichtseinheit 6 3.2 Didaktische Überlegungen zur Unterrichtsstunde 7 4. Methodische Überlegungen 9 Anhang 11 Literaturverzeichnis Buchstabenimpuls Religions-Rollen, Beispiel_ Plakat Arbeitsblätter Blätter für die Religions-Rollen Lernleine Hausaufgabe Übersicht Einheit 11 12 12 13 14 15 15 16 17 Eidesstattliche Erklärung 18 Verlaufsplan 29 sinnvoll ist (Mendl, 2011, S. 35). Die konventionelle Moral besteht aus der 3. und 4. Stufe, wobei auf der 4. Stufe, der Ordnungs- und Pflichtorientierung, vorgegebene Regeln deshalb beachtet werden, weil sie das Zusammenleben in einer Gemeinschaft wie der Schule unterstützen (vgl. ebd.). Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Behandlung der Goldenen Regel in dieser Lerngruppe aus religionssozialisatorischen und kognitionspsychologischen Gründen sinnvoll und hilfreich für die weitere Entwicklung der S. erscheint. 1.4 Methodische Lernvoraussetzungen Das Anfangsritual ist von den Kindern in dieser Form gewünscht und anerkannt. Die einzelnen Aufgaben werden hierbei wechselnd von den Kindern übernommen und sie sind in der Lage, es selbstständig durchzuführen. Da in der letzten Einheit das Vaterunser die einzelnen Gebete der S. ersetzt hat und wir nun versuchen, das Ritual (auf Wunsch der S. wieder mit persönlichen Gebeten) etwas zeitökonomischer zu gestalten, dürfen nur noch drei Kinder ihre persönlichen Gebete vortragen, woran ich die S. ggf. erinnern werde. Der Sitzkreis ist ein vertrautes und häufig genutztes Element der Religionsstunden und das Bilden bereitet den S. keine Schwierigkeiten. Stumme Impulse sind bei den S. beliebt und ihnen ebenfalls vertraut. Hierüber ist es zumeist möglich, viele S. in das Unterrichtsgeschehen einzubinden und eine breite Aktivierung zu erreichen. Die S. arbeiten öfter in unterschiedlichen Gruppen zusammen, sodass ihnen die Gruppenarbeit (ebenso wie Einzel- und Partnerarbeit) und die hierbei geltenden Regeln bekannt sind. Die S. arbeiten gerne an kleinen Projekten, das Erstellen von Plakaten überfordert viele S. jedoch, sodass ich mich hier für eine andere Form, die „Religions-Rollen (Anhang X) entschieden habe. Diese erfüllen ihren gewünschten Zweck und wirkten sich bisher sehr motivationsfördernd auf die S. und ihr Arbeitsverhalten aus. Die einzelnen, klar umgrenzten Aufgaben und das spätere Zusammenfügen zu einem letztlich vorzeigbaren Produkt gefällt den S. und ermöglicht auch schwächeren Kindern, die die Gestaltung eines ganzen Posters überfordern würde, die Mitarbeit. Das Lesen längerer Texte bereitet fast allen Kindern der Lerngruppe noch Schwierigkeiten, sodass ich mich bemühe, die Informationstexte kurz zu halten, um allen S. die Mitarbeit in der Gruppe und die Teilnahme an der sich anschließenden gemeinsamen Diskussion und Weiterarbeit zu ermöglichen. 2. Sachanalyse „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch! Das ist das Gesetz und die Propheten. (Mt 7,12)1 Diese Aussage Jesu ist Teil seiner Bergpredigt (Mt 5‒7) und wird als „Goldene Regel bezeichnet. Sie lässt sich dabei als übergreifende und übergeordnete Regel für die 10 Gebote (Ex 20, 2‒17; Dtn 5, 6‒21) sowie das Gebot der Nächstenliebe (Lev 19, 18) betrachten. Zudem lässt sie sich auch auf das Gleichnis des barmherzigen Samariters (Lk 10, 25-37) beziehen. Im Lukas-Evangelium ist sie ebenfalls beschrieben: „Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch! (Lk 6, 31). Sie wird hier jedoch speziell in Bezug auf das Gebot zur Feindesliebe bzw. den Verzicht auf Vergeltung aufgeführt (Strecker, 1984). Damit stützt Strecker (1984) die Vermutung, dass diese von Jesus getätigte Aufforderung diejenige zur Vergeltung, wie sie im Alten Testament mit „Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß (2. Mose 21,24) zu finden ist, vollständig zu ersetzen vermag. Die augenfälligste Differenz zwischen Lukas und Matthäus – neben der Aussage zu dem Gesetz und den Propheten, die bei Lukas fehlt, da er „für sog. „Heidenchristen schreibt, die keine Verwurzelung 1 Hier und im Folgenden wird nach der Lutherbibel 2017 zitiert. 3 im Judentum haben (Bauschke, 2010, S. 50) – ist das einleitende Wort „Alles, das nur bei Matthäus, d. h. in der Bergpredigt, zu finden ist. Dies versteht Bauschke (2010) als eine Einschränkung der goldenen Regel bei Lukas, denn die „Goldene Regel soll trotz ihrer Steigerung zur Fremden- oder sogar Feindesliebe keineswegs zur totalen Selbstpreisgabe führen, die alles nur Erdenkliche für andere zu tun bereit wäre (Bauschke, 2010, S. 50). Conzelmann Lindemann (2000) verfolgen in diesem Zusammenhang trotz fehlender biblischer Anhaltspunkte die These, dass „die Forderungen der Bergpredigt [] bewußt als unerfüllbar gestaltet [seien], weil dem Menschen auf diese Weise sein Sündersein, d.h. seine Schuld Gott gegenüber, vor Augen geführt werden solle (S. 483). Die goldene Regel ist zwar sicherlich nicht allerorts und jederzeit in vollem Umfang anwendbar, kann jedoch durchaus als „Appell an die vernünftige Einsicht (ebd.) sowie als „ethische Weisung für die christliche Existenz (ebd., S. 336) angesehen werden. Auch Luther sah in ihr „Regel der Liebe und eine „geistliche Verstehenshilfe sämtlicher Gebote (Bauschke, 2010, S. 52). Er schrieb ihr in seiner Lehre einen besonderen Stellenwert zu und sah sie zugleich als wichtigstes göttliches Gesetz an. Dies lässt sich auch damit unterstreichen, dass der goldenen Regel als einziger neutestamentlichen Tradition neben dem Doppelgebot der Liebe, das die Beziehung zu Gott und die Beziehung zum Mitmenschen in einen unlösbaren Zusammenhang bringt, die Ehre zuteilwird, dass Jesus sie als ‚das Gesetz und die Propheten‘ bezeichnet und damit ihre besondere Bedeutung herausstellt und diese beiden Gebote als Summe der Forderungen Gottes bei Matthäus gleichgestellt sind (Bedford-Strohm, 2006). Abschließend stellt sich die Frage, ob und inwieweit diese Regel überhaupt allgemein umsetzbar ist und welche Folgen ihre Anwendung insbesondere dann hätte, wenn Menschen mit völlig anderen Wünschen und Vorstellungen aufeinandertreffen. Diesbezüglich hatte Shaw (1903) bereits ironisierend gesagt: „Do not do unto others as you would that they should do unto you. Their tastes may be different! (Behandle andere nicht so, wie Du von ihnen behandelt werden möchtest. Ihre Vorlieben könnten nicht dieselben sein!) (S. 201). Es gibt somit tatsächlich Situationen, in denen die goldene Regel in seine Sackgasse führt (Bauschke, 2010) – nichtsdestoweniger ist sie jedoch, so Bauschke (2010), ein „moralisches Weltkulturerbe und eine „ideale Orientierungshilfe für unser Leben. Nicht umsonst ist die goldene Regel auch unabhängig von der Bibel als Sprichwort von Bekanntheit: „Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch keinem ander‘n zu. Dabei handelt es sich um eine analoge, jedoch negative Formulierung der goldenen Regel, die so gut wie jedem bekannt ist und die nicht spezifisch für den deutschen Sprachraum ist. So gibt es in fast allen Sprachen ähnliche Sprichwörter (Bauschke, 2010). Auch positive Formulierungen der goldenen Regel lassen sich im Alltag ausmachen, z. B. das häufig in Toiletten anzufindende „Bitte verlassen Sie diesen Raum so, wie Sie ihn vorfinden möchten (Bauschke, 2010, S. 28). Die goldene Regel ist somit auch im alltäglichen Leben oder auch in der Politik weit verbreitet. Ex-US-Präsident Barack Obama etwa verwendete in mehreren seiner Reden, darunter auch in der berühmten Rede „Ein Neuanfang am 4. Juni 2009 in Kairo, mit der es ihm um einen Neuanfang des christlich-islamischen Dialoges ging, ein Zitat der goldenen Regel. Der Ursprung der goldenen Regel lässt sich bis zuletzt nicht rekonstruieren, da sie in der Antike bereits weit verbreitet war (Conzelmann Lindemann, 2000) und an mehreren Orten vermutlich unabhängig voneinander entstanden zu sein scheint (Bauschke, 2010). Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Goldene Regel keinesfalls auf das Christentum beschränkt ist; sie stellt vielmehr seit mehr als 3000 Jahren die ethische Gesamtbotschaft aller Weltreligionen und Kulturen dar (Bauschke, 2010). 4 Damit ist auch religionswissenschaftlich betrachtet von herausstehender Relevanz, da Aussagen mit demselben Tenor in allen großen Weltreligionen vorkommen und somit eine grundlegende Gemeinsamkeit verschiedener Religionen aufzeigen, wie sie auch in der dargestellten Unterrichtseinheit extrahiert werden sollen. Nachfolgend wird daher einzeln für die anderen vier großen Weltreligionen näher ausgeführt. Unabhängig davon, dass sie hier nicht näher betrachtet werden, enthalten darüber hinaus auch die Schriften vieler anderer Religionen ähnliche Aussagen, u. a. der Zoroastrismus, Jainismus oder Konfuzianismus. Die Tora beinhaltet die Regel zwar nicht, wohl aber Gebote zum Verhalten gegenüber anderen, wie Gebote der Nächsten- (Lev 19,18) und Fremdenliebe. Dennoch war die goldene Regel bereits vor Jesu Geburt bekannt. So nutzt Rabbi Hillel sie um 20 v. Chr. als zusammenfassendes Hauptgebot der Tora (Strecker, 1984): „Was dir verhasst ist, das tue deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora, alles andere ist Auslegung. Geh, lerne! Auffällig ist, dass die Regel hier – ebenso wie im bekannten Sprichwort und nachfolgend auch in anderen Religionen – im Gegensatz zur Formulierung Jesu in negativer Variante Eingang fand. Jesus fordert zu einem positiven Handeln auf, während sonst die Vermeidung schlechter Handlungen verlangt wird. Im größten religiösen Volksethos, dem Mahabharata mit seinen mehr als 100.000 Doppelversen, das als Bestandteil der Smritis einen großen Teil des Kerns der hinduistischen Überlieferung beinhaltet, lässt sich die goldene Regel mehrfach identifizieren. Bauschke (2010) zitiert als die bekannteste Variante die nachfolgende: „Tue nicht einem anderen, was dir selbst nicht gefallen würde (wenn man es dir täte), das ist die Summe von Dharma (S. 33), wobei Dharma ein zentraler und bedeutungsschwerer Begriff aller indischer Religionen ist und unter anderem Recht und Moral bedeutet. Darüber hinaus gibt es noch weitere unzählige Nennungen dieser Regel in hinduistischen Schriften (Bauschke, 2010). Im Buddhismus findet sich in dem Dhammapada als einer Anthologie der Sprüche des Buddha (Siddhartha Gautama), die aus dem fünften Jahrhundert v. Chr. stammt, unter anderem im zwölften Kapitel. Dort heißt es: „Du selbst handle stets so, Wie du die anderen belehrst. In anderen Schriften, z. B. der Samyutta Nikaya findet sich etwa die Lehre von Buddha: „Was für mich eine unliebe und unangenehme Sache ist, das ist auch für den anderen eine unliebe und unangenehme Sache. Was da für mich eine unliebe und unangenehme Sache ist, wie könnte ich das einem anderen aufladen? Im Islam begegnet einem die goldene Regel an sehr unterschiedlichen, teils unerwarteten Stellen: Zum einen gibt die goldene Regel in Form eines islamisch rezipierten Jesus, der sich wie folgt äußert: „Und was du nicht möchtest, das dir getan wird, tue auch nicht anderen. Auf diese Weise wirst du wahrhaftig gottesfürchtig sein. (Bauschke, 2010) Wenngleich die goldene Regal nicht wortwörtlich im Koran genannt wird, so lässt sie sich doch unter anderem in der Sure 83, 1-3 wiederfinden: „Wehe den das Maß Kürzenden, die, wenn sie sich von den Menschen zumessen lassen, sich volles Maß geben lassen, wenn sie ihnen aber zumessen oder wägen, Verlust zufügen. Diese Verse stellen wiederum den Ausgangspunkt für Überlegungen im Sinne der goldenen Regel im Islam dar, wie sie von unterschiedlichen Theologen angestellt wurden. Der bekannte Abu-Hamid Muhammad alGhazali bennt immer wieder Varianten der goldenen Regel, in Bezug auf die eben genannte Sure 83 sagt er: „Wie befremdlich aber wäre es, wolltest du von ihm (sc deinem bruder) verlangen, was du selbst nicht gewähren willens bist (Bauschke, 2010, S. 56). Darüber hinaus findet sich die goldene Regal auch in den Hadith-Sammlungen, den Prophetenlegenden und in Abhandlungen zur Ethik (Bauschke, 2010). Muslim ihbn al-Haddschadsch zitiert Mohammed wie folgt: „Wer vom Höllenfeuer entfernt und ins Paradies geführt werden will, [] der tue den Menschen das an, was er wünscht, dass man es ihm selbst antut (Bauschke, 2010, S. 57). 5 Ferner ist die goldene Regel auch mit Kants kategorischem Imperativ zu vergleichen, der besagt, dass der Mensch jederzeit so handeln soll, dass die Maxime seines Handels auch als allgemeines Gesetz gelten könnte. Durch die Konjunktur des kategorischen Imperativs und seiner Ähnlichkeit zur goldenen Regel, stand diese für 200 Jahre in seinem Schatten und gewann erst in letzter Zeit wieder zunehmend an Beachtung. 3. Didaktische Analyse 3.1 Didaktische Überlegungen zur Unterrichtseinheit Im hessischen Kerncurriculum des Faches Religion heißt es: „In unserer Gesellschaft leben Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sozialisation zusammen. In Hinblick darauf nimmt das Fach Evangelische Religion unterschiedliche Voraussetzungen der Lernenden auf, unterstützt die Entwicklung von Toleranz und fördert den offenen Dialog. Dies bereitet die Lernenden auf ein gelingendes und bereicherndes Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft, Kulturen und Religionen vor. (HKM, 2011, S. 11) Dieses „Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft, Kulturen und Religionen (ebd.) ist für die Kinder dieser Lerngruppe im Frankfurter Stadtteil Gallus Alltag. Und doch ist es häufig eher ein „Nebeneinanderher- denn ein „Miteinander-Leben. Das Wissen der S. über andere Kulturen und Religionen ist sehr begrenzt, die Anzahl an Vorurteilen jedoch relativ hoch, wie ein Gespräch mit den Kindern im Vorfeld der Einheit zeigte. Die S. sollen im Religionsunterricht dazu befähigt werden, „über die eigene Religion und andere Religionen sprechen und Mitmenschen in Toleranz und Respekt begegnen zu können (Kompetenzbereich „Kommunizieren und Anteilnehmen, HKM, 2011, S. 17). Dieser im Inhaltsfeld „Religionen geforderte „respektvolle[r] Umgang mit Menschen anderer Religionszugehörigkeit im eigenen Lebensumfeld (S. 19) erfordert jedoch „Grundkenntnisse der jeweils anderen Kultur und Glaubenspraxis (ebd.). Hier setzt die geplante Einheit an und versucht ebendies: Grundkenntnisse anderer Kulturen und Glaubenspraxen zu vermitteln. Aber Kenntnisse über das Fremde sind ebenso wichtig, um sich über das Eigene, also den eigenen, christlichen Glauben bewusst und hierüber gesprächsfähig zu werden. Auch aus diesem Grund also kommt der Religionsunterricht nach Ziebertz (2010) „nicht umhin, sich mit der Vielgestaltigkeit von Religion zu beschäftigen (S. 17), denn „Kinder können von fremden Religionen einiges lernen für sich selbst, für ihre religiöse Orientierung in einer pluralen Welt und für die potenzielle Begegnung mit Andersgläubigen. (Stögbauer Ritter, 2014, S. 306) Stögbauer und Ritter (2014) bezeichnen ein erstes Kennenlernen anderer Religionen in der Grundschule als unverzichtbar und nennen dabei drei relevante Punkte, die innerhalb dieser Einheit forciert werden sollen: „Lernen von, an und mit anderen Religionen bei Erkundungen, Begegnungen und Gesprächen Entdecken von Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten sowie von Unterschieden zwischen den Religionen Gewahrwerden des Eigenen und damit verbunden des zwischen den Religionen Differenten. (Stögbaurt Ritter, 2014, S. 306) Daran anknüpfend lassen sich für die Einheit folgende Lernziele formulieren: Die S. erweitern ihr Wissen zu den fünf großen Weltreligionen (Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam und Judentum), indem sie sich mit wichtigen Themenfeldern, wie beispielsweise den Regeln, Symbolen, Festen und Gebeten der Religionen auseinandersetzen. Sie erkennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Religionen, ebenso wie strukturelle Ähnlichkeiten, die fast allen Religionen gemein sind und können diese benennen. Der interreligiöse 6 Austausch wird gefördert, indem die Kinder eine Moschee und nach Möglichkeit ein weiteres Gotteshaus besuchen und dort in den direkten Dialog mit Vertretern der Religionsgemeinschaft treten. Hierdurch sollen über die Vermittlung von Informationen und das Aufzeigen von Gemeinsamkeiten Vorurteile abgebaut und die Fähigkeit zu einem toleranten respektvollen Umgang mit Menschen anderer Glaubensgemeinschaften angebahnt werden. Aufgrund der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit ist es nicht möglich, jede Religion in all ihren Facetten zu beleuchten und auch die einzelnen Themenfelder können nicht vertiefend behandelt werden. Dies ist jedoch zum Erreichen der Ziele der Einheit auch gar nicht nötig. Der Schwerpunkt der Einheit liegt auf dem Sammeln von Gemeinsamkeiten unter den Religionen, um den S. aufzuzeigen, dass es zwischen den verschiedenen Religionen und ihren Anhängern neben einigen Unterschieden auch viel mehr Gemeinsamkeiten gibt, als sie zunächst vermuten würden. Diese werden im Laufe der Einheit auf einem Plakat (Anhang C) gesammelt und dienen für den Abschluss der Einheit als Gesprächsgrundlage. Hier wollen wir der von den S. in der vorherigen Einheit aufgeworfenen Frage nachgehen, ob alle Götter im selben Himmel leben (und ob sie sich dort wohl gut verstehen würden). 3.2 Didaktische Überlegungen zur Unterrichtsstunde Die Goldene Regel gilt als das „edelste Prinzip der allgemeinen Menschenliebe (Haeckel, 1899) und bildet seit mehr als 3000 Jahren die ethische Gesamtbotschaft aller Weltreligionen und Kulturen. Müssten alle von der Menschheit gesammelten Moralvorstellungen auf einen einzigen Grundsatz reduziert werden und sollte diese Regel gleichsam vor allem Schlechten dieser Welt schützen, so wäre es eben dieses Fundamentalprinzip, das zu formulieren es gelte (Michal, 2005). Sie lässt sich somit als zentral für das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben bezeichnen. Die Relevanz ihrer Vermittlung für das weitere Leben der S. sowohl im schulischen, beruflichen als auch privaten Bereich ist somit gegeben. Mendl (2011) bezeichnet die Vermittlung der Bedeutung von Regeln in Gemeinschaften und die Befähigung der S. zu einer reflektierten Einhaltung dieser Regeln sogar als zentrales Ziel des Religionsunterrichtes (S.115). Auch mit Hilfe des Rahmenplans und anhand des Bildungs- und Erziehungsplans lässt sich die Wahl des Themas für die gezeigte Stunde legitimieren: Die Goldene Regel stellt die Grundlage dar für eine der fünf im Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (HKM, 2007) als zentral für die kindliche Bildung und Erziehung formulierte Vision (‚verantwortungsvoll und wertorientiert handelnde Kinder). Im Rahmenplan heißt es im Erfahrungsbereich ‚Welt und Umwelt: „Im Lebensbereich von Familie und Schule, aber auch darüber hinaus, sucht das Kind nach seinem Platz in der Welt. Dabei lernt es Regeln und Normen kennen, nach denen das Miteinander gestaltet wird, und begreift deren Notwendigkeit. (S. 39). Für die Kinder der vierten Klassen hat dieses Suchen „nach seinem Platz in der Welt zurzeit aufgrund des bevorstehenden Wechsels der Schule eine besondere Relevanz. Aufgabe der Schule und des Religionsunterrichtes im Speziellen muss es sein, den Kindern hierbei zu helfen und ihnen Halt und Orientierung zu geben. Auf diese persönliche und gesamtgesellschaftliche Relevanz der Goldenen Regel wird in der Folgestunde vertiefend eingegangen. Der Schwerpunkt der Stunde liegt im Sinne der Einheit auf dem Aufzeigen der gemeinsamen moralischen Grundlage aller Weltreligionen, die in der Goldenen Regel sichtbar wird. Bauschke (2010) bezeichnet die Goldene Regel in diesem Zusammenhang aufgrund ihrer weltweiten Verbreitung als ein „ausgezeichnetes Medium für das interkulturelle wie auch für das interreligiöse Lernen, da Kinder anhand dieser Regel lernen können, dass „die Kultur oder die Religion „der Anderen [.] nicht etwas völlig Fremdes und Unbekanntes ist und dass „es in der Gestalt dieser Regel eine gemeinsame moralische Basis aller Menschen gibt (S.176). Weiterhin postuliert er: „Die 7 Kenntnis der kulturellen, philosophischen und religiösen Vielfalt der Goldenen Regel ist im Zeitalter der Globalisierung ein Ausweis interkultureller und interreligiöser Kompetenz (S. 176f.). Da die Förderung eben dieser interreligiösen Kompetenz ein Hauptziel der konzipierten Einheit darstellt, scheint eine Thematisierung der Goldenen Regel in diesem Rahmen sinnvoll und stellt einen wichtigen Schritt zur Erreichung des Einheitenzieles dar. Betrachtet man den allgemeinen und religionsdidaktischen Entwicklungsstand der Kinder der Lerngruppe (siehe 1.2), scheint die Behandlung auch aus entwicklungspsychologischer und religionsdidaktischer Sicht angemessen und sinnvoll. Die Goldene Regel findet sich in ihrer negativen Formulierung „Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch keinem ander‘n zu an vielen Stellen unseres Alltags wieder und sollte den Kindern zumindest als Sprichwort bekannt sein. Die Kinder arbeiten während der Arbeitsphase, wie im überwiegenden Teil der Einheit, in Gruppen aus zwei bis drei Kindern. Dies hat zum einen zeitökonomische Gründe, da eine Behandlung der, neben dem Christentum, vier großen Weltreligionen sehr viele, nicht mehr zur Verfügung stehende Unterrichtsstunden benötigen würde. Zum anderen ist eine Arbeitsteilung in Hinblick auf das Ziel der Einheit auch sinnvoll und erhöht dadurch die Motivation, dass die Kinder der Gruppen als Experten für ihr Thema fungieren können und ihre Arbeit eine notwendige Grundlage für die Weiterarbeit darstellt. Die hierbei verwendete Methode der Religions-Rollen (Anhang B) hat auf die S. eine sehr motivierende Wirkung, da sie sich von den sonstigen Methoden (hier ist in erster Linie die Gestaltung eines Plakates zu nennen) unterscheidet, also etwas Neues und anderes darstellt und den S. viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Die Rolle an sich wird hierbei von außen in jeder Stunde um das behandelte Element ergänzt, sodass diese von Stunde zu Stunde bunter und vielfältiger wird. Ebenso wächst die Papierrolle selbst, die aus einzelnen Blättern zum jeweiligen Thema zusammengesetzt wird und sich in der Religions-Rolle befindet. Die einzelnen Blätter sind hierbei, wie auch das Blatt für diese Stunde, schlicht gehalten, sodass die S. eine große Gestaltungsfreiheit besitzen. Die Informationstexte zu den Goldenen Regeln in den einzelnen Religionen sind ebenso einfach gehalten und inhaltlich auf das Wesentliche beschränkt. Die Formulierungen der Goldenen Regeln wurden hierbei einer didaktischen Reduktion und sprachlichen Vereinfachung unterzogen, sodass die S. sich auf den Inhalt fokussieren können, ohne dabei aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten in ihrer Motivation und Arbeitsfähigkeit ausgebremst zu werden. Das für die Reflexion verwendete Plakat der Hände, das zum Sammeln von gemeinsamen Elementen zwischen den Religionen dient, zeigt fünf zueinander gestreckte Hände, die eine angestrebte Verbundenheit symbolisieren sollen („Die Religionen reichen sich die Hände). Der immer gleiche Aufbau der Stunden (Einstieg: „Wie ist es im Christentum?, Arbeitsphase: „Wie ist es in ‚unserer Religion?, Präsentation: „So ist es in den fünf Weltreligionen!, Reflexion: „Welche Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen können wir in Bezug auf das behandelte Thema auf unserem Plakat festhalten?) strukturiert dabei die Einheit und gibt ihr einen für die S. erkennbaren roten Faden. Dieser Effekt wird durch die Lernleine und eine damit geschaffene Transparenz bezüglich der geplanten Unterrichtsinhalte unterstützt. Ich habe mich in dieser Stunde, auch im Sinne der mir in den vergangenen Unterrichtsbesuchen gestellten Lernaufgabe, um eine didaktische Reduktion und eine Fokussierung auf ein Element (das Verbindende zwischen den Religionen) dieses vielfältigen Lerngegenstandes beschränkt. Die Goldene Regel bietet vielfältige Zugangsmöglichkeiten und eine ausführlichere Behandlung der Thematik wäre auf jeden Fall wünschenswert gewesen. Dies ist jedoch bei allen im Rahmen der Einheit behandelten Themen der Fall und aufgrund der geringen Anzahl der noch zur Verfügung stehenden Stunden ist eine Ausdehnung einzelner Themen über mehrere Stunden nicht möglich. Die am Ende der Stunde gestellte Hausaufgabe (Anhang G) soll über die Zuschreibung einer subjektiven Bedeutung zum Lerngegenstand diesen noch einmal vertiefen und somit den Lernerfolg erhöhen (Meyer, 2016). Die hierbei thematisierte subjektive Bedeutung der Goldenen Regel wird in 8 der folgenden Stunde noch einmal aufgegriffen und vertieft. Dabei wird über die von den S. verfassten Texte zunächst darauf eingegangen, welche wichtigen Regeln sich in der Goldenen Regel verbergen, was ihre Besonderheit und Wichtigkeit als moralisches Prinzip noch einmal verdeutlicht und wiederum die Überleitung zu weiteren, in den einzelnen Religionen wichtigen Regeln bildet. Hierdurch soll eine reine Instrumentalisierung der Goldenen Regel zur Erreichung des Zieles der Einheit vermieden und ihre Möglichkeiten zum moralischen Lernen zumindest ansatzweise genutzt werden. 4. Methodische Überlegungen Die Stunde beginnt mit dem Einstiegsritual. Hierbei versammeln sich die Kinder in einem Sitzkreis und bereiten die Kreismitte mit einem Tuch, einer Kerze, Chi-Gong-Kugeln und einem Gebetswürfel vor. Es wird eine Liste geführt und die Aufgaben dürfen abwechselnd von allen S. übernommen werden. Das Anzünden der Kerze markiert den Beginn der Religionsstunde. Das Herumgeben der Chi-Gong-Kugeln bietet zum einen einen Augenblick der Stille, zum anderen fokussiert es die Gedanken auf den Religionsunterricht. Die sich anschließenden, persönlichen Gebete sind den Kindern sehr wichtig und ihnen wird deshalb Raum gegeben. Die Anzahl ist aus zeitlichen Gründen jedoch auf drei beschränkt. Die Religionsstunde beginnt durch das Ritual immer im gemeinsamen Sitzkreis, wo im Anschluss hieran auch der Einstieg in die Stunde stattfindet, und wird ebenfalls im Sitzkreis (oder wie in dieser Stunde im Kinositz) beendet. Dies unterstreicht die Gemeinschaft, ermöglicht eine klare Abgrenzung der einzelnen Phasen, schafft zumindest kurze Möglichkeiten zur Bewegung und gibt dem Religionsunterricht eine immer gleiche Struktur, die Sicherheit verschafft und zum reibungsloseren Ablauf der Stunden beiträgt (Peschel, 2003). Der Einstieg erfolgt über einen stillen Impuls, da sich dieser der breiten Aktivierung als dienlich erwiesen hat. Dieser ist fachunspezifisch gewählt und erfordert kein Vorwissen, sodass alle S. ihre Gedanken und Ideen hierzu einbringen können. Hierbei lege ich fünf goldene Buchstaben in die Kreismitte. Diese haben einen hohen Aufforderungscharakter und die S. können gemeinsam handelnd herausfinden, mit welchem Thema wir uns in dieser Stunde beschäftigen werden. Gleichzeitig führt die Lösung des Rätsels (Regel, und zwar eine goldene) direkt zu der Frage, was die S. sich hierunter vorstellen und was wohl eine Regel zu einer goldenen Regel macht. Über die Assoziationen zum Begriff Gold (wertvoll, teuer, wichtig, .) wird die große Bedeutung dieser Regel erschlossen. Dies führt wiederum zwangsläufig zu der Frage, um was für eine Regel es sich hier wohl genau handelt. Die Goldene Regel aus der Bibel wird vorgelesen und die S. haben die Gelegenheit, sich hierzu frei zu äußern. Dabei wird die Regel entsprechend der Einheitsübersetzung zitiert, da diese syntaktisch gegenüber der o. g. Lutherübersetzung einfacher für die S. verständlich ist („Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!). Ich zeige den S. das von mir zur Goldenen Regel gestaltete Blatt für die Religions-Rolle zum Christentum, was einerseits eine Wiederholung und Sicherung der Goldenen Regel nach Mt 7,12 darstellt, andererseits zur Arbeitsphase überleitet („Jetzt wisst ihr, wie die goldene Regel des Christentums lautet und jetzt ist es eure Aufgabe, herausfinden, ob es in eurer Religion auch so etwas wie eine „Goldene Regel gibt und wie diese lautet!) und den S. eine Hilfestellung im Sinne eines Modells gibt, sodass einige Unklarheiten für die Arbeitsphase bereits hierdurch entfallen. Die S. erhalten alle für die Stunde benötigten Arbeitsmaterialien in ihrer Religions-Rolle, wodurch ich mir einen reibungsloseren Ablauf des Unterrichtsflusses durch das Entfallen von organisatorischen Schwierigkeiten in Hinblick auf die Materialordnung und -verteilung erhoffe. In der Arbeitsphase erarbeiten die Kinder in Gruppen die Goldene Regel „ihrer Religion, verschriftlichen diese in eigenen Worten und gestalten das entsprechende Blatt für die Religions- 9 Rolle. Schnellere Gruppe können bereits versuchen, einen Vergleich zur Goldenen Regel des Christentums herzustellen. Sollte es in einer Gruppe während der Arbeitsphase zu Problemen inhaltlicher Art kommen, werde ich mich zu dieser Gruppe dazu setzen und ihnen meine Unterstützung anbieten. Ansonsten werde ich versuchen, mich während der Arbeitsphase zurückzuhalten und die S. eigenständig in ihren Gruppen arbeiten zu lassen. Die Sicherung der Ergebnisse findet zunächst auf dem Arbeitsblatt (Anhang D) und in einem zweiten Schritt auf dem zu gestaltenden Blatt für die Religions-Rolle (Anhang E) statt. Diese bilden die Grundlage für die sich an die Arbeitsphase anschließende Präsentation, in der die erarbeiteten Ergebnisse vorgestellt und verglichen werden. Hierbei sollen die Kinder merken, dass die verschiedenen Formulierungen alle im Prinzip dasselbe meinen und dass die Goldene Regel einen Grundsatz in allen Religionen darstellt. Diese Erkenntnis soll über die Formulierung in eigenen Worten und das Finden eines passenden Sprichwortes erleichtert werden. Den Abschluss bildet eine Reflexionsphase, die sich in dieser Form durch die ganze Einheit zieht. Am Ende der Stunden wird immer gemeinsam geschaut, ob sich in dem in der Stunde behandelten Thema Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen finden lassen. Hierbei werden entdeckte Unterschiede ebenso besprochen, diese sind jedoch für die gezeigte Stunde marginal. Die Gemeinsamkeiten werden dann auf einem Plakat, das uns durch die Einheit begleitet (Anhang C), gesammelt. Dieses Vorgehen dient zum einen dem Sichtbarmachen und Konservieren der erarbeiteten Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen, zum anderen stellt das Plakat eine Grundlage für das der Einheit nachgestellte Gespräch zum zweiten Teil der die Einheit begleitenden Frage ‚Leben alle Götter im selben Himmel (und würden sie sich dort verstehen)? dar. Zugleich bietet es mir die Möglichkeit zu eruieren, inwieweit die S. die gemeinsamen und differierenden Elemente im jeweiligen Thema in den einzelnen Stunden, so auch in dieser, erkannt haben. Beendet wird die Stunde einem festen Ritual folgend mittels eines stummen, von einem Kind herumgeschickten Händedrucks. 10 Anhang Literaturverzeichnis Bauschke, M. (2010). Die goldene Regel. Staunen – Verstehen – Handeln. Berlin: EB Verlag. Bedford-Strohm, H. (2006). Bevölkerungswachstum/Welternährung. In R. Lachmann, G. Adam M. Rothgangel (Hrsg.), Ethische Schlüsselprobleme. Göttingen: Vandenhoecht Ruprecht. Conzelmann, H. Lindemann, A. (2000). Arbeitsbuch zum neuen Testament. 14. Auflage. Stuttgart: UTB. Haeckel, E. (1899). Welträtsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie. Wiesbaden. Hessisches Kultusministerium (HKM) (2011). Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue Kerncurriculum für Hessen. Primarstufe. Evangelische Religion. Wiesbaden. Hessisches Sozialministerium (HSM) (2007). Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan. Wiesbaden. Mendl, H. (2011). Religionsdidaktik kompakt: Für Studium, Prüfung und Beruf. München: Kösel. Meyer, H. (2016). Was ist guter Unterricht? (11. Aufl.). Berlin: Cornelsen. Michal, W. (1987). Die Goldene Regel. In: GEO Wissen Nr. 35. Hamburg: Gruner jahr. Peschel, F. (2003). Basiswissen Grundschule Band 10. Offener Unterricht. Teil II Fachdidaktische Überlegungen. Baltmannsweiler: Schneider. Shaw, G. B. (1903). Maxims for Revolutionists. Abrufbar unter: shaw/maxims.1903.html (letzter Zugriff 5.6.17) Strecker, G. (1984). Die Bergpredigt. Ein exegetischer Kommentar. Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht. Stögbauer, E. Ritter, W. H. (2014). Kinder begegnen anderen Religionen. In G. Hilger, W. H. Ritter, K. Lindner, H. Simojoki E. Stögbauer (Hrsg.), Religionsdidaktik Grundschule. Handbuch für die Praxis des evangelischen und katholischen Religionsunterrichts (S. 306326). München: Kösel. Ziebertz, H.-G. (2010). Gegenstandsbereich der Religionsdidaktik. In G. Hilger, S. Leimgruber H.G. Ziebertz (Hrsg.), Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf (S. 1728). München: Kösel. 11 Buchstabenimpuls Religions-Rollen, Beispiel 12 Plakat 13 Arbeitsblätter 14 Blätter für die Religions-Rollen Lernleine 15 Hausaufgabe 16 Übersicht Einheit 17 Eidesstattliche Erklärung Hiermit versichere ich, dass ich die Unterrichtsvorbereitung selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet und sämtliche Stellen der Unterrichtsvorbereitung, die anderen benutzten Druck- oder digitalisierten Werken, die im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, kenntlich gemacht habe. Frankfurt, 7. Juni 2017 Lisa Marie Krüger 18 Verlaufsplan