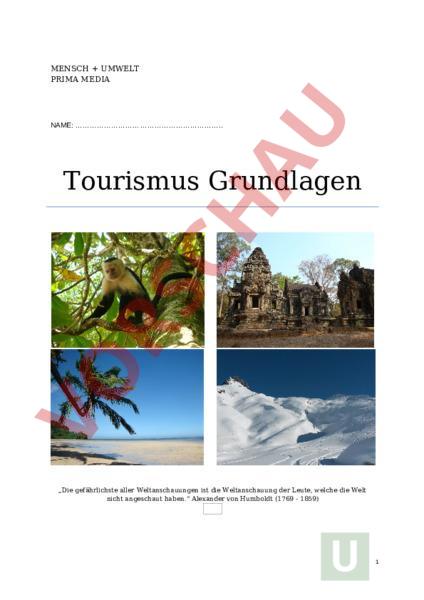Arbeitsblatt: Tourismus
Material-Details
Dossier Tourismus
Geographie
Anderes Thema
9. Schuljahr
29 Seiten
Statistik
211871
22
0
30.01.2025
Autor/in
Hürzeler Patrick
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
MENSCH UMWELT PRIMA MEDIA NAME: Tourismus Grundlagen „Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben. Alexander von Humboldt (1769 1859) 1 Inhaltsverzeichnis 1 Entwicklung von Freizeit und Reisen 3 1.1 Geschichte des Reisens. 4 1.2 Freizeitrahmenbedingungen. 6 1.3 Meine Reisebiographie und Kennzahlen. 8 1.4 Internationale Entwicklung des Reisens10 2 Definition und Erscheinungsformen des Tourismus11 2.1 Definition. 11 2.2 Erscheinungsformen. 12 3 Tourismus als Markt 17 4 Tourismus als vernetztes System. 19 4.1 Touristisches Strukturmodell 19 4.2 Subsysteme Gesellschaft und Wirtschaft23 4.3 Exkurs Overtourism 28 2 1 Entwicklung von Freizeit und Reisen Vorbereitung: Interviewe eine ältere Person in deiner Umgebung und stelle Ihr die folgenden Fragen. Wenn die Person es gestattet, darf das Interview gefilmt oder als Audio aufgenommen werden. Alter der interviewten Person: Wie viel Ferien und Freizeit hatten Sie in jungen Jahren? . . . . . . . . . Was haben Sie in der »freien« Zeit gemacht? . . . . . . . . . Mit welchem Alter sind Sie das erste Mal verreist? Wohin? . . . . . . Wie häufig und wie lange sind Sie verreist? . . . 3 . . . Mit welchem Transportmittel sind Sie gereist? . . . . . . Was war/ist Ihr Traumziel? . . . 1.1 Geschichte des Reisens Auftrag 1: Diskutiert welche Menschen in der Geschichte gereist sind und weshalb? . . . . . . Auftrag 2: Ergänzt die Tabelle mit Hilfe der Texte auf der nächsten Seite. Macht dazu 3er Gruppen und teilt die Themen auf. Präsentiert eure Ergebnisse der Klasse. Motivation Reisetätigkeit Altertum 2000 v.Chr.–4.Jh. Mittelalter 4. Jh.–1500 Neuzeit 15./16. Jh.–1850 4 1850–I. Weltkrieg 1914–1945 ab 1945 Beginn des Reisens? Wann genau sich erste Formen des Reisens entwickelten, lässt sich heute schwer definieren. Die Römer als auch die Griechen und Ägypter sind schon gereist. In diesen frühen Sklavenhaltergesellschaften entwickelten sich freizeitorientierte Aktivitäten, die bereits Gäste aus weiter entfernten Gebieten anlockten. Die Römer erfanden das Konzept «Brot und Spiele« wie zum Beispiel die Gladiatorenkämpfe, um von eventuellen politischen Forderungen abzulenken und zum allgemeinen Amüsement. (Schwenoha, C., 2015) 1 Vorphase: Altertum – Mittelalter – Neuzeit (2000 v. Chr. bis 1850) Die Hauptmotivationen der frühen Reisebewegungen waren Geschäfte (Handel), Eroberung (Kriege), Bildung, Religion (Wallfahrten, Pilgerreisen) sowie Gesundheit (z. B. Thermen). Der Beginn der Neuzeit (17. 18. Jh.) ist gekennzeichnet von der »Grand Tour«, einer »Bildungsreise«. Es gehörte für junge Adelsherren und Grossbürgersöhne aus England, Deutschland und Skandinavien, teilweise auch aus Amerika, zum guten Ton, ihre klassische Ausbildung mit einer Reise zu den historischen Stätten und Landschaften in Frankreich und vor allem Italien abzuschliessen. (Schwenoha, C., 2015) Zudem war auch die Erforschung der Welt im 18. 19. Jh. Motivation zu reisen. Zum einen in Form von Entdeckungsreisen verschiedener Inseln wie Tahiti oder Hawaii (James Cook). Zum anderen, um die Natur zu erforschen, wie im 19. Jh. Alexander von Humboldt. Reisen war in dieser Zeit vorwiegend der reichen Bevölkerungsschicht vorbehalten. Die Transportmittel waren zu Beginn noch etwas eingeschränkt, Schiffsreisen gehörten allerdings auch dazu (Handelsrouten, Entdeckungsreisen, Missionarsarbeit). (Schwenoha, C., 2015) 2 Frühphase des modernen Tourismus in Europa (1850–1914) Der Engländer Thomas Cook organisierte 1841 eine Bahnreise für etwa 570 Personen und legte damit den Grundstein für das heutige Reisebüro. Die typische Reiseform dieser Zeit war die »Sommerfrische«, bei welcher jedes Jahr zur gleichen Zeit an den gleichen Ort gefahren wurde. Es war auch die Zeit der Kurorte und des beginnenden Alpinismus. Allgemein wird in dieser Zeit das Reisen auch immer mehr für die damals neu aufkommende »Mittelklasse« bezahlbar und erstrebenswert. (Schwenoha, C., 2015) 3 Entwicklungsphase in Europa (1914–1945) 5 Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs bedeutete für Österreich und Deutschland vorerst eine Krise für den Tourismus. In der Zwischenkriegszeit ging es zunächst stetig bergauf, wobei den Hauptteil der Nächtigungen immer noch die »Sommerfrische« ausmachte. Durch die von den USA ausgehende Weltwirtschaftskrise kam es nach 1929 allerdings zu einem neuerlichen Einbruch in der Tourismusentwicklung. Mit dem Nationalsozialismus veränderte sich das Reiseverhalten in Deutschland und Österreich: die Reise-Organisation »Kraft durch Freude (KdF)«, welche staatliche organisierte Reisen zu niedrigen Preisen anbot, entstand. Es handelte sich hierbei nicht um freizeitorientiertes Reisen im heutigen Sinne. Es diente vielmehr der Volkserholung, dem Erhalt der Arbeitskraft und nicht zuletzt der staatlichen Einflussnahme. Urlaub wurde als Belohnung für gutes Bürgertum im Sinne der nationalsozialistischen Propaganda benutzt. Zweiten Weltkriegs kam es zu einem plötzlichen Ende der Reisetätigkeit, die dem Vergnügen diente. (Schwenoha, C., 2015) 4 Hochphase: Tourismusentwicklung in Europa bis heute (ab 1945) Wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung des Tourismus seit 1945 war der wirtschaftliche Aufschwung der westlichen Industrienationen. Dies äußerte sich u. a. in der steigenden Zahl an eigenen Transportmitteln PKW in den 1950er Jahren, welche wiederum zum Phänomen Massentourismus wesentlich beitrugen. Auch die Zunahme im Flugverkehr veränderte das Reiseverhalten der Menschen – bis heute – signifikant. Zwischen 1950 und 1970 zeichnete sich der Trend des Sozialtourismus ab. Dem Kommerz und Kapitalismus entgegenwirkend entstand eine Tourismusform, die der arbeitenden Bevölkerung durch staatliche Zuwendungen Urlaub ermöglichen sollte. Eine Ausnahme der beschrieben Trends stellte das sozialistische Osteuropa dar: In Deutschland war internationales Reisen in der DDR bis 1990 nur eingeschränkt möglich und wurde weitgehend staatlich organisiert und ähnlich dem Reisen während des Nationalsozialismus politisch genutzt (vgl. Ferner et. al. 2011: 17–21; EGO – Europäische Geschichte Online). Heute Während der Massentourismus fortbesteht, kommt es auch zu einer Individualisierung des Reisens. Alle genannten Reisemotive aus der Vor-, Früh- und Entwicklungsphase des Tourismus treten heute gleichzeitig auf. Ein und dieselbe Reise kann gleichzeitig der Erholung, der Bildung, dem Erlebnis und weiteren Motiven dienen. Der Massentourismus steigt kontinuierlich seit den 1990er Jahren an und wird nicht nur durch kommerzielle Reiseveranstalter, sondern auch durch den Individualtourismus angetrieben (vgl. Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, 2013). Seit den 1970er Jahren dominieren Inlandsund Auslandsreisen gleichermaßen den Markt, wobei bei den Auslandsreisen auch Ferndestinationen stark an Marktanteil gewonnen haben. (Schwenoha, C., 2015) 1.2 Freizeitrahmenbedingungen Auftrag: Studieren Sie die Abbildung und bearbeiten Sie die Aufträge. Lebenserwartun eines Einjährigen 1850: 40J 1920: 60J 1950: 69J 1990: 77J 2008: 82 2019: 83,5 Frau: 85.4 Mann: 81.7 Arbeitszeit Tatsächliche Jahresarbeitszeit (Vollerwerb) 1850: 1920: 1950: 1990: 2007: 2019: 4500 2450 2250 1900 1900 1900 Std Std Std Std Std Std Wohlstand Jahreseinkommen (Vollzeiterwerb) 1850: 6�00.1920: 10�00.1950: 20�00.1991: 57500.2008: 70000.- 6 Freizeit und Tourismus Verstädterung Anteil städt. an ständiger Wohnbevölkerung 1850: 1920: 1950: 1990: 1995: 2000: 2019: -35% 43% 58% 69% 73.3% 85% Arbeits- und Wohnort Anteil Pendler an Erwerbsbevölkerung 1850: 1920: 1950: 1990: 1995: 2000: 2019: -10% 20% 52% -57.8% 71% Motorisierung Anzahl PW pro 1000 Einwohner 1850: 1920: 1950: 1990: 1995: 2000: 2018: -2.3 26 439 456 492 543 Abbildung 1: Entwicklung von Freizeitrahmenbedingungen in der Schweiz. Beschreibt eurer Pultnachbarin eurem Pultnachbarn kurz wie sich die Faktoren entwickelt haben. . . . 1. Inwiefern begünstigen die sechs Faktoren Freizeit und Tourismus? Tragt eure Überlegungen in die Tabelle ein. Lebenserwartung Arbeitszeit Wohlstand Verstädterung 7 Arbeits- und Wohnort Motorisierung 1.3 Meine Reisebiographie und Kennzahlen Auftrag 1: Stellt eure Reisebiographie mit der App Mark Travel dar. Die Lehrperson wird euch den Link (QR-Code) dafür geben. Schreibt im Kommentar welche Reiseart (Bahn, Flugzeug, Auto) ihr am meisten nutzt und wie viele unterschiedliche Länder ihr bereist habt. Abschliessend notiert eure Wunschdestination. Mark Travel (Google Store) Mark Travel (Apple Store) Auftrag 2: Berechnet die Reisehäufigkeit und die Reiseintensität eurer Klasse. Interpretiert die Ergebnisse mit Hilfe der folgenden Hintergrundinformationen: 1 0F 1 Tourismusstatistik Bundesamt für Statistik, 2013 8 Unter Reiseintensität (%) versteht man den Anteil der Bevölkerung ab 6 Jahren, welche mindestens eine Urlaubsreise mit einer Dauer von mindestens fünf Tagen/vier Übernachtungen unternommen haben. Die Reiseintensität der Schweiz betrug im Jahre 2014 87.4%. Die höchste Reiseintensität besitzen Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren, nämlich 97.8% Die Reisehäufigkeit beschreibt, wie häufig eine Person, die älter als 6 Jahre ist, eine Reise innerhalb eines Jahres von mindestens fünf Tagen/vier Übernachtungen unternimmt. Die Reisehäufigkeit in der Schweiz beträgt 3,0 (stand 2014), aber unterscheidet sich nach Sprachregionen. Die Tessiner verreisen am wenigsten und die Deutschschweizer am meisten. Die Schweiz gehört zu den Ländern mit einer im weltweiten Vergleich sehr hohen Reiseintensität. Bereits in den 70er Jahren betrug die Reiseintensität beinahe 70%. Die Reisenden unternahmen damals jedoch durchschnittlich nur 1,6 Reisen pro Person. Reiseintensität wie Reisehäufigkeit werden zunächst vor allem mit der konjunkturellen Lage und der damit verbundenen allgemeinen Einkommenssituation in Verbindung gebracht. Die wirtschaftliche Verunsicherung in den 90er Jahren wiederspiegelte sich im Reiseverhalten. Die Schweizer scheinen diesbezüglich sensibler zu reagieren als etwa die Bewohner in Vergleichsländern: In der gleichen Zeitspanne allerdings mit unterschiedlichen Wirtschaftsperspektiven stieg tendenziell die Reiseintensität beispielsweise in Deutschland, Frankreich, oder Grossbritannien. 2 1F . . . . . . Weitere Kennzahlen und ihre Erhebungsmethoden: . . 2 Ferienreisen. Umweltstatistik Nr. 12. Bundesamt für Statistik, 2002 9 1.4 Internationale Entwicklung des Reisens Aufträge: 1. 2. 3. 4. Beschreibt das Wachstum der internationalen Touristenankünfte zwischen 1950 und 2010. Beschreibt die Wachstumsprognosen für die Zukunft. Erklärt das touristische Wachstum mit sechs unterschiedlichen Gründen. Erläutert mit Beispielen, weshalb der Tourismus in einigen Regionen kurzzeitig zusammenbrechen kann. Abbildung 2: Aktuelle Tourismus Trends der UNWTO. . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . 2 Definition und Erscheinungsformen des Tourismus 2.1 Definition Auftrag 1: Diskutiert kurz zu zweit folgende Frage und notiert die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit jemand als Tourist Touristin gilt. Was ist eine Touristin ein Tourist? . . . . . . Offizielle Definition: . . . . . Auftrag 2 Wendet euer Wissen an und beantwortet die Fragen in den folgenden Beispielen. 11 a) Das Fitnesscenter „fit life (Fantasiename) in Münsingen bietet verbilligte Trainingseinheiten und Saunabesuche für in Münsingen wohnhafte Personen an. Ist dies ein touristisches Angebot? Warum? . . . b) Rolf Moser wohnt in Bern und arbeitet in Zürich. Er pendelt täglich zwischen Arbeits- und Wohnort. Ist Rolf Moser in Zürich ein Tourist? Warum? . . c) Der Kiosk beim Kongresszentrum Zürich hat sein Angebot an internationalen Zeitungen ausgebaut: Der grösste Teil seiner Kunden sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kongressen oft aus Übersee. Lebt dieser Kiosk vom Tourismus? Warum? . . . d) Jaëls Eltern besitzen ein Ferienhaus in Wengen. Sie fahren im Winter jedes zweite Wochenende von ihrem Wohnort in Solothurn dorthin. Sind Jaëls Eltern Touristen? Warum? . . . e) Luca verbringt einen Spielabend mit einem Kollegen im Nachbarquartier. Es wird spät, so dass Luca letztlich dort übernachtet. Ist Luca ein Tourist? Warum? . . . f) Seit 8 Monaten sind Jenny und Daniel auf ihrer lang ersehnten Weltreise. Während den verbleibenden 4 Monaten werden sie noch Nordamerika bereisen. Sind Jenny und Lukas Touristen? . . . 2.2 Erscheinungsformen 12 Auftrag: Nach welchen Kriterien werden folgende Tourismusformen definiert? Beschriftet die Bilder mit der Touristischen Erscheinungsform und einem Kriterium, das die Erscheinungsform von anderen abgrenzt. Beispiel: Erscheinungsform 3 Campingferien Abgrenzungskriterium Beherbergung 3 Touristische Erscheinungsform greifen auf sichtbare, äussere Erscheinungen oder auf nur zum Teil sichtbare Verhaltensweisen sowie auf die nicht sichtbare Reisemotivation zurück. , Stand 6.9.2019) 13 En Abbildung 3: Touristische Erscheinungsformen. 14 2.2.1 Exkurs Abenteuertourismus Auftrag: Bildet mit folgenden Stichworten Sätze, die den Abenteuertourismus beschreiben. Recherchiert im Internet, um zu den jeweiligen Stichworten inhaltliche Informationen zu erhalten. Erlebnisgesellschaft Nischensegment Verjüngung „rejuvenation Outdoor Risiko als Strategie Suche nach Herausforderungen „skills Subjektive Wahrnehmung der Zivilisationsferne „remoteness Bewusstseinszustand „kick Abbildung 4: Abenteuertourismus. . . . . . . . . . . . . 15 . . . 16 3 Tourismus als Markt Vereinfacht gesagt und aus volkswirtschaftlicher Sicht betrachtet, ist der Tourismus ein Markt, auf dem sich Nachfrage und Angebot treffen. Auf der einen Seite stehen die Bedürfnisse und das Reiseverhalten einer Touristin ( touristische Nachfrage) und auf der anderen Seite ein Angebot von touristischen Gütern und Dienstleistungen, die diese Touristin interessieren dürften ( touristisches Angebot). Es ist meist das Angebot, welches versucht, sich möglichst genau mit der Nachfrage zu decken. Allerdings ist es auch so, dass die touristische Nachfrage von den touristischen Anbietern beeinflusst wird. Angebot und Nachfrage bedingen sich also gegenseitig. Da das Reiseverhalten als Lebenstil verschiedener Reisetypen unabhängig von der Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Milieus erkannt wurde, glauben die Reiseanbieter auf dieser Grundlage am ehsten entsprechende Angebote formulieren zu können. Arbeitsauftrag: Beantwortet folgende Fragen mit dem Text auf der nächsten Seite. a) Was sind touristische Grundbedürfnisse? Nennt Beispiele. b) Welches sind eure Reisemotive und Reiseerwartungen? Abbildung 5: Entwicklung der Touristischen Nachfrage. c) Zu welchen Reisetypen gehören ihr? Begründet. d) Welche Einflussfaktoren im engeren und im weiteren Sinne beeinflussen eure Reisemotive? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . Die touristische Nachfrage entwickelt sich in verschiedenen Schritten (Abbildung 7). Am Anfang stehen menschliche Grundbedürfnisse nach Freiheit, Entspannung, Erholung usw. Sie ergeben sich als eine Art Kontrast aus den alltäglichen Zwängen. Diese Grundbedürfnisse werden durch das gesellschaftliche Umfeld stark beeinflusst und bestimmt. Für jedermann scheint festzustehen: Ferien heisst reisen – verreisen. Noch viele weitere Kräfte in unserer westlichen Gesellschaft verstärken den Drang nach draussen: Die steigenden Einkommen, die verkürzte Arbeitszeit, die Organisation der Arbeits- und Schulzeit, die Mobilität, eine günstige Währungslage. Schliesslich ist die Beeinflussung durch die Tourismusanbieter nicht unerheblich. Art der Leistung, Preis, Absatzweg, Werbung etc. beeinflussen die Reisemotive. Die Kommerzialisierung der Erholungsbedürfnisse geschieht nach den anerkannten Regeln der Marketingkunst. Wie geschickt Ferienstimmung vermittelt wird, ist aus Katalogen, Plakaten, Inseraten, Werbefilmen etc. bekannt. Möchte man von einem einzelnen Touristen die Reisemotive (vgl. Tabelle 1) – seine Beweggründe also – erfahren, so erstaunt es nicht, dass viele jener Gründe genannt werden, die in der Tourismuswerbung immer wieder anklingen. Insofern sind die Reisemotive etwas „Gemachtes, etwas Sekundäres. Aus den Reisemotiven entstehen Reiseerwartungen: Von Reisen erwartet man ziemlich analog zu den Reisemotiven Wiederherstellung (Re-Kreation), Gesundung und Gesunderhaltung von Körper und Geist, Schöpfung von neuer Lebenskraft, von neuem Lebensinhalt. Untersuchungen zu den Qualitätserwartungen zeigen immer wieder in etwa das gleiche Bild der Reiseerwartungen (Opaschowski, 2004, zit. in: Müller, 2008, S. 117): Wichtigkeit 1. (von 88-90% der Befragten genannt) 2. (80-88%) 3. (70-80%) Reiseerwartungen (Kriterien) Freundlichkeit, Atmosphäre, landschaftliche Schönheit Gesundes Klima, Sicherheit, Sauberkeit, Gute Küche Kontaktmöglichkeiten, gutes Preis-Leistungsverhältnis, Erreichbarkeit, Sehenswürdigkeiten Reisemotive und Reiseerwartungen zusammen beeinflussen das Verhalten vor, während und nach den Ferien, also das Reiseverhalten (z. B. Reiseform, Reisebegleitung, Zeitpunkt, Dauer, Reiseziel, Verkehrsmittel, Unterkunft, Ausgaben, Aktivitäten am Urlaubsort, Reisezieltreue, Reisezufriedenheit). Tabelle 1: Reisetypen und Wachstumsbranche. S.9) Reisetypen Der Erholungs-Urlauber Reisemotive. (Schmude, Jürgen. A.a.O 2010 In: Terra global 2011.Tourismus die Motive Entspannung, kein Stress Frische Kraft sammeln Abstand zum Alltag gewonnen Frei sein, Zeit haben 18 Der Familien-Urlauber Der Aktivreisende Der Gesundheitsurlauber Der Weltentdecker Der Wenig-Reisende 4 Tourismus als vernetztes System 4.1 Touristisches Strukturmodell Zeit füreinander (Partner, Familie) Mit Kindern spielen Gemeinsam etwas aktives erleben Neue Leute mit ähnlichen Bedürfnissen kennenlernen Orte wiedersehen Kontakte zu Einheimischen Sonne, Wärme, schönes Wetter Ausruhen, faulenzen Sich verwöhnen lassen Etwas für die Schönheit tun Spass, Freude, Vergnügen haben Etwas ganz anderes kennenlernen Viel Erleben, Abwechslung Unterwegs sein, herumkommen Andere Länder erleben Horizont erweitern (Kultur, Bildung) Nur kurze Reisen Vermisst beim Urlaub sein Zuhause Gibt Geld lieber für anders als Ferien aus Zur ganzheitlichen Erfassung und gedanklichen Durchdringung des Phänomens Tourismus bietet sich die Systemtheorie als formale Ordnungshilfe an. Sie hilft z. B. konkrete Fallbeispiele im Tourismus zu vereinfachen und bietet klare Ansatzpunkte, wenn es um eine Analyse geht. 1 Systemüberblick Die Abbildung stellt die wesentlichen touristischen Elemente und Beziehungen in einem einfachen formalen Strukturmodell dar. Sein Grundraster besteht aus den drei voneinander abhängigen Subsystemen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Das gesellschaftliche Subsystem und das wirtschaftliche Subsystem bilden zusammen das sozioökonomische Teilsystem. Dieses steht in enger Beziehung zum Subsystem Umwelt, da die touristische Nutzung der Landschaft im Allgemeinen mit Eingriffen in den Naturhaushalt verbunden ist. Die Steuerung des Systems Tourismus erfolgt im Wesentlichen über die gesellschaftlichen und rechtlichen Normen, die touristischen Investitionen und Konsumausgaben sowie über jede Art direkter und indirekter Tourismuspolitik. 19 Abbildung 6: Touristisches Strukturmodell. Aufträge: 1. Überlegt euch für jedes Subsystem konkrete Akteure (z.B. Einheimische (Gesellschaft), AirBnB (Wirtschaft)) und notieren diese auf einem Poster. Verbindet die einzelnen Einträge mit Pfeilen, um Wechselwirkungen darzustellen und beschriftet die Pfeile. 2. Lest die folgenden Texte und ergänzt inhaltlich euer Poster. Die Subsysteme im Einzelnen: Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt 4 2F Gesellschaft Die Erkenntnis, dass der Tourismus für den Menschen geschaffen ist und nicht der Mensch für den Tourismus, führt zu folgender Einsicht: Im Mittelpunkt des touristischen Geschehens steht der Mensch. Während langer Zeit wurde dies in Theorie und Politik vielfach übersehen. Wirtschaftliche Betrachtungen standen im Vordergrund. Erst in jüngster Zeit begann man sich intensiv mit der psychologischen und sozialen Seite des Tourismus auseinanderzusetzen. Stichworte zu den gesellschaftlichen Aspekten des Tourismus sind: Touristen: Menschliche Grundbedürfnisse, gesellschaftliche Einflussfaktoren (Arbeits-, Wohnund Freizeitbedingungen, Werte/Normen/Prestige, Sozialstruktur, Bevölkerungsstruktur), Beeinflussung durch Tourismusanbieter, Reisemotive und 4 Müller, Hansruedi (2008): Freizeit und Tourismus – Eine Einführung in Theorie und Praxis. 11. Auflage. Bern: Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus der Universität Bern 20 erwartungen, Verhalten und Erleben auf der Reise, Rückwirkungen auf Mensch und Gesellschaft. Bereiste (Ortsansässige): Interesse, Bedürfnisse und Erwartungen, Auswirkungen auf die Lebensqualität, soziale Kosten, soziokulturelle Veränderungen. Begegnung: Begegnungsvoraussetzungen (Vorurteile, Sprache, Mentalität, Gastfreundschaft, Kultur), Begegnungschancen (erfahren von neuem, auseinandersetzen mit dem Fremden, kultureller Austausch, Völkerverständigung). Wirtschaft Dieser Bereich stand bisher im Zentrum des Interesses, nicht zuletzt deshalb, weil die ökonomischen Wirkungen des Tourismus am einfachsten messbar sind (Aufwand/Ertrag, Kosten/ Nutzen) und von ihnen die grössten Anreize ausgehen. Stichworte zu den wirtschaftlichen Aspekten des Tourismus sind: Nachfrage: Wirtschaftliche Einflussfaktoren (Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Preisniveau, Währungslage, Konjunktursituation), Reiseintensität, Aufenthaltsdauer und Logiernächte. Angebot: Allgemeine Infrastruktur (Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen, Einrichtungen des täglichen Bedarfs), touristische Infrastruktur (Beherbergungs- und Verpflegungsbetriebe, touristische Spezialverkehrsmittel, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen, Kongresszentren, Betreuungs- und Informationsdienste), wirtschaftliche Wirkungen (Zahlungsbilanz-, Beschäftigungs-, Ausgleichs- und Einkommenswirkung). Markt: Marktforschung und Marketinginstrumente (Leistung, Preis, Absatzweg, Verkaufsförderung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit), Marketingkonzepte und aktionsprogramme, touristische Mittler (kooperative Tourismusorganisationen, Reiseveranstalter, Reisevermittler, Sales Repräsentatives). Umw elt Die Auseinandersetzung mit den Wirkungen des Tourismus auf die Umwelt begann erst vor wenigen Jahren, als die ökologischen Folgen der vielerorts ungehemmten Tourismusentwicklung für viele sicht- und spürbar wurden. Die Beziehungen zwischen Tourismus und Umwelt sind zwar wechselseitig, jedoch keineswegs gleichgewichtig. Der Tourismus profitiert weit mehr von der natürlichen Umwelt als umgekehrt: Er braucht und verbraucht Natur und Landschaft und greift dadurch gleichzeitig seine eigene Existenzgrundlage an deshalb das Wort von der Zerstörung des Tourismus durch den Tourismus. Demgegenüber gibt es keine ursächliche Abhängigkeit der natürlichen Umwelt vom Tourismus, wenngleich dieser auch positive Rückwirkungen auf den Umweltbereich haben kann. Stichworte zu diesem ungleichgewichtigen Verhältnis sind: Qualität der Wohnumwelt, Landschaft als Erholungs und Lebensraum (Erholungs-, Produktions- und Schutzfunktion), natürliche Faktoren des touristischen Angebots (Landschaftsbild, Klima, Topographie, Gewässer, Ruhe, Tier und Pflanzenwelt), touristische Eignung, Stellenwert von Naturund Landschaftserlebnis. Tourismus und Umweltbelastung: Touristische Landnutzung, Landschaftsbeeinträchtigung und -verbrauch (Bautätigkeit, Zersiedelung und Technisierung der Landschaft, architektonische Landschaftszerstörung), Störung des Naturhaushaltes (Luft- und Wasserverschmutzung, Schädigung der Vegetation und Tierwelt), Lärmbelastung, Energieverbrauch, Beitrag zu globalen Umweltproblemen wie Treibhauseffekt und Ozonloch. Tourismus und Umwelterhaltung: Koexistenz von Landwirtschaft (Landschaftspflege) und 21 Tourismus (Nebenerwerbsmöglichkeit), Schutz von Natur- und Kulturdenkmälern im Interesse des Tourismus, Umweltsensibilisierung bei Touristen, Bereisten und Tourismusanbietern. 22 4.2 Subsysteme Gesellschaft und Wirtschaft 4.2.1 Nutzeffekte und Probleme Auftrag: Diskutiert die Fragen: Welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzeffekte stellt der Tourismus dar? Welche Probleme könnten dabei zwischen den Touristen und Einheimischen entstehen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Auftrag 2: Füllt Sie das Arbeitsblatt «Aussagen» aus. Wer könnte diese Aussage getroffen haben? In welchem Land könnte die Person eurer Meinung nach leben und warum hat sie diese Aussage gemacht? Tabelle 2: Birgit Henökl-Mbwisi, Hildegard Hefel. (2015) Welcome-Goodbye. DVD Fernweh. Filme für eine Welt. Education 21 Aussage Wer? Wo? Warum? 1. [Sie] laufen die Straße rum und grölen und denken nicht da dran, dass es irgendwie auch Menschen gibt, die 23 eventuell müssen. auch arbeiten 2. Das Haus ist total berühmt [] es steht in jedem Reiseführer []. Im Sommer sitzt man dann morgens im Hof [] hat sich gerade ein schönes Frühstück aufgebaut [] auf einmal stehen 50 [Touristen] im Hof [] mit ihren Kameras, klick, klick, klick [] du kommst dir dann irgendwann vor wie ein Affe im Zoo. 3. Wir sind arme Leute und bekommen Besuch von reichen Leuten. Sie schenken mir Reis und manchmal auch Geld. Ich danke Gott dafür. Ich bin wirklich glücklich. Sie schenken mir auch Tofu. Immer, wenn sie kommen, bringen sie mir etwas mit. 4. Ich bin wahrscheinlich der einzige [Einheimische] hier. Alles Touristen, nur Touristen! Wahnsinn! Und es werden immer mehr hab ich das Gefühl! Und alle verdienen sich dumm und dämlich dran: Hotels, Bars, Cafés, Kneipen selbst meine Stammkneipe, die ist jetzt immer so voll, dass ich da manchmal gar nicht mehr reinkomme. Das kann doch nicht sein, Mensch. Ich will auch etwas davon haben, dass die alle hier die Stadt belagern. Mal sehen, wie ich davon profitieren kann. 5. Die Strände gehören allen [.] Es ist nicht in Ordnung, dass sie einen Strand privatisieren. 24 4.2.2 Fallbeispiel Berlin5 Auftrag: Was ist die Botschaft dieses Graffitis? Was sind die Beweggründe? Formuliert eine These und begründet diese. . . . . . . . . . Abbildung 7: Graffiti. Beobachtungsauftrag „Welcome-Goodbye: 1. 2. 3. 4. Was ist das Thema des Films? Wer reist nach Berlin und warum? Wie wirkt sich der Tourismus auf das Leben der Berliner/-innen aus? Warum haben manche Berliner/-innen mit Touristen/-innen zunehmend ein Problem? Wodurch kommt dies im Film zum Ausdruck? 5. Welche Tourismusstrategie schlägst du Berlin vor? Begründen Sie. . . . . . . . . . . 5 Quelle: Birgit Henökl-Mbwisi, Hildegard Hefel. (2015) Welcome-Goodbye DVD Fernweh. Filme für eine Welt. Education 21 DVD-Ausleihe oder Stream 25 4.2.3 Tourismus und Soziale Medien Abbildung 8: Wanaka Baum. Auftrag 1: Welchen Einfluss haben die sozialen Medien auf eure Wahl der Feriendestination? . . . . . . . . . . . . Abbildung 9: Sehenswürdigkeiten nach Anzahl Instagram Bilder. Auftrag 2: Welche Vorteile bringt Instagram für den Tourismus? 26 . . . . . . Auftrag 3: Beurteilt die Aussage „Instagram ist für den Tourismus: Fluch und Segen. Ergänzt die Erläuterung mit Beispielen aus den folgenden Artikeln und Videos. Indonesisches Dorf Apokalypse Instagram Instagram und Natur 27 4.3 Exkurs Overtourism Abbildung 10: Überfüllte Hafenpromenade in Santorini, Griechenland Als Übertourismus oder „Overtourism wird eine Entwicklung im Tourismus bezeichnet, die das Entstehen von offen zutage tretenden Konflikten zwischen Einheimischen und Besuchern an stark besuchten Zielen zum Gegenstand hat. Aus Sicht der Einheimischen werden Touristen zu einem Störfaktor, der das tägliche Leben vor Ort zunehmend belastet; auch die Besucher selbst können die hohe Zahl der sie umgebenden Touristen als störend empfinden. „Overtourism wird auch als Steigerung des Massentourismus bezeichnet. 6 Ursachen: . . Auftrag: Diskutiert wie eine touristische Destination gegen Overtourism vorgehen kann. Notiert Massnahmen und beurteilt deren Nachhaltigkeit. . . 6 28