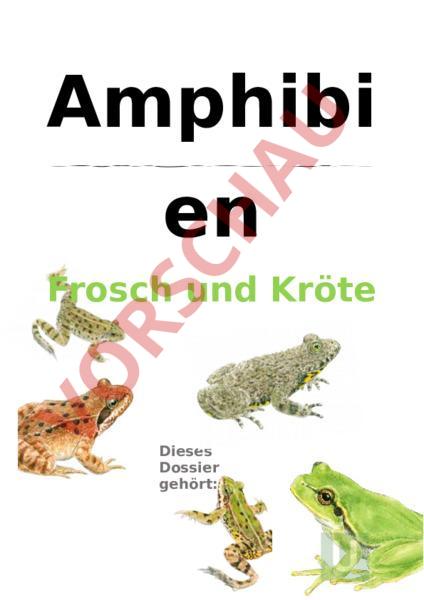Arbeitsblatt: Dossier Amphibien
Material-Details
Dossier über Amphibien für die 5. Klasse
Dauer: ungefähr 5 Wochen
Biologie
Tiere
5. Schuljahr
40 Seiten
Statistik
212505
34
3
27.03.2025
Autor/in
Lea Spreiter
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Amphibi en Frosch und Kröte Dieses Dossier gehört: Inhaltsverzeichnis 1 Amphibien in der Schweiz3 2 Wer gehört zu wem?4 3 Lurche Leben zwischen den Elementen.5 4 Häufigste Froschlurche in der Schweiz.6 5 Das macht uns so einzigartig!9 6 Unterschiede Frosch und Kröte12 7 Der Alltag des Grasfrosches.13 8 Beutefang des Frosches.15 9 Die Entwicklung des Grasfrosches17 10 Metamorphose19 11 Körperbau. 21 12 Körperbau. 24 13 Lebensraum des Frosches26 14 Amphibienschutz.31 15 Repetition.38 2 1 Amphibien in der Schweiz Das Wort Amphibien kommt aus dem Griechischen und bedeutet doppellebig. Das liegt daran, dass die meisten Jungtiere im Wasser leben und wie Fische durch Kiemen atmen. Wenn sie älter werden, bewegen sich Amphibien an Land und auch an Wasser. Dann atmen sie wie Menschen durch Lungen und auch durch die Haut. In der Schweiz leben 20 Amphibienarten in Flach- und Hochmooren, Weihern, Bächen oder Tümpeln. Die Amphibien führen ein Doppelleben, denn sie brauchen nicht nur das Wasser, sondern man findet sie während eines Grossteils ihres Lebens an Land. Die Lebensraumansprüche können von Art zu Art sehr unterschiedlich sein. So verbringt ein Grasfrosch sein Larvenstadium in einem Weiher. Die ausgewachsenen Tiere leben in nahegelegenen Waldrändern und Hecken und kehren nur zur Fortpflanzung in die Gewässer zurück. Die Geburtshelferkröte ist in Bezug auf ihren Landlebensraum wählerischer; diese Tiere besiedeln strukturreiche, sonnenexponierte und vegetationsarme Böschungen mit Boden, in welchem es sich gut graben lässt. Solche Standorte gibt es heute nur noch wenige. Seit 1966 werden im Natur- und Heimatschutzgesetz des Bundes alle Amphibien geschützt. Nicht nur die Tierarten stehen unter Schutz, sondern auch ihre Lebensräume. Trotz diesem weitreichenden Schutz verkleinern sich die Laichplätze, Sommer- und Winterquartiere von Fröschen und Kröten oder sie verschwinden schleichend. Aber auch die Populationen schrumpfen: 14 der 20 Amphibienarten sind stark bedroht und stehen auf der roten Liste der gefährdeten Amphibienarten in der Schweiz. 3 2 Wer gehört zu wem? 4 3 Lurche Leben zwischen den Elementen Lurche sind sogenannte «Feuchttiere». Das bedeutet, sie brauchen zum Leben eine hohe Luftfeuchtigkeit. Daher findet man Lurche in oder am Wasser (Teich, See, Bach) in feuchten und dunklen Erdlöchern und im Waldboden, in Moospolstern und unter Baumstämmen. Viele Lurche kommen erst heraus, wenn es dunkel und nebelig ist oder wenn es regnet, da ihre Haut schnell austrocknet. Ausserdem sind Lurche wechselwarme Tiere. Das bedeutet, ihre Körpertemperatur hat immer die gleiche Temperatur wie die Aussentemperatur. Ist es draussen 10 C, so hat der Lurch auch eine Körpertemperatur von 10C. Lurche besitzen eine feuchte, nackte drüsenreiche Haut, die Schleim absondern kann. Manche Lurche können auch Gift über ihre Haut abgeben (Feuersalamander). Lurche haben keine Schuppen oder Haare. Sie haben alle gut entwickelte Gliedmassen mit 4 oder 5 Zehen und ein Skelett. Sie besitzen jedoch keine Zähne. Amphibien durchlaufen eine Entwicklung (Metamorphose) von der Larve zum erwachsenen Tier. Als Larve erfolgt die Atmung über die Kiemen, im Erwachsenenstadium über die Lungen. Lurche nehmen einen geringen Teil des Sauerstoffes über die Haut auf. Notiere fünf Merkmale zu den Lurchen (Amphibien): 5 4 Häufigste Froschlurche in der Schweiz Versuche die Bilder anhand der Beschreibungen zuzuordnen. Den Bergmolch kann man gut an seiner orangeroten Unterseite erkennen. Seine Oberseite ist schiefergrau oder bläulich. Seitlich am Körper hat er kleine schwarze Flecken auf weis-sem Grund und das Männchen hat zudem einen blauen Streifen. Der Bergmolch laicht von Mitte März bis Ende Mai. Die grösste einheimische Kröte, die Erdkröte, ist einfarbig graubraun, die Unterseite ist heller. Die Haut ist am ganzen Körper mit Warzen übersät. Die Erdkröte hat hinter den Augen wulstige Drüsen, aus denen sie eine giftige Flüssigkeit absondern kann. Sie wandert Ende Februar bis März zu ihrem Laichgewässer. Die Geburtshelferkröte ist graubraun gefärbt und trägt kleine rundliche Warzen am ganzen Körper. Ihre Pupillen stehen senkrecht. Das Männchen wickelt sich die Laichschnüre um die Hinterbeine. Kurz bevor die Kaulquappen schlüpfen, steigt das Männchen ins seichte Wasser und setzt die Laichschnüre ab. Der Grasfrosch ist bräunlich wie Lehm und hat schwarze Flecken am ganzen Körper. Er hält sich meistens an Land auf und beginnt schon Anfang Februar mit seinem schwachen Quaken auf „Brautschau zu gehen. Das Weibchen legt bis zu 4000 Eier ab, die als Laichballen an der Wasseroberfläche schwimmen. 6 Der Alpensalamander hat eine lackschwarze Oberseite. Durch seine bleigraue Unterseite verläuft eine Längsrinne bis zum Schwanz. Die hervorstehenden Ohrdrüsen und die markanten Augen sind gut zu erkennen. Abhängig von Wetter- und Temperaturbedingungen sind sie im Spätfrühling bis Frühsommer balzaktiv. Der Kammmolch ist der grösste einheimische Molch. Schwanz- und Oberseite sind grauschwarz. Er hat einen orangefarbenen Bauch mit kleinen schwarzen Flecken. Kurz vor der Paarungszeit (Februar bis Mai) bildet das Männchen einen hohen gezackten Kamm aus. Zwischen Rücken und Schwanz hat der Kamm einen Einschnitt. Die Gelbbauchunke ist graubraun gefärbt. Sie hat einen leuchtend gelben Bauch mit schwarzen Flecken. Die Pupillen sind herzförmig. Daran kann man Unken gut erkennen. Die Gelbbauchunke laicht zwischen Mai und Juli. Der Feuersalamander ist an seiner Färbung sehr leicht zu erkennen. Er hat eine schwarze Haut mit leuchtend gelben oder orangefarbenen Flecken oder Längsstreifen. Im Gegensatz zu den Molchen haben Salamander einen dicken, runden Schwanz. 7 Der Teichfrosch kann hellgrün, dunkelgrün und bräunlich gefärbt sein. Er hat schwarze Tupfen auf dem Rücken und an den Beinen. Er besitzt keinen dunklen Schläfenfleck. Der Teichfrosch fängt seine Beute im Sprung oder durch schnelles Zuschnappen. Während der Paarungszeit im Mai bis Juni rufen die Männchen Tag und Nacht, um die Weibchen anzulocken. Der grüne Laubfrosch hat einen schwarzen Streifen an der Seite, der bis über die Augen geht. Er ist der einzige Frosch bei uns, der klettern kann, was durch die Haftscheiben an den Zehen ermöglicht wird. Während der Laichzeit (März/April) steigen die Männchen ins Wasser und versuchen die Weibchen durch ihren Gesang anzulocken. Der Teichmolch hat einen schmalen Kopf und ist beigebraun gefärbt. Das Männchen hat schwarze Flecken am Körper und am Kopf Längsstreifen. Der männliche Teichmolch bildet während der Paarungszeit (April bis Mai) einen gebuchteten Kamm aus. Die untere Schwanzspitze ist beim Männchen oft bläulich. Die Wechselkröte hat eine meist hellbraune Haut mit grünen Flecken. Die Warzen an der Bauchseite sind oft rot getupft. Die Wechselkröte erträgt von allen Kröten die Trockenheit am Besten. Deshalb findet man sie auch in Kiesgruben, Stein-brüchen und auf sandigen Äckern. Die Wechsel-kröte laicht zwischen April und Juni. 8 5 Das macht uns so einzigartig! Frösche und Kröten haben einen kompakten und kräftigen Körper. Die Hinterbeine sind vor allem bei den Fröschen auffallend lang und kräftiger als die Vorderbeine. Atmen Sehen 9 Hören Fressen Fortbewegen 10 Hö Quaken Tarnen und abwehren 11 6 Unterschiede Frosch und Kröte Betrachte die beiden Bilder ganz genau. Oben sitzt ein Frosch und unten eine Kröte. Wie unterscheiden sich (Durchsuche das Dossier nach Informationen) 12 die beiden Tiere? 7 Der Alltag des Grasfrosches Übermale die wichtigsten Informationen mit einem Farbstift/Leuchtstift. Im Sommer lebt der Grasfrosch in Laub- und Mischwäldern und feuchten Wiesen in der weiteren Umgebung eines Gewässers. Tagsüber hält sich der Grasfrosch in seinem Versteck auf und jagt erst bei Einbruch der Dämmerung Spinnen, Regenwürmer, Nacktschnecken und Insekten. Wenn er zum Beispiel eine Fliege erblickt, springt er mit einem gewaltigen Satz auf sie zu. Gleichzeitig schnellt er seine Zunge aus dem Maul. Diese ist mit einem klebrigen Schleim überzogen. Wenn der Grasfrosch die Fliege trifft, umrollt er sie mit der Zunge. Das angeklebte und eingeklemmte Opfer zieht er dann ins Maul. Für Störche und Reiher ist der Grasfrosch ein gefundenes Fressen, ein junger Frosch auch für Igel und Mäuse. Auf der Flucht vor seinen Feinden kann sich der Grasfrosch mit einem kräftigen Sprung ins Wasser retten. Dort kann er minutenlang untergetaucht verharren, bis die Gefahr vorüber ist. Suche den Grasfrosch im Bild und beschreibe was er gerade macht. 13 Unter Wasser nimmt der Grasfrosch den notwendigen Sauerstoff nicht ü ber die Lunge auf. Er verfügt zwar über keine Kiemen, aber bei seinen langen Tauchgängen kann der Grasfrosch über die Haut ausreichend Sauerstoff aufnehmen (Hautatmung). Im Herbst sucht sich der Grasfrosch ein vor Frost geschütztes Winterquartier. Meist gräbt er sich mehrere Zentimeter tief in den Schlamm kleinerer Gewässer ein. Der Grasfrosch gehört zu den wechselwarmen Tieren. Sein Körper nimmt also immer die Umgebungstemperatur an. Sinkt die Aussentemperatur, fällt der Grasfrosch wie die Erdkröte in eine Kältestarre. Dabei ist es für ihn lebensnotwendig, dass die Temperatur in seinem Winterquartier nicht unter 5 C absinkt. Sonst würde er erfrieren. Der Grasfrosch hat eine bräunliche Färbung mit schwarzen Flecken am ganzen Körper. Charakteristisch ist auch der dunkle, längliche Fleck hinter den Augen. Im Gegensatz zur Erdkröte hat seine Haut keine Warzen. Ordne die Tiere aus dem Text einer der folgenden Gruppen zu: Beutetiere des Grasfrosches: Feinde des Grasfrosches: Wie verbringt der Grasfrosch den Winter? 14 8 Beutefang des Frosches Beschreibe wie der Frosch seine Beute fängt. Was frisst der Frosch? Zähle sechs Sachen auf. Benenne die Gelenke 1 bis 5. 1. 4. 2. 5. 15 3. 16 9 Die Entwicklung des Grasfrosches Ende Februar, Anfang März suchen die Grasfrösche ihr Laichgewässer auf. Die Männchen machen mit die Weibchen auf sich aufmerksam. Trifft ein Männchen auf ein Weibchen, so klammert es sich an ihm fest. Das Weibchen trägt das kleinere Männchen auf dem. Das Weibchen legt 3000- im Wasser 4000 ab. Eier Die in Froscheier sind von einer gallertartigen Eiweisshülle umgeben. Das Männchen gibt gleichzeitig seine (Samenzellen) dazu. Diese durchdringen die Gallerthülle und befruchten die Eier. Aus den schwarzen, stecknadelkopfgrossen Eiern entwickeln sich die Larven. Nach etwa drei Wochen schlüpfen die Larven. Sie heissen auch. Die gleichen dem Frosch nicht. An beiden Seiten des Kopfes sitzen fadenartige Aussenkiemen. Damit können die Kaulquappen im Wasser. Sie haben noch keine Beine und schwimmen mit Hilfe ihres Ruderschwanzes. Mit ihren Hornzähen raspeln die Kaulquappen Algen an Steinen und Wasserpflanzen ab. Die Aussenkiemen werden von einer Hautfalte . So entstehen die Innenkiemen. Den Kaulquappen wachsen Hinterbeine. Nach den Hinterbeinen bilden sich die Vorderbeine aus. Die entwickeln sich und bald sind die Beine ausgewachsen. Dann bilden sich Kiemen und Ruderschwanz zurück. Im Juni verlassen die das Laichgewässer. Sie können jetzt nicht mehr nur im Wasser leben. Sie atmen durch die Haut und Lungen und suchen ihre Nahrung in feuchten und Wäldern. Die Umwandlung der Kaulquappe Monate. Man zum Frosch dauert etwa nennt diesen Prozess auch . Im Alter von 2,5 Jahren laichen die Frösche erstmals ab. Dabei suchen sie meistens das Laichgewässer aus, in dem sie aufgewachsen sind. 17 Jungfrösche, überwachsen, Kaulquappen, Lungen, drei, Spermien, Rücken, Metamorphose, Laichballen, atmen, Paarungsrufen, Wiesen 18 10 Metamorphose Klebe das passende Bild vom Zusatzblatt oberhalb des entsprechenden Stichwortes in den Kreislauf. Male anschliessend die Bilder sauber und sorgfältig aus. 1 Paarung, Laichballen 2 Frühes Larvenstadium 8 „Teichflucht 3 Aussenkiemen 7 Lungen, Wachstum 4 Innenkiemen 6 Vorderbeine 5 Hinterbeine 19 10 Metamorphose Beschreibe die einzelnen Schritte der Metamorphose in deinen eigenen Worten. Als Anhaltspunkt kannst du die Nummern auf dem Kreislauf verwenden. 20 11 Körperbau 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Setze folgende Wörter ein: Auge – Darmausgang Kiemen Darm Mund Körper Schwimmflosse Schwimmmuskel Setze folgende Wörter ein: Auge Bauch Hinterbein Rücken Schwimmhäute Trommelfell Vorderbein Vorderfuss 21 22 10 Körperbau Dir ist mittlerweile klar, dass sich Kaulquappen und Frosch stark unterscheiden. Das macht die Metamorphose der Tiere so faszinierend! Lies den Text in den Infoboxen. Errätst du, welcher Körperteil gemeint ist? Schreibe die Körperteile aus der Liste zu den Boxen! Mund mit Hornzähnen Schallblase Saugnäpfe verschliessbares Nasenloch Flossensaum Schwimmhäute Kiemen Sprungbeine Dieses Organ nutzen die Kaulquappen zur Atmung. Erst sind sie als kleine Büschel aussen zu sehen, werden dann aber von Haut Die scharfen Zähne helfen den Kaulquappen, Algen von Steinen und Wasserpflanzen abzunagen. überwachsen und sind nur noch als kleine Höhlen wahrnehmbar. Da ein Frosch sich nicht die Nase zuhalten kann, hat die Natur anders für einen Verschluss Ohne diesen Körperteil könnte sich die gesorgt. Dieser ist bei männlichen Fröschen Kaulquappe nicht so schnell fortbewegen. Er wichtig, wenn sie Quaken. Die Luft muss erst hilft ihr, schnell und wendig durch das Wasser zurückgehalten zu gleiten. Auch beim Tauchen ist es vorteilhaft, wenn werden. kein Wasser in die Nase dringt. Frösche hüpfen. Dies können sie dank verlängerter Fussknochen und Beinen, die im Verhältnis zur Körpergrösse lang und kräftig sind. Im Unterschied zum Frosch sind aber die Beine von Kröten zum Laufen gedacht: sie sind kürzer im Verhältnis zum Körper. Die männlichen Frösche nutzen dieses Organ, um ein Weibchen anzulocken. Mit seiner Hilfe quaken sie laut. Es dient als eine Art Verstärker, wenn das Männchen Luft durch seine Je nach Nasenlöcher Art befinden sich ausstösst. zwei seitlich (Wasserfrosch) oder eine unterhalb des Mauls (Laubfrosch) 23 Vor allem Tropenfrösche halten sich gerne an Ästen fest. Dies gelingt ihnen dank diesen kleinen «Helfern» an ihren Fingern und Zehen. Sie machen Frösche zu wahren Diese ermöglichen dem Frosch ein schnelles 12 Körperbau Ordne die Begriffe zu: Kaulquappe oder Frosch? Schreibe in die richtigen Spalten. • lebt im Wasser und auf dem Land • frisst Pflanzen (Algen) • lebt ganz im Wasser • frisst Fleisch (Insekten) • atmet durch Kiemen • sieht aus wie ein Fisch • atmet mit den Lungen, durch die • ist ein Vierbeiner Haut und die Mundhöhle • besitzt Sprungbeine • hat Füsse mit Schwimmhäuten • bewegt sich mit dem Schwanz, der einen Flossensaum hat Kaulquappe 24 • Augen ohne Augenlid • Augen mit Augenlid • dünne, durchsichtige Haut • farbige, undurchsichtige Haut Frosch 25 13 Lebensraum des Frosches Lies den Text. Er beschreibt die verschiedenen Lebensräume von Amphibien am Beispiel der Erdkröte. Übermale alle Orte, an denen man Amphibien finden kann, mit einem Leuchtstift. Frühling Bereits Ende Februar/Anfang März erwachen die Erdkröten aus ihrer rund fünfmonatigen Winterruhe. Die Temperaturen liegen bei etwa 5 Grad und das Wetter ist feuchtnass. Die Distanz zwischen Winterquartier und Laichplatz an einem Gewässer kann bis zu 2 km betragen. Der Weg zwischen den verschiedenen Quartieren ist heute durch uns Menschen stark gestört. Die Wanderung von einem Lebensraum zum anderen ist für viele Frösche und Kröten eine Reise in den Tod. Stark befahrene Strassen oder Schächte sind Todesfallen und landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Äcker bieten keinen Schutz vor Feinden. Sommer Nach dem Ablaichen wandern die Weibchen ins Sommerquartier. Die Männchen bleiben noch einige Wochen am Laichplatz und wechseln erst dann ins Sommerquartier. Dieses kann eine Hecke, ein Waldrand oder ein Gebüsch sein. Aber auch ein Garten mit Ast- oder Laubhaufen ist für die Amphibien ein geeigneter Ort. Trockensteinmauern oder Steinhaufen sind ebenfalls beliebte Verstecke. Die Sommerquartiere können ganz verschieden aussehen. Es muss jedoch ausreichend feucht sein und genügend Möglichkeiten bieten, sich zu verstecken und tagsüber Unterschlupf zu finden. Denn Amphibien stehen bei verschiedenen Tierarten auf dem Speiseplan: Graureiher, Eule, Greifvogel, Fuchs, Iltis, Dachs, Igel oder Ratte. Herbst/Winter Die Winterquartiere der Amphibien gestalten sich ebenfalls sehr unterschiedlich. Die einen Tiere suchen sich in einem Erdloch, unter Laub, Moos, Steinen, einem Baumstrunk oder in kleinen Höhlen ein Versteck und 26 verbringen dort die Winterruhe. Andere Arten kehren bereits im Spätherbst wieder an das Laichgewässer zurück. Bis Ende Oktober/Anfang November können Amphibien auf ihren Herbstwanderungen beobachtet werden. Auch dann sind sie wieder vielen Gefahren ausgesetzt. Tiere, die im Wasser überwintern, suchen sich eine sauerstoffreiche Stelle im Teich, z.B. beim Ein- oder Abfluss des Weihers. Während der Winterruhe erfolgt die Atmung über die Haut und alle Körperfunktionen sind reduziert. Die Tiere sind dann eher schwerfällig und träge, aber keineswegs starr. Selbst bei Temperaturen von wenigen Graden können sich die Amphibien bewegen und nehmen die Umgebung mit ihren Sinnesorganen wahr. In der Regel nehmen sie keine Nahrung auf, sondern zehren von ihren Fettreserven, die sie während der warmen Jahreszeit angesetzt haben. 27 Landschaft im Jahre 1950 In diesem natürlichen Lebensraum fühlen sich die Frösche und Kröten wohl. Male diejenigen Orte farbig (naturgetreu) aus, wo es den Amphibien besonders gut gefällt. Nummeriere sie folgendermassen mit grüner Farbe: 1 Steinhaufen 6 Hecke 2 Asthaufen 7 Tümpel 3 Trockensteinmauer 8 Totholz 4 Flussaue (Uferlandschaft eines 9 Weiher Flusses) 10 Wassergefüllte Radspuren (z.B. 5 Auenwald (Waldgebiet in der von einem Traktor) Nähe 11 Kiesgruben eines Flusses, das regelmässig überschwemmt wird) Beschreibe, wo sich Frösche besonders wohl fühlen. 28 Landschaft heute Die Landschaft hat sich stark verändert. Es wurden Häuser und Strassen gebaut. Die Frösche und Kröten können nicht mehr ungestört auf Wanderschaft gehen. Male die Hindernisse und Gefahren, die du im Bild findest farbig aus (naturgetreu). Nummeriere sie folgendermassen mit roter Farbe: 1 Verkehr/Lastwagen 6 Zaun 2 Kanalisierter Fluss 7 Schattiger Weiher 3 Betonmauer 8 Fressfeinde der Eier und Larven 4 Abflussschacht 9 landwirtschaftlich genutzte Wiesen 5 Breite, geteerte Strassen 10 Fabriken 11 Autobahn Beschreibe, wo Frösche besonders gefährdet sind. 29 30 14 Amphibienschutz Lies genau und übermale die wichtigsten Stichworte farbig! Unsere einheimischen Amphibien sind bedroht. Tierschützer sind sich einig: Um die Amphibien wirksam zu schützen, müssen für sie auch genügend Lebensräume gesichert werden. Wichtige Punkte zum Schutz von Amphibien 1. Lebensräume von Amphibien sind nach Möglichkeit zu erhalten, vor allem Feuchtgebiete. Wo das – zum Beispiel wegen einem Bauvorhaben – nicht möglich ist, sollen gleichwertige Ersatz-Lebensräume geschaffen werden. 2. Das gleiche gilt für Rückzugsgebiete wie Kiesgruben und feuchtes Ödland. Solche Gebiete sind nach Möglichkeit zu erhalten oder es sind gleichwertige Ersatzbiotope zu schaffen. 3. Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln ist darauf zu achten, dass keine solchen Fremdstoffe in der Nähe von AmphibienLebensräumen ausgebracht werden und dass keine solchen Stoffe in ein Gewässer gelangen. 4. Ein besonderes Problem stellt der Strassenverkehr dar: Strassen zerschneiden Lebensräume und bei den jährlichen Wanderungen werden die Amphibien in grossen Mengen überfahren. Wie dies vermieden werden kann, liest du auf der nächsten Seite unter „Schutzzäune und „Tunnelröhren. 5. Auch ganz persönlich kann man zum Schutz von Amphibien beitragen, indem man die Tiere ganz einfach in Ruhe lässt. Sie haben das gleiche Lebensrecht wie andere Tiere auch. Man darf sie nicht quälen, nicht mit ihnen spielen und sie nicht verscheuchen. Wenn man Kaulquappen einfängt. um zu Hause ihre Entwicklung zu beobachten, braucht es dazu die Begleitung von Erwachsenen. Man muss sich gut um die Tiere kümmern. Sobald sie das Wasser verlassen, muss man sie unbedingt dort, wo man sie eingefangen hat, wieder aussetzen. Alle Amphibien stehen unter Naturschutz! Rote Liste 31 In der Schweiz kommen 21 Amphibienarten vor. 14 Arten (67%) stehen auf der Roten Liste des Bundesamtes für Umwelt 2005. Diese Liste gibt Auskunft über gefährdete Pflanzen- und Tierarten. Folgende Amphibien sind in der Schweiz gefährdet oder stehen hier kurz vor dem Aussterben: Nicht gefährdet: • Alpensalamander • Bergmolch • Grasfrosch • Seefrosch • Wasserfrosch (in Tieflagen) Ungenügende Daten Schutzzäune anlegen An Strassenabschnitten, wo die Kröten, Grasfrösche und Molche auf ihrer Wanderung die Fahrbahn überqueren, helfen Schutzzäune. Direkt vor diesen Zäunen werden grosse Wassereimer eingegraben. Wenn nun die wandernden Tiere an den Strassenrand kommen, werden sie durch die Schutzzäune zurückgehalten. Die Tiere laufen dann dem Zaun entlang und fallen in die eingegrabenen Eimer, aus denen sie nicht mehr herauskönnen. Die Eimer müssen während der Laichzeit regelmässig nachts und morgens kontrolliert werden. Die darin sitzenden Amphibien werden auf die andere Strassenseite getragen und dort freigelassen. Tunnelröhren Ein anderes System sind Tunnelröhren, die unter der Strasse durchführen. Die Amphibien werden dann durch die Schutzzäune zu den Röhren geleitet und wandern selbstständig und sicher durch die „Krötentunnel auf die andere Strassenseite. Neue Feuchtgebiete schaffen Überall dort, wo natürliche Feuchtgebiete und Laichgewässer in der Landschaft beseitigt wurden, helfen neue Teiche, Weiher und Seen für Amphibien. Am besten ist es, wenn Tiere und Pflanzen dort völlig ungestört leben können. 32 Lebensräume in der nahen Umgebung und im eigenen Garten schaffen Wichtig ist es, wenn immer möglich Gräben, Wasserlöcher und Tümpel nicht mehr einfach zuzuschütten, sondern zu erhalten. In ihnen legen nämlich Frösche, Molche und Kröten ihre Eier ab. Im Garten kann man leicht geeignete Lebensräume für Amphibien schaffen. Es genügt, einige Stellen des Gartens etwas verwildern zu lassen, so dass Kräuter, Gras, Stauden und Büsche durcheinander wachsen. Hier werden zum Beispiel Erdkröten schnell heimisch und fangen bei ihren nächtlichen Streifzügen viele Schnecken auf den Gemüsebeeten. Auf jeden Fall muss man aber auf das Spritzen von Insekten- und Schneckengiften verzichten. Sonst fressen die Amphibien die vergifteten Tiere und sterben daran. Relativ einfach lassen sich auch auf engem Raum kleine Gartenteiche anlegen, in denen Grasfrösche, Molche und Kröten ablaichen. Freizeitverhalten unter die Lupe nehmen Bei unseren Freizeitaktivitäten gilt es, Naturschutzzonen zu beachten und zu respektieren. An den meisten Seen findet man ausgedehnte Campingplätze mit Bootsverleih und Surfschulen. Es ist wichtig, sich bei seinen Aktivitäten an die vorgegebenen Räume zu halten und naturbelassene Gebiete in Ruhe zu lassen. Suche dir eine Schutzmassnahme aus und versuche diese so detailliert wie möglich zu zeichnen. 33 Vorsicht Autofahrer! Alle Autofahrer können dazu beitragen, dass auf unseren Strassen weniger Lurche überfahren werden. Vor allem während der Laichzeit von Februar bis Mai sollten sie in der Dämmerung und nachts besonders vorsichtig fahren. In der Nähe von Feuchtgebieten sollten sie darauf achten, ob auf der Fahrbahn Frösche oder Kröten sitzen. Pressestimmen zum Amphibienrückgang „Bald gibt es den Frosch nur noch im Märchen „Auf dem Weg zu den Laichplätzen: Tausendfacher Tod auf den Strassen „Feuchtgebiete sind wichtige Lebensräume „Rettet den Dorfteich „Forstleute unterstützen den Amphibienschutz „Neuer Lebensraum für bedrohte Amphibien Welchen Artikel würdest du als erstes lesen? Übermale ihn grün. Erfinde einen eigenen Titel, der auf die Gefährdung der Amphibien aufmerksam macht. Was würdest du in die Zeitung, ins Internet schreiben? 34 Natürliche Feinde und Gefährdungsfaktoren für Amphibien 1 2 4 3 6 5 8 7 9 10 11 12 Beantworte die Aufgaben auf der nächsten Seite. Nummeriere deine Anworten. 1. Erkennst du alle Gefahren? Notiere sie. Welche Bilder betreffen natürliche Feinde? Übermale sie grün. 2. Von welchen natürlichen Feinden sind vor allem die Larven (Laich, Kaulquappen) betroffen, von welchen die erwachsenen Tiere? 3. Wie lassen sich die Gefährdungen durch den Menschen begrenzen? 4. Welche Gründe hat ein Naturschützer, um Amphibien zu schützen? Notiere 3-4 Ideen! 5. Nicht alle Menschen sind dafür, Amphibien zu schützen und die erwähnten Massnahmen umzusetzen. Wer könnte gegen die Massnahmen zum Amphibienschutz sein? Weshalb? Notiere auch hier 3-4 Ideen! 35 6. Was ist deine persönliche Meinung? Erkläre und begründe! 36 37 15 Repetition Jetzt bist du Amphibien-Experte. Schaffst du es bis ins Ziel? Löse die Aufgaben der Reihe nach auf den nächsten Seiten. Schreibe als Titel jeweils die Aufgabennummer (z.B. Aufgabe 1). Male die Kästchen farbig aus, wenn du die Aufgabe geschafft hast. 1. Male 5 Tiere farbig, die ein Frosch frisst. 2. Notiere 5 Merkmale, die für Amphibien typisch 3. Was unterscheidet sind. Schwanz- und Froschlurche? Erkläre kurz. 4. Schneide den Frosch und die Kaulquappe vom Zusatzblatt aus und beschrifte beide mit den passenden Körperteilen. 5. Beschreibe, wie der Frosch seine Beute fängt. 6. Wie entwickelt sich ein Frosch? Klebe die Bilder in der richtigen Reihenfolge und beschreibe die 7. Notiere alle Schritte. einzelnen Geschaff Feinde und t! Gefahren für 8. Beschreibe, Frösche. wie du Amphibien 9. Notiere in einer schützen Tabelle die Unterschiede kannst. zwischen Kaulquappe und Frosch zu folgenden Punkten: Lebensraum Atmen 38 Nahrung Fortbewegung 39 40 41 42 Wahr oder falsch? Nr Frage Wahr Falsch 1 Frösche, Kröten und Unken gehören zu den Froschlurchen. 2 Die Verwandlung von der Kaulquappe zum Frosch nennt man Metamorphose. 3 Frösche und Kröten gehören zu den Reptilien. 4 Durch lange Brutpflege, überleben die meisten Kaulquappen. 5 Frösche fangen ihre Beute mit ihrer langen klebrigen Zunge. 6 Die Eier der Frösche werden auch Laich genannt. 7 Kröten verbringen ihr ganzes Leben im Wasser. 8 Die Männchen der Frösche sind meist kleiner als die Weibchen. 9 Zuerst sprühen die Männchen ihren Samen ins Wasser, darauf legen die Weibchen ihren Laich ab. Frösche atmen durch ihre lange Nase. 10 Sind diese Aussagen wahr oder falsch? Kreuze an. 43 Buchstabensalat Finde die 10 Wörter in dem Buchstabengitter, kreise sie mit Farbe ein. Viel Erfolg! Frosch, Kaulquappe, Teich, Zunge, Insekten, Lurch, Kröte, Metamorphose, Sprung, Quaken G D G U K N E D T E K F E W F L H D T U Z E G E Z Z Q R M Y S G F R A B M Q L E V U F W L K F F B S Z C F W W J R R Ü U V G Ü Q P X D R O D V Ö U N F E X D B U P A I O D R H Ö S S D J E T C R Ö E D Q C N Ö E R T E R Z H X H F R Z H Z D 44 W R H F N E T N S T G R F Z J U A G W G D C G B E F O C D 45 Wo gehts zum Teich? Welchen Weg muss «Fritzi» gehen, um zum Teich zu gelangen? 46 Labyrinth Wie können die beiden Frösche zueinander finden? 47