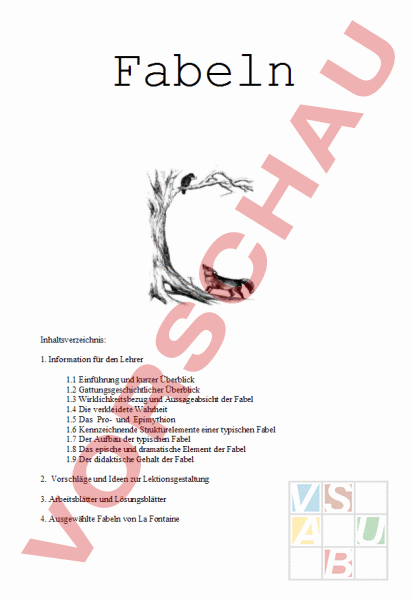Arbeitsblatt: Fabelbuch
Material-Details
Umfassende Theorie für Lehrer, Theorie und Abreitsblätter mit Lösungen für Schüler
Deutsch
Leseförderung / Literatur
7. Schuljahr
40 Seiten
Statistik
22179
2024
49
14.07.2008
Autor/in
Andrea Caroline Mülhaupt
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Fabeln Inhaltsverzeichnis: 1. Information für den Lehrer 1.1 Einführung und kurzer Überblick 1.2 Gattungsgeschichtlicher Überblick 1.3 Wirklichkeitsbezug und Aussageabsicht der Fabel 1.4 Die verkleidete Wahrheit 1.5 Das Pro- und Epimythion 1.6 Kennzeichnende Strukturelemente einer typischen Fabel 1.7 Der Aufbau der typischen Fabel 1.8 Das epische und dramatische Element der Fabel 1.9 Der didaktische Gehalt der Fabel 2. Vorschläge und Ideen zur Lektionsgestaltung 3. Arbeitsblätter und Lösungsblätter 4. Ausgewählte Fabeln von La Fontaine 1. Information für den Lehrer 1.1 Einführung und kurzer Überblick Gegenstand dieser Ausführungen ist die rund zweieinhalbtausend Jahre alte Literaturgattung der Fabel. Der Begriff „Fabel geht auf das lateinische Wort fabula (Geschichte, Erzählung, Gespräch) zurück und bezeichnet heute die typische Art der Tierdichtung in Vers oder Prosa, die eine allgemein anerkannte Wahrheit, einen moralischen Lehrsatz oder eine praktische Lebensweisheit anhand eines pointierten, doch analogen Beispiels in uneigentlicher Darstellung veranschaulicht und besonders durch die Übertragung menschlicher Verhaltensweisen, sozialer Zustände oder politischer Vorgänge auf die belebte oder unbelebte Natur witzig-satirische oder moralisch belehrende Effekte erzielt. (1) (Vgl. Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur. Stuttgart) 1.2 Gattungsgeschichtlicher Überblick Die Frage nach dem Ursprungsland der Fabel ist umstritten. In der Fachliteratur werden häufig Indien und Griechenland, aber auch Ägypten und Babylonien genannt. Untersuchungen zur „Genese der Fabel führen jedoch zu der Annahme, dass die Fabel als eine „Urform unserer Geistesbetätigung in verschiedenen Regionen unabhängig voneinander entstanden ist. Gleiche Voraussetzungen etwa die in allen Gebieten im wesentlichen gleiche soziale Gliederung in Herren und Knechte und die Spannungen, die zwischen beiden Schichten herrschten haben zur Ausprägung gleicher sozialkritischer Intentionen und zur Ausbildung nahezu gleicher sprachlicher Formen geführt. Die ältesten überlieferten Fabeln stammen u. a. von Hesoid (um 700 v. Chr.) und Archilochos (um 650 v. Chr.). Der phrygische Sklave Aesop (um 550 vor Chr.) soll angeblich als erster Fabeln indischer und griechischer Herkunft gesammelt und aufgezeichnet haben. Dass sein Name untrennbar mit der Geschichte der Fabel verbunden ist, erklärt sich zum einen aus der großen Zahl und der Qualität seiner Fabeln, zum anderen aus der Tatsache, dass zahlreiche Fabeldichter späterer Zeiten auf die Fabeln Aesops zurückgreifen und seine Motive, sein Figureninventar, seine Kompositionsprinzipien oft nur variieren. Typische Charakteristika der Fabeln Aesops sind: „klarer Aufbau, anschauliche Erfassung der Szene, behaglicher Ton der Gespräche, auf jener Elementarstufe geistiger Entwicklung, wo der Mensch noch ganz auf du und du mit Tier und Pflanze und aller Kreatur zu verkehren vermag (2). Die Fabeln Aesops wurden von Babrios in Versform umgedichtet, von Phaedrus (um 50 nach Chr.) unter Verstärkung des lehrhaften Elementes und später von Avianus um 400 nach Chr.) in lateinische Verse übertragen und schließlich in Prosa aufgelöst. Bereits bei Phaedrus hatte die Bezeichnung „Fabel die Qualität eines Gattungsbegriffs. Auf deutschem Boden wurde die Fabeldichtung innerhalb der lateinischen Klosterliteratur des Mittelalters gepflegt und weitergegeben. Der moralisch-didaktische Zweck und die lehrhaftsymbolische Bedeutung machten die Fabel zu einer geeigneten Erzählform für Predigten und Beispielsammlungen. Daher blühte diese literarische Art am stärksten in ausgeprägt rationalen Zeiten, die etwa aufklärerische oder gesellschaftlich umstrukturierende Tendenzen verfolgten. Im 16. Jahrhundert gedeiht die Fabel als agitatorische Kleinkunst der Reformationszeit. Insbesondere bei Erasmus Alberus und Burkhard Waldis dient die Fabel als Kampfmittel ihres religionspolitischen Kampfes gegen die katholische Kirche. Luther verhält sich in dieser Hinsicht zurückhaltender. Er nutzt die Fabel, um seine religiös-moralischen Ansichten zu veranschaulichen, denn er hat erkannt, dass theoretische Anweisungen zum ethisch-richtigen Handeln weniger überzeugen und bewirken als anschauliche Geschichten, in denen dem falsch Handelnden irgendein Schaden zustößt. Luther stellt die Fabel so bewusst in den Dienst seiner ethisch-moralischen Intentionen. Während die Fabeln des Burkhard Waldis und Erasmus Alberus eher abstrakt und episch breit erscheinen, zeichnen sich die Fabeln Luthers durch knappste Prosaformulierungen aus. Erzählung und Lehre werden klar getrennt: der Leser wird zum eigenen Mitdenken angeregt. Indem Luther weitgehend im bildlichen Bereich bleibt und abstrakte Formulierungen und Wendungen vermeidet, steigert er die Wirkung seiner Fabeln: „Der Leser wird nicht aus dem Erzählton gerissen, die Lehre überfordert ihn nicht durch eine ungewohnte Höhe der Abstraktion. (3) Es ist bezeichnend, dass die Reformationszeit mit ihrem unverhüllten Aufklärungscharakter und ihren eindeutig moralisch-didaktischen Tendenzen von der Fachliteratur so ausgiebig Gebrauch machte, während das Barockzeitalter seine Zeitkritik und seine satirischen Absichten in anderen literarischen Formen zum Ausdruck brachte. Eine eindeutige und wohl vorläufig letzte Hochblüte erlebte die Fabel im 18. Jahrhundert. Die Befreiung von der feudalherrschaftlichen Gesellschaftsordnung, sowie die geistige, soziale und politische Aufklärung, die zur Französischen Revolution führte, muss als Hintergrund für den Aufschwung der Fabel in dieser Epoche gesehen werden. Während La Fontaine deutlich Einfluss auf die Mehrheit der deutschen Fabeldichter wie Gellert, Gleim und Hagedorn ausübten, wandte sich Lessing entschieden gegen diese leichte, weitschweifige und ironischkritische Erzählweise. Die Fabel muss seines Erachtens epigrammatisch kurz sein. In den meisten seiner Fabeln führte Lessing die alte Tradition fort, indem er durch Kontamination von zwei bekannten Motiven oder durch Änderung einzelner Requisiten auf vorhandene Fabeln (z.B. Aesops oder Luthers) zurückgriff und so „neue Fabeln mit erweitertem oder verändertem Aussagegehalt schaffte. Dass die Fabel auch im 20. Jahrhundert nicht tot ist, wie oft in der Fachliteratur behauptet wird, beweisen die Fabelsammlungen von Helmut Arntzen, Rudolf Kirsten, Wolfdietrich Schnurre, James Thurber u.a. Ein auffälliges Merkmal der modernen Fabel ist die „Verbindung zwischen Tradition und Ironisierung und Infragestellung dieser Tradition (4), die besonders bei Helmut Arntzen deutlich wird. Während die Fabeln Rudolf Kirstens noch am ehesten die Tradition von Aesop und Lessing fortführen, stehen die Fabeln Wolfdietrich Schnurres, in denen es u.a. um „das braune Fell, um die unbewältigte Vergangenheit, um die Schuldfrage und um „die Möglichkeit, die Farbe genügend oft zu wechseln geht, vielfach in der Nähe des Aphorismus (5). Die „75 Fabeln für Zeitgenossen von James Thurber, in denen der Dichter mit humorvollgewürzter Moral typische Schwächen der modernen Gesellschaft und des Menschen aufzeigt, tendieren eher zur Satire und Ironie. Die Ironisierung und Infragestellung der Fabeltradition hat zu der These geführt, die moderne Fabel habe mit den „traditionellen Strukturformen der Gattung gebrochen; diese seien nicht mehr in der Lage gewesen, die politisch-gesellschaftliche Wirklichkeit der modernen Industriegesellschaft zu bewältigen (6). Doch gerade in unserer durch Massenmedien aufgeklärten und emanzipierten Gesellschaft erlebt die Fabel im Unterricht eine neue Renaissance, deren Ursachen in einem „geschärften Bewusstsein für den Zusammenhang von Text und Wirklichkeit (7) gesehen wird. (2) (3) (4) (5) (6) (7) Zitiert aus: Zitiert aus: Zitiert aus: Zitiert aus: Zitiert aus: Zitiert aus: R. Dithmar, Die Fabel, Paderborn 1974. S. 17 E. Leibfried, Fabel. Stuttgart 1976. S. 63. F.-J. Payrhuber, Wege zur Fabel. Freiburg im Breisgau 1978. S. 20. R. Dithmar, a.a.O., S. 75 ff. R. Dithmar, a.a.O., S. 21 E. Leibfried, a.a.O., S. 102 f. 1.3 Wirklichkeitsbezug und Aussageabsicht der Fabel Die Fabel wird in einer konkreten Situation und mit einer bestimmten Absicht erzählt. Am Beispiel des sagenumwobenen phrygischen Sklaven „Aesop, dessen Fabeln untrennbar mit seinem Lebenslauf verbunden sind, lässt sich anschaulich der Realitätsbezug und die didaktisch kritische Absicht der Fabel aufzeigen. Dabei ist nicht einmal mit Sicherheit belegt, ob Aesop wirklich gelebt hat, oder ob er nur eine „Verkörperung des fabulierenden griechischen Volksgeistes (8) ist. In der legendären Darstellung des Aesopromans (9) erscheint Aesop als ein körperlich missgestalteter Mensch, der von der Göttin Isis mit Weisheit und Redegewandtheit ausgestattet wurde. Mit diesen Eigenschaften versehen, zog Aesop durch die Länder Kleinasiens und Griechenlands und erzählte seine Fabeln, in denen er soziale Ungerechtigkeiten und menschliches Fehlverhalten anprangerte. Selbst den Mächtigen gegenüber äusserte er Kritik in Form geistreicher Fabeln, und er versuchte, deren Verhalten durch seine Lehren zu beeinflussen. Dabei ergriff Aesop stets die Partei der Schwachen, Unterdrückten oder Misshandelten. Seine kritische Haltung brachte Aesop häufig in Konflikt mit der Obrigkeit. Doch selbst in schwierigen Situationen äusserte er im Schutz der Fabeln seine Kritik. In Delphi geriet Aesop so in Streit mit der Priesterschaft, die seinen Einfluss auf das Volk fürchtete. Aus Angst vor dem Volk liessen die Priester ihn heimlich verhaften: Sie hatten eine goldene Schale aus dem Tempel des Apoll in sein Reisegepäck geschmuggelt und ihn als gemeinen Kirchenräuber verleumdet. Aesop wurde in den Kerker geworfen und zum Tode verurteilt. Auf dem Weg zum Felsen, von dem Aesop hinabgestürzt werden sollte, erzählte er die berühmt gewordene Fabel von „Maus und Frosch einerseits in der Absicht, seine eigene Situation zu veranschaulichen; andererseits, um die Priester zu warnen und sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Heinrich Steinhöwel Aesop in Delphi mit Aesops Fabel von Maus und Frosch Als Aesop einmal durch Griechenland zog und überall durch seine Fabeln seine Weisheit zeigte, erwarb er sich den Ruf, ein sehr weiser Mann zu sein. Zuletzt kam er nach Delphi, der angesehenen Stadt und dem Sitz der obersten Priesterschaft. Dort folgten ihm viele Menschen, weil sie ihm zuhören wollten; von den Priestern aber wurde er nicht ehrenvoll empfangen. Da sagte Aesop: „Ihr Männer von Delphi, ihr seid wie das Holz, das von dem Meer an den Strand geschwemmt wird. Solange es fern ist, scheint es gross zu sein, wenn es aber nahe herangekommen ist, dann sieht man, dass es in Wirklichkeit klein ist. So ging es auch mir mit euch. Solange ich noch weit von eurer Stadt entfernt war, dachte ich, dass ihr die Vornehmsten von allen wäret, jetzt aber, in eurer Nähe, erkenne ich, dass ihr nicht viel taugt. Als die Priester solche Reden hörten, sagten sie zueinander: „Dieser Mann hat in anderen Städten eine grosse Anhängerschaft. Es könnte sein, dass unter solcher üblen Nachrede unser Ansehen leidet oder dass wir es sogar ganz verlieren. Wir müssen also auf unserer Hut sein! Da beratschlagten sie, auf welche Weise sie ihn unter dem Vorwande, er sei ein böser Kirchenräuber, töten könnten; denn sie wagten es wegen des Volkes nicht, ihn (ohne einsichtigen Grund) öffentlich töten zu lassen. So liessen sie aufpassen, bis der Knecht Aesops die Sachen seines Herrn für die Abreise zusammenpackte. Da nahmen sie eine goldene Schale aus dem Tempel des Apoll und versteckten sie heimlich im Reisegepäck Aesops. Aesop wusste von all den hinterhältigen Machenschaften nichts, die gegen ihn im Gange waren, und als er nach Phokis zog, eilten die Priester ihm nach und nahmen ihn mit grossem Geschrei gefangen. Und als Aesop sie fragte, warum sie ihn gefangen nähmen, schrieen sie: „Du unanständiger Mensch, du Verbrecher! Warum hast du den Tempel des Apoll beraubt? Als Aesop vor allen leugnete und sich über diese Beschuldigung entrüstete, öffneten die Priester sein Bündel und fanden die goldene Schale. Die zeigten sie jedem einzelnen und führten Aesop wie einen Kirchenräuber ungestüm und unter grossem Tumult ins Gefängnis. Aesop wusste auch da noch nichts von all den hinterhältigen Anschlägen, die man gegen ihn ins Werk gesetzt hatte, und bat, man möge ihn freilassen. Sie aber bewachten ihn daraufhin nur noch schärfer, [.] verurteilten ihn öffentlich, weil er sich des Kirchenraubs schuldig gemacht habe, und führten ihn aus dem Gefängnis, um ihn von einem Felsen hinab zustossen. Als Aesop das merkte, sprach er zu ihnen: Zu der Zeit, als die unvernünftigen Tiere noch in Frieden miteinander lebten, gewann eine Maus einen Frosch lieb und lud ihn zum Nachtmahl ein. Sie gingen miteinander in die Speisekammer eines reichen Mannes, in der sie Brot, Honig, Feigen und mancherlei leckere Sachen fanden. Da sprach die Maus zum Frosch: „Nun iss von diesen Speisen, welche dir am besten schmecken! Als sie sich nach Herzenslust satt gefressen hatten, sprach der Frosch zu der Maus: „Nun sollst du auch meine Speisen versuchen. Komm mit mir! Weil du aber nicht schwimmen kannst, will ich deinen Fuss an meinen binden, damit dir kein Leid geschieht. Als er aber die Füsse zusammengebunden hatte, sprang der Frosch ins Wasser und zog die Maus mit sich hinab. Als die Maus merkte, dass sie sterben musste, begann sie zu schreien und klagte: „Ich werde ohne Schuld das Opfer gemeiner Hinterlist. Aber von denen, die am Leben bleiben, wird einer kommen, der meinen Tod rächt. Während sie das sagte, kam ein Habicht heran, ergriff die Maus und den Frosch und frass sie beide. So werde ich ohne Schuld von euch getötet, und ihr werdet um der Gerechtigkeit willen dafür bestraft, wenn Babylon und Griechenland über das Verbrechen reden werden, das ihr an mir begeht. Obwohl die Priester das hörten, liessen sie ihn nicht los, sondern führten ihn an die Stelle, wo er sterben sollte. Der Verlauf der Fabel ist der realen Situation auffallend analog. In der Realität ist es die Priesterschaft, die den unschuldigen Dichter ums Leben bringt; in der Fabel ist es der Frosch, der der Maus zum Verhängnis wird. Kennzeichnend ist, dass Maus und Frosch fest aneinander gebunden sind und so gemeinsam das gleiche Schicksal erleiden. Der Habicht, der beide als Beute fortträgt, wird zum Symbol für eine höhere Gerechtigkeit: er sühnt unverzüglich das an der Maus begangene Unrecht. Auf die Realität bezogen lehrt diese Fabel: Auch in der Wirklichkeit wird es eine höhere Macht (in diesem Fall das Volk der Babylonier und Griechen) geben, die Aesops Tod nicht ungesühnt lassen wird. So wie Maus und Frosch schicksalhaft miteinander verbunden sind, so werden auch die Priester ihrem Schicksal nicht entgehen, wenn sie ihn, Aesop, töten lassen. In dem hier geschilderten Fall kämpft Aesop mit der Fabel für sich selbst. Bei anderen Gelegenheiten nutzt er die Fabel im Kampf für die Unterdrückten. So zeigt das Volksbuch vom phrygischen Sklaven Aesop einen Helden, der reale soziale Zustände, politische Vorgänge oder menschliches Fehlverhalten aufgreift, sie im Gewand der Fabel kritisiert und bewusst macht und so auf Veränderung der Situation drängt. Andere Fabeln Aesops zielen weniger auf konkrete Lebenssituationen, sondern bringen eine allgemein anerkannte Lebensweisheit zum Ausdruck; sie stellen also mehr das belehrende als das kritisierende Element in den Vordergrund, indem sie ethische oder moralische Lehren erteilen. Bedenkt man, dass sich seit Phaedrus nahezu alle Fabeldichter auf die Fabeln Aesops beziehen, ihre Motive, ihr Inventar, ihre Kompositionsprinzipien verwenden und oft nur variieren, so können die aesopschen Fabeln wesentliche Aufschlüsse für die Intentionalität und Kausalität der gesamten Fabeldichtung geben. Ein Vergleich von Fabeln, die in verschiedenen Versionen vorliegen, lässt erkennen, dass oft nur eine kleine Variation genügt, um einen anderen Realitätsbezug, eine andere Aussageabsicht zum Ausdruck zu bringen. Am Beispiel der Fabel vom Fuchs und vom Raben kann das veranschaulicht werden: Martin Luther Vom Raben und Fuchs Ein Rab hatte einen Käse gestohlen und setzte sich auf einen hohen Baum und wollte zehren. Da er aber seiner Art nach nicht schweigen kann, wenn er isst, hörte ihn ein Fuchs über dem Käse kecken und lief zu und sprach: O Rab, nun hab ich mein Lebtag keinen schöneren Vogel gesehen von Federn und Gestalt, denn du bist. Und wenn du auch so eine schöne Stimme hättest zu singen, so sollt man dich zum König krönen über alle Vögel. Den Raben kitzelte solch Lob und Schmeicheln, fing an und wollt seinen schönen Gesang hören lassen. Und als er den Schnabel auftat, entfiel ihm der Käse; den nahm der Fuchs behend, frass ihn und lachte des törichten Raben. Gotthold Ephraim Lessing Der Rabe und der Fuchs Ein Rabe trug ein Stück vergiftetes Fleisch, das der erzürnte Gärtner für die Katzen seines Nachbars hingeworfen hatte, in seinen Klauen fort. Und eben wollte er es auf einer alten Eiche verzehren, als sich ein Fuchs herbei schlich und ihm zurief: Sei mir gesegnet, Vogel des Jupiter! Für wen siehst du mich an? fragte der Rabe. Für wen ich dich ansehe? erwiderte der Fuchs. Bist du nicht der rüstige Adler, der täglich von der Rechten des Zeus auf diese Eiche herabkömmt, mich Armen zu speisen? Warum verstellst du dich? Sehe ich denn nicht in der siegreichen Klaue die erflehte Gabe, die mir dein Gott durch dich zu schicken noch fortfährt? Der Rabe erstaunte und freute sich innig, für einen Adler gehalten zu werden. ,Ich muss dachte er, ,den Fuchs aus diesem Irrtume nicht bringen. Grossmütig dumm liess er ihm also seinen Raub herabfallen und flog stolz davon. Der Fuchs fing das Fleisch lachend auf und frass es mit boshafter Freude. Doch bald verkehrte sich die Freude in ein schmerzhaftes Gefühl; das Gift fing an zu wirken und er verreckte. Möchtet ihr euch nie etwas anders als Gift erloben, verdammte Schmeichler! James Thurber Der Fuchs und der Rabe Der Anblick eines Raben, der auf einem Baum sass, und der Geruch des Käses, den er im Schnabel hatte, erregten die Aufmerksamkeit eines Fuchses. Wenn du ebenso schön singst, wie du aussiehst, sagte er, dann bist du der beste Sänger, den ich je erspäht und gewittert habe. Der Fuchs hatte irgendwo gelesen und nicht nur einmal, sondern bei den verschiedensten Dichtern, dass ein Rabe mit Käse im Schnabel sofort den Käse fallen lässt und zu singen beginnt, wenn man seine Stimme lobt. Für diesen besonderen Fall und diesen besonderen Raben traf das jedoch nicht zu. Man nennt dich schlau, und man nennt dich verrückt, sagte der Rabe, nach dem er den Käse vorsichtig mit den Krallen seines rechten Fusses aus dem Schnabel genommen hatte. Aber mir scheint, du bist zu allem Überfluss auch noch kurzsichtig. Singvögel tragen bunte Hüte und farbenprächtige Jacken und helle Westen, und von ihnen gehen zwölf aufs Dutzend. Ich dagegen trage Schwarz und bin absolut einmalig. Ganz gewiss bist du einmalig, erwiderte der Fuchs, der zwar schlau, aber weder verrückt noch kurzsichtig war. Bei näherer Betrachtung erkenne ich in dir den berühmtesten und talentiertesten aller Vögel, und ich würde dich gar zu gern von dir erzählen hören. Leider bin ich hungrig und kann mich daher nicht länger hier aufhalten. Bleib doch noch ein Weilchen, bat der Rabe. Ich gebe dir auch etwas von meinem Essen ab. Damit warf er dem listigen Fuchs den Löwenanteil vom Käse zu und fing an, von sich zu erzählen. Ich bin der Held vieler Märchen und Sagen, prahlte er, und ich gelte als Vogel der Weisheit. Ich bin der Pionier der Luftfahrt, ich bin der grösste Kartograph. Und was das Wichtigste ist, alle Wissenschaftler und Gelehrten, Ingenieure und Mathematiker wissen, dass meine Fluglinie die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten ist. Zwischen beliebigen zwei Punkten, fügte er stolz hinzu. Oh, zweifellos zwischen allen Punkten, sagte der Fuchs höflich. Und vielen Dank für das Opfer, das du gebracht, indem du mir den Löwenanteil verso macht. Gesättigt lief er davon, während der hungrige Rabe einsam und verlassen auf dem Baum zurückblieb. Moral: Was wir heut wissen, wussten schon Aesop und La Fontaine: Wenn du dich selbst lobst, klingt erst richtig schön. In der älteren Fassung Martin Luthers gelingt es dem schmeichelnden Fuchs, dem ebenso einfältigen wie selbstgefälligen Raben ein Stück Käse zu entlocken. Der Fuchs wird hier für seine Schmeichelei belohnt der Dumme ist der Rabe, der allzu gern auf die Schmeicheleien des Fuchses hereinfällt. Bestraft wird hier also die Eitelkeit und Selbstgefälligkeit, gegen die sich diese Version der Fabel vom Fuchs und Raben richtet. In der Version Lessings ist der Käse aber vergiftet! Der Fuchs stirbt an seiner Beute. Während Luthers Fabel die Situation des Feudalismus widerspiegelt (es siegt der Klügere), ist die Situation bei Lessing anders: der sonst Unterlegene erscheint als der durch Zufall Glücklichere. Der Schlaue ist auf Erden zwangsläufig doch nicht immer der Glücklichere, weil auch er dem Willen des Schicksals unterliegt und dieses wendet sich hier klar gegen die Heuchler und Schleimer. Der Vergleich der Lutherschen Version der Fabel vom Raben und vom Fuchs mit der Lessingschen offenbart zum einen, dass oft nur eine Änderung eines kleinen Details ausreicht, um zu einer veränderten Aussage der Fabel zu kommen und zum anderen, dass sich die Fabel dem gesellschaftlich politischen Wandel der Zeiten anpasst: Die politische und ökonomische Führung geht langsam vom Adel auf das Bürgertum über. Hierin ist ein übergeordneter intentionaler Aspekt der Fabeldichtung zu sehen: Es lässt sich die Entwicklung des gesellschaftlichen Gesamtprozesses an der analogen Entwicklung der Fabelliteratur nachvollziehen. Dies gelingt zwar auch mit anderen Literaturgattungen, aber mit Hilfe der Fabel ist es einfacher aufzuzeigen. Zusammenfassend lässt sich zum Wirklichkeitsbezug und zur Aussageabsicht der Fabel feststellen, dass eine echte Fabel immer auf eine konkrete Situation (unter Umständen auch eine vom Dichter vorgegebene) bezogen ist. Der Sinn der Fabel besteht demnach darin, eine bestimmte Situation anhand eines anschaulichen Bildes zu verdeutlichen, zu kritisieren und auf Veränderung zu drängen. Die Fabel will menschliche Eigenarten, Denkweisen, zwischenmenschliche Beziehungen, soziale Ungerechtigkeiten und bestimmte Zeitmerkmale schlaglichtartig und pointiert erhellen. Sie ist in ihrem Wesen existenz- und gesellschaftskritisch, und ihre Grundhaltung ist die entschiedene Bejahung sozialer und moralischer Werte. In diesem Sinne dient die Fabel der Erkenntniserhellung und dem Finden von Wahrheit. (8) Zitiert aus: A. Hausrath, Aesopische Fabeln, München 1940. (9) Zitiert aus: H. Österley, Steinhöwels Aesop. Tübingen 1973. S. 38. 1.4 Die verkleidete Wahrheit Da die Wahrheit oft unerträglich ist und auf erbitterten Widerstand stösst, zudem das „unverblümte Vorhalten einer unangenehmen Wahrheit gefährlich werden kann, überwindet die Fabel den Widerstand des Adressaten, indem sie die blosszustellenden Kriterien vom menschlichen Bereich auf den nichtmenschlichen überträgt und sie in ein anderes, buntes Gewand hüllt. Die Fabel ist somit ein „vorzügliches Kampfmittel in der politischen, sozialen und religiösen Auseinandersetzung (10). Die Übertragung auf den nichtmenschlichen Bereich dient somit nicht allein der Anschaulichkeit, sie bedeutet zugleich einen Schutz für den Erzähler, denn im Narrengewand darf man unter Umständen auch einem Tyrannen die Wahrheit unter die Nase reiben eine Wahrheit, die man ihm direkt niemals zu sagen wagte. Martin Luther Über die Fabel Alle Welt hasset die Wahrheit, wenn sie einen trifft. Darum haben weise hohe Leute die Fabeln erdichtet und lassen ein Tier mit dem anderen reden, als wollten sie sagen: Wohlan, es will niemand die Wahrheit hören noch leiden, und man kann doch der Wahrheit nicht entbehren, so wollen wir sie schmücken und unter einer lustigen Lügenfarbe und lieblichen Fabeln kleiden; und weil man sie nicht will hören aus Menschenmund, dass man sie doch höre aus Tierund Bestienmund. So geschieht es denn, wenn man die Fabeln liest, dass ein Tier dem andern, ein Wolf dem andern die Wahrheit sagt, ja zuweilen der gemalte Wolf oder Bär oder Löwe im Buch dem rechten zweifüssigen Wolf und Löwen einen guten Text heimlich liest, den ihm sonst kein Prediger, Freund noch Feind legen dürfte. Magnus Gottfried Lichtwer Die beraubte Fabel Es zog die Göttin aller Dichter, Die Fabel, in ein fremdes Land, Wo eine Rotte Bösewichter Sie einsam auf der Strasse fand. Ihr Beutel, den sie liefern müssen, Befand sich leer; sie soll die Schuld Mit dem Verlust der Kleider büssen. Die Göttin litt es mit Geduld. Mehr, als man hoffte, ward gefunden, Man nahm ihr Alles; was geschah? Die Fabel selber war verschwunden, Es stand die blosse Wahrheit da. Beschämt fiel hier die Rotte nieder, Vergib uns, Göttin, das Vergehn, Hier hast du deine Kleider wieder, Wer kann die Wahrheit nackend sehn? 1.5 Das Pro- und Epimythion Da die Fabel einen konkreten Wirklichkeitsbezug hat und diese Wirklichkeit ins „Fabelhafte übertragen wird, muss zum Verständnis der Fabel zwischen einem Bildteil und einem Sachteil unterschieden werden. Während uns der Bildteil mit der Fabel selbst vorgegeben wird, sind wir bezüglich des Sachteils auf die Entschlüsselung der in der Fabel zugrunde liegenden Begebenheit angewiesen. Der ursprüngliche „Sitz im Leben einer Fabel (das ist die konkrete ursprüngliche Situation, in der die Fabel entstanden ist) ist nur in den wenigsten Fällen bekannt, weil er nicht überliefert wurde. Oft soll der fehlende Sachteil daher durch ein so genanntes Promythion oder Epimythion, d. h. durch einen Merk- oder Lehrsatz, den man der Fabel im Zuge der Überlieferung voroder nachgestellt hat, ersetzt werden. Dieses Pro- oder Epimythion, d. h. der mit „Lehre, „Moral, „Merke oder ähnlich eingeleitete Spruch, kann helfen, die Aussageabsicht der Fabel leichter zu erschliessen. Allerdings nimmt ein Pro- oder Epimythion dem Leser einen wesentlichen Reiz der Fabel: nämlich den der eigenen Überlegung und Erschliessung des Gehalts und der Intention. Das bedeutet, dass dieser Zusatz dem Leser die eigene gedankliche Arbeit, die Reflexion und die Suche nach dem Wirklichkeitsbezug, der bei jedem Leser aufgrund unterschiedlicher Erfahrungshorizonte durchaus ein anderer sein kann, weitestgehend vorwegnimmt. Ein Pro- oder Epimythion ist also eher überflüssig, da eine Fabel so beschaffen sein muss, dass der Leser die enthaltene Lehre mühelos entdecken und auf seine Realität beziehen kann. (10) Zitiert aus: R. Dithmar, a.a.O., S. 132. 1.6 Das Figureninventar der Fabel Die Anzahl der Akteure Zum Figureninventar der Fabel gehören neben Pflanzen und unbelebten Gegenständen vor allem die Tiere. Die Zahl der in der Fabeldichtung vorkommenden Tiere ist nicht sehr gross. Als typische und häufig auftretende Fabeltiere finden sich der Löwe, der Fuchs, der Wolf, der Esel, der Hase und der Rabe. Schon seltener erscheint das Lamm, die Maus, der Frosch, der Igel, der Ochse oder die Schlange. In der Regel finden sich in der Fabel Tiere aus der unmittelbaren Umgebung des Menschen, also solche, die dem Menschen aus ihrer typischen natürlichen Eigenart vertraut sind. Zumeist stehen sich in der Fabel zwei einzelne Tiere gegenüber; seltener zwei Gruppen oder ein Tier und eine Gruppe. Bei den meisten Fabelmotiven reichen zwei Figuren aus, um die Aussageabsicht der Fabel klar herauszustellen. Treten dennoch mehrere Tiere auf, werden Gruppen gebildet, so dass sich doch wieder nur zwei Parteien gegenüberstehen. So agieren in Aesops Fabel von Maus und Frosch zunächst nur Maus und Frosch allein. Sobald der Habicht in das Geschehen eingreift, werden die beiden Kontrahenten zur Einheit, indem sie aneinandergebunden das gleiche Schicksal erleiden. Die Typisierung der Fabeltiere Zu dem relativ kleinen Sortiment an Fabeltieren und der geringst möglichen Zahl an handelnden Tieren innerhalb einer Fabel kommt als weiteres Merkmal die typische Gestaltung der Fabeltiere hinzu. Dabei kann es sein, dass das typische Ansehen (der „Ruf) eines Tieres in der Meinung des Volkes bereits vorgeprägt war, bevor es als Vertreter einer bestimmten Eigenart oder Gesinnung in der Fabel Verwendung fand. Daneben ist aber auch denkbar, dass eine bestimmte Vorstellung von der Art eines Tieres erst durch die Fabel selbst geprägt worden ist, indem es im Laufe der Geschichte der Fabel stets durch die gleichen markanten Eigenschaften geprägt wurde. So ist der Fuchs uns in seinem Verhalten deshalb so vertraut, weil er in jeder Fabel einen für ihn typischen Charakter hat und weil dieser von den Dichtern stets hervorgehoben wird. Nur dadurch, dass der Fuchs in jeder Fabel als der Schlaue erscheint, bleibt sein Bild erhalten. Entsprechendes gilt z. B. für den Esel, der das Törichte, Naive und Sture verkörpert und für das Lamm als Zeichen der Unschuld und Wehrlosigkeit. Durch diese stets wiederkehrende typische Gestaltung der Fabeltiere gewinnt die Fabel ihren festen Bestand an Figuren. Treffen in einer Fabel z. B. der gefrässige Wolf und der dumme Esel zusammen, dann weist diese Figurenkonstellation schon auf die Art der Handlung hin. Zu diesen typisierten Fabeltieren treten aber auch noch solche Tiere hinzu, die nicht auf bestimmte Eigenschaften fixiert sind. In Fabeln, in denen untypisierte Tiere agieren, gewinnen Handlung, Situation oder Umstände eine entscheidende Bedeutung, während andere Fabeln schon allein durch das Zusammentreffen bestimmter Typen geprägt werden, wobei besondere Umstände dann eine deutlich geringere Bedeutung haben können. Die typischen Eigenschaften, die den Tieren in der Fabeldichtung zugeschrieben werden, findet man auch in Sprichwörtern, Redensarten und in der Heraldik wieder. Mit den biologischen Eigenarten der Tiere brauchen sie jedoch nicht übereinstimmen, denn die Fabeltiere sind gedankliche Schöpfungen des Menschen, und die Eigenschaften werden den Tieren vom Menschen zugeschrieben. Durch die Übertragung menschlicher Eigenschaften auf die Fabeltiere (Personifizierung) werden diese in den menschlichen Bereich integriert. Sie sind in diesem Sinne keine Tiere mehr, sondern stehen stellvertretend für einen bestimmten Menschentyp. Die Vermenschlichung der Fabelfiguren In der Fabel sprechen und handeln die Tiere wie Menschen. Erst durch die völlige Gleichschaltung des Tieres und des Menschen können die Tiere ihre Aufgabe in der Fabel erfüllen: Sie werden zur Person, d. h. zu einem Wesen, dass Verantwortung für sein Handeln trägt, das schuldig wird und dafür büssen muss oder unschuldig ein ungerechtes Schicksal erleidet. Die Anthropomorphisierung (Vermenschlichung eines nichtmenschlichen Bereichs) ist somit ein weiteres typisches und wesentliches Merkmal der Fabel. Für die Fabel heisst das, nur das für den Menschen Typische wird auf die Tiere übertragen, und zwar so, dass die tierischen Eigenschaften entweder überformt werden oder dass neue menschliche Eigenarten hinzutreten. 1.6 Kennzeichnende Strukturelemente einer typischen Fabel Gotthold Ephraim Lessing Der Esel und der Wolf Ein Esel begegnete einem hungrigen Wolfe. „Habe Mitleiden mit mir, sagte der zitternde Esel, „ich bin nur ein armes, krankes Tier; sieh nur, was für einen Dorn ich mir in den Fuss getreten habe! „Wahrhaftig, du dauerst mich, versetzte der Wolf, „und ich finde mich mit meinem Gewissen verbunden, dich von diesen Schmerzen zu befreien. Kaum war das Wort gesagt, so ward der Esel zerrissen. Dieses Beispiel enthält alle kennzeichnenden Strukturelemente und Gestaltungsprinzipien einer typischen Fabel • Tiere als Akteure • die Typisierung der Fabelfiguren (der böse, hinterlistige Wolf der einfältige Esel) • das Prinzip der polaren Gegensetzung • die Zeit- und Ortlosigkeit • der pointierte Schluss • die sprachliche Kürze und Prägnanz • die Dreigliedrigkeit • den geringst möglichen Umfang • die Verbindung von erzählerischen und dramatischen Elementen • der Wirklichkeitsbezug • die versteckte Aussageabsicht • die Existenz- und Gesellschaftskritik In den folgenden Kapiteln werden diese Strukturelemente und Gestaltungsprinzipien der Fabel ausführlich erklärt. 1.7 Der Aufbau der typischen Fabel In ihrer strengen Form besitzt die Fabel einen dreigliedrigen Aufbau (11), der von der Antike bis zur Moderne im Prinzip beibehalten wird: 1. Ausgangssituation 2. Konfliktsituation 2.1 Aktion oder Rede 2.2 Reaktion oder Gegenrede 3. Lösung Dieses einfach überschaubare und rhetorisch geschickte Bauschema muss in engem Zusammenhang mit der didaktischen Absicht der Fabel gesehen werden. Dem Hörer oder Leser wird zunächst in der Ausgangssituation die zum Fabelverständnis notwendige Information gegeben. Die Ausgangssituation stellt die Handelnden kurz vor und lenkt auf die spezielle Konfliktlage hin. Eine weitergehende Beschreibung findet sich nur, wenn diese zum unmittelbaren Verständnis unbedingt erforderlich ist. Die Konfliktsituation ergibt sich in der Regel aus der Antithetik, die durch die Gegenüberstellung zweier konträrer Verhaltensweisen hervorgerufen wird. Die Handlung, in der der Konflikt verwirklicht wird, ist dabei so gestaltet, dass eine Verhaltensweise als die unterlegene erkennbar wird. In Rede und Gegenrede, Handlung und Gegenhandlung läuft ein dramatisches Geschehen ab, das sich auf einen Höhepunkt zuspitzt und in einem überraschenden Moment, einer Pointe, gipfelt. Am Ende der Fabel (Lösung) wird das Ergebnis berichtet. Die Absicht des Dichters ergibt aus der Deutung des Fabelgleichnisses. In wenigen Fällen wird der Fabel als viertes Glied ein (meist später hinzugefügter) Lehrsatz, das Epimythion, hinzugefügt, das dann typographisch oder anders von der eigentlichen Erzählung getrennt wird. Reinhard Dithmar erläutert das Aufbauprinzip am Beispiel der Fabel von Fuchs und Rabe in der Version Gotthold Ephraim Lessings: Der Rabe und der Fuchs Ein Rabe trug ein Stück vergiftetes Fleisch, das der erzürnte Gärtner für die Katzen seines Nachbars hingeworfen hatte, in seinen Klauen fort. Und eben wollte er es auf einer alten Eiche verzehren, als sich ein Fuchs herbeischlich und ihm zurief: Sei mir gesegnet, Vogel des Jupiter! Für wen siehst du mich an? fragte der Rabe. Für wen ich dich ansehe? erwiderte der Fuchs. Bist du nicht der rüstige Adler, der täglich von der Rechten des Zeus auf diese Eiche herabkömmt, mich Armen zu speisen? Warum verstellst du dich? Sehe ich denn nicht in der siegreichen Klaue die erflehte Gabe, die mir dein Gott durch dich zu schicken noch fortfährt? Der Rabe erstaunte und freute sich innig, für einen Adler gehalten zu werden. ,Ich muss dachte er, ,den Fuchs aus diesem Irrtume nicht bringen. Grossmütig dumm liess er ihm also seinen Raub herabfallen und flog stolz davon. Der Fuchs fing das Fleisch lachend auf und frass es mit boshafter Freude. Doch bald verkehrte sich die Freude in ein schmerzhaftes Gefühl; das Gift fing an zu wirken und er verreckte. Situation: Der Rabe sitzt mit seinem Stück Käse auf einem hohen Baum. Der Fuchs naht voll Gier nach dem Käse. Mit Gewalt lässt sich nichts erreichen. Aktion: Der Fuchs versucht es mit List. Der Rabe hat im Gegensatz zu den bunten Singvögeln ein schwarzes und nicht glänzendes Gefieder. Im Gegensatz zum Adler, dem König der Vögel, hat er einen unscheinbaren Kopf. Wenn einer heiser ist und nicht singen kann, sagen wir: Er krächzt wie ein Rabe. Der Fuchs sagt das Gegenteil. Er belügt den Raben; er schmeichelt ihm aus Gewinnsucht. Reaktion: Der eitle Rabe will sich zeigen und seine Stimme erklingen lassen. Er ist töricht. Durch die Schmeichelei des Fuchses betört, denkt er nicht daran, dass er den Käse verliert, wenn er den Schnabel öffnet. Ergebnis: Der Fuchs hat sein Ziel mit List erreicht und frisst den Käse auf. Erst jetzt merkt der Rabe, dass er betrogen wurde und für seine Eitelkeit bezahlen muss. Das aufgezeigte Grundschema ist variabel. Die Konfliktsituation kann aus einmaliger Rede und Gegenrede bestehen, sie kann auch durch doppelten oder mehrfachen Wechsel ausgedehnt sein. Andererseits kann eine Fabel so reduziert sein, dass die Lösung des Konflikts bereits in actio und reactio zum Ausdruck kommt. Beispiel: H. Arntzen Wolf und Lamm Der Wolf kam zum Bach. Da entsprang das Lamm. Bleib nur, du störst mich nicht! rief der Wolf. Danke, rief das Lamm zurück, ich habe im Aesop gelesen. Hier wird deutlich, dass actio und reactio, bzw. Rede und Gegenrede den Kern der Fabel bilden und das eigentlich bestimmende Moment der Fabel darstellen. (11) Siehe auch: E. Leibfried, a.a.O., S. 30 1.8 Das epische und dramatische Element der Fabel Das im vorangegangenen Abschnitt aufgezeigte Aufbauprinzip beruht darauf, dass die Fabel episch und dramatisch zugleich ist. R. Dithmar bezeichnet die Fabel als ein „in eine Erzählung eingefügtes Drama in knappster Form (12), in dem Einheit von Ort, Zeit und Handlung herrscht: „Das Geschehen spielt sich an einem einzigen Ort ab, in einer Zeitspanne, die meist nicht länger währt, als ein kurzer Dialog (ggf. mit der anschliessenden schnellen Tat) dauert; es gibt nur eine einzige Handlung und keine Nebenhandlungen. (13) Das typische Merkmal der dramatischen Fabelform ist die Auflösung der Handlung in ein Gespräch. Es geschieht nichts mehr, es wird nichts erzählt; es wird nur noch gesprochen. In ihrer strengsten Form beschränkt die Fabel so das dramatische Geschehen auf einen Dialog als einmalige Rede und Gegenrede. Sehr viel seltener kommt ein Monolog allein vor, der durch eine bestimmte Situation oder ein Ereignis ausgelöst wird (Beispiel: Der Fuchs und die Weintrauben). Während sich die überwiegend dramatisierte Fabel nur auf das für das Fabelverständnis Wesentliche beschränkt, also zur Stichomythie tendiert, breitet die episierend Fabel den Sachverhalt in ausführlicher Fülle aus. Sie stellt die Figuren in ausführlicher Weise dar, weitet den Konflikt weiter aus und legt insgesamt Wert auf die Stimmigkeit des ganzen Berichts. (12) (13) Zitiert aus: R. Dithmar, a.a.O., S. 103 Ebda. S. 104 1.9 Der didaktische Gehalt der Fabel Schüler-, Gesellschafts- und Fachrelevanz Über die didaktische Absicht der Fabel selbst ist bereits im vorigen Kapitel gesprochen worden; im folgenden Abschnitt soll der pädagogische Wert dieser Gattung für den Literaturunterricht analysiert werden. Um es gleich vorweg zu sagen: Zwei wesentliche Argumente sprechen dafür, dass die Fabel auch im modernen Deutschunterricht ihre Funktion und Bedeutung hat: 1. Sie verdeutlicht, was gute Literatur allgemein zu leisten vermag, nämlich Probleme und Konflikte aus den verschiedensten Bereichen menschlichen Seins bewusst zu machen und Lösungsstrategien dafür anzubieten. 2. Sie ist aufgrund ihrer Kürze und ihres Aufbaus vorzüglich geeignet, die Schüler an die systematische Textanalyse heranzuführen; das gilt sowohl für die inhaltliche wie auch für die formale Arbeit an Texten. Im Mittelpunkt soll zunächst die Frage stehen: „Was leistet die Fabel für die vom Schüler jetzt und später zu realisierende Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit ? Der Literaturunterricht in der Sekundarstufe zielt auf junge Menschen, deren Weltund Sachverständnis sich gerade erst etabliert. Aufgabe des Literaturunterrichts muss es daher sein, dem Schüler durch geeignete Texte Informationen über die Welt als Befriedigung von gegenwärtigen Informationsbedürfnissen anzubieten und ihm damit eine Daseinsorientierung zu ermöglichen, die (auf die gegenwärtige Lebenspraxis des Schülers bezogen) für den Schüler eine Hilfe beim Aufwachsen bedeutet und die (auf die Zukunft des Schülers und der Gesellschaft bezogen) eine Weltkenntnis als Bestandteil einer allgemeinen Lebensqualifikation schafft. Dieser Aufgabe wird die Fabel in besonderer Weise gerecht. Sie bietet dem Schüler ein Denkmodell, eine auf klare Grundverhältnisse des Lebens reduzierte Situation an, auf deren unterer Ebene sich Ereignisse in beinahe märchenhafter Form innerhalb des Tierreiches vollziehen: Tiere sprechen und handeln wie Menschen. Von der höheren Ebene aus zeigt sich aber, dass das anschauliche Geschehen auf der unteren Ebene parabolischen Charakter hat und somit eine allgemeine Bedeutung erlangt. Hat der Schüler die Fabel als parabolische Sprachform erkannt, so ermöglicht sie ihm eine Daseinsorientierung in zweifacher Hinsicht, zum einen, indem sie das Verständnis für fundamentale menschliche Situationen erschliesst, zum anderen, indem sie mit ihrer realistisch unbequemen Wahrheit den Blick auch für die unerfreulichen Seiten des Lebens öffnet. Deshalb darf sich der Unterricht nicht mit der Betrachtung der Erzählseite einer Fabel begnügen, sondern muss von vornherein auch die Sinnseite mit in die Betrachtung einbeziehen: „Auf welche Gelegenheit passt dieses Denkmodell? Welche Situation, welche gesellschaftliche Konstellation wird durch dieses Modell erhellt? Indem sich der Schüler mit dieser Fragestellung auseinandersetzt, wird von ihm ein Erkenntnisprozess gefordert, der sowohl von existentieller als auch von fachspezifischer Bedeutung ist. Anhand der Fabelbetrachtung erkennt der Schüler, dass literarische Texte einen Informationsgehalt über die Welt und über bestimmte, vom Dichter gestaltete Momente der Wirklichkeit enthalten. Über die Erkenntnis des Wirklichkeitsbezuges der Fabel und der Literatur insgesamt, gelangt der Schüler zu einer eigenen Identitätsgewinnung, indem er die Aussagen des auf die Wirklichkeit bezogenen Textes mit seinen eigenen Vorstellungen von der Welt vergleicht, das Verhalten der agierenden Figuren seinen eigenen Verhaltensnormen gegenüberstellt („Wie hätte ich mich in dieser Konfliktsituation verhalten? und indem er die in den Fabeltexten dargestellten Geschehnisse auf Ereignisse aus seinem eigenen Erfahrungsbereich überträgt. Neben der Daseinsorientierung und Identitätsbildung kommt der Fabel im Literaturunterricht noch eine besondere Bedeutung bei der Persönlichkeitsbildung des Schülers zu. Als parabolische Rede ist die Fabel eine spezifische Sprachform des kritischen Denkens. Sie wendet sich an den Verstand; sie will diskutiert werden, will Kritik herausfordern und somit die Kritikfähigkeit des Schülers fördern. Die Fabeln stellen dem Schüler Konfliktsituationen vor, die ihn zur distanzierten Auseinandersetzung mit den gegebenen Umständen veranlassen, und sie bieten Konfliktlösungsstrategien an, die zur kritischen Prüfung der dargestellten Verhaltensweisen herausfordern und zugleich zur selbstkritischen Überprüfung seiner eigenen Denk- und Verhaltensweisen. Diese kritische Reflexion seiner eigenen Denk- und Verhaltensweisen ermöglicht dem Schüler schliesslich in gewissem Umfang eine Selbsteinschätzung der eigenen Person und seiner Verhaltensmuster in akuten Situationen, die zur grundlegenden Voraussetzung wird für die Fähigkeit sozialer Interaktion und Kommunikation. Das bedeutet letztendlich die Fähigkeit der Konfliktbewältigung im eigenen Alltag des Schülers, da die Fabel Probleme und Konflikte und entsprechende Lösungsstrategien aus verschieden Bereichen des Lebens vorstellt. Zum Erwerb einer „fachlichen Literatur- und Lektürekompetenz ist es notwendig, den Schülern Kenntnisse über die Gattung „Fabel selbst, d.h. über die kennzeichnenden Strukturelemente und Gestaltungsprinzipien sowie über die Gattungsgeschichte zu vermitteln. Daher ist es von didaktischer Relevanz, dass die Schüler nicht nur über den Realitätsbezug und die didaktisch-kritische Intentionalität der Fabel Bescheid wissen, sondern auch Kenntnisse über das Figureninventar, die Typisierung der Fabelfiguren, die sprachlichen Ausdrucksformen, die Kompositionsprinzipien und den Aufbau der Fabel sowie über die Verbindung von epischen und dramatischen Elementen erwerben, um die Fabel als Gattung identifizieren und sie von anderen literarischen Formen unterscheiden zu können. Für die Bildung und Förderung einer literarischen Kompetenz ist es wichtig, neben den gattungskonstituierenden Merkmalen der Fabel auch die individuellen ästhetischen Besonderheiten der einzelnen Texte zu berücksichtigen. Durch die Unterscheidung der epischen und dramatischen Momente der Fabel lässt sich am relativ einfachen Beispiel die Grundlage für eine spätere Erarbeitung und Definition der Begriffe Epik und Dramatik schaffen. Schließlich führt der dramatische Charakter der Fabel dahin die Fabel im Unterricht mit verteilten Rollen lesen zu lassen, wobei ein Sprecher jeweils den epischen Teil vorträgt. Besonders geeignet sind hierzu Fabeln, die eine längere Rede oder eine umfangreichere Wechselrede enthalten. 2. Vorschläge und Ideen zur Lektionsgestaltung Einstiegsmöglichkeiten: Fabel ab CD hören, SS haben die Augen geschlossen Fabel vorlesen Cluster zum Wort Fabel Bild eines Fabelwesens auf OHP. SS vermuten Lektionsgestaltung: Die Fabel von SS als Theater vorspielen lassen Jeder SS erzählt eine Fabel in eigenen Worten nach SS malen gestalten im BG-Unterricht ein passendes Bild zur selbst erfundenen Fabel SS gestalten ein Fabelbuch. Sammlung der selbst erfundenen Fabeln. Mit Zeichnungen Gestaltungen Selbst erfundene Fabeln am Elternabend vorlesen Diskussion über eine Fabel zum Beispiel Der Löwe und die Maus oder über die Moral einer Fabel Wie hättest du in dieser Situation reagiert? (Vergleich mit heutiger Situation, Anwendungen in der Gegenwart, ) Geschichte von Äsop als Zusatzinformation für SS (siehe 1. Information für den Lehrer, Kapitel 1.1 bis 1.3) den SS erzählen Thema Pro- und Epimythion als Zusatzinformation für SS (siehe 1. Information für den Lehrer, Kapitel 1.5) Die drei Fabeln Der Rabe und der Fuchs von Martina Luther, Gotthold E. Lessing und James Thurber vergleichen (mündlich oder schriftlich) Welche Folgen haben die Änderungen? Warum wurde der Inhalt überhaupt verändert? Wie verändert sich die Moral? (siehe 1. Information für den Lehrer, Kapitel 1.1 bis 1.3) Fabeln Theorie Definition: Der Ausdruck Fabel bezeichnet eine in Vers oder Prosa verfasst Erzählung mit belehrender Absicht, in der vor allem Tiere, aber auch Pflanzen oder fabelhafte Mischwesen menschliche Eigenschaften besitzen (Personifikation). Die Dramatik der Fabelhandlung zielt auf eine Schlusspointe hin, an die sich meist eine allgemeingültige Moral anschliesst. Geschichte: Der Begriff „Fabel geht auf das lateinische Wort fabula (Geschichte, Erzählung, Gespräch) zurück. Die Frage nach dem Ursprungsland der Fabel ist umstritten. In der Fachliteratur werden häufig Indien und Griechenland, aber auch Ägypten und Babylonien genannt. Die ältesten überlieferten Fabeln stammen u. a. von Hesoid (um 700 v. Chr.) und Archilochos (um 650 v. Chr.). Der Sklave Äsop (um 550 vor Chr.) soll angeblich als erster Fabeln indischer und griechischer Herkunft gesammelt und aufgezeichnet haben. Auf deutschem Boden wurde die Fabeldichtung innerhalb der lateinischen Klosterliteratur des Mittelalters gepflegt und weitergegeben. Merkmale einer Fabel: Im Mittelpunkt der Handlung stehen oft Tiere, denen die Menschen bestimmt Eigenschaften zuschrieben. Die Tiere handeln, sprechen und denken wie Menschen. Die Fabel will belehren und unterhalten. Die Personifikation der Tiere dient dem Autor oft als Schutz vor Bestrafung. Zeit- und Ortsangaben fehlen. Fabeln sind kurz Die Figuren der Fabel: Zu den Figuren der Fabel gehören neben Pflanzen und unbelebten Gegenständen vor allem die Tiere. Die Zahl der in der Fabeldichtung vorkommenden Tiere ist nicht sehr gross. Als typische und häufig auftretende Fabeltiere finden sich der Löwe, der Fuchs, der Wolf, der Esel, der Hase und der Rabe. In der Regel finden sich in der Fabel Tiere aus der unmittelbaren Umgebung des Menschen, also solche, die dem Menschen in ihrer typischen natürlichen Eigenart vertraut sind. Diese Tiere haben meist Eigenschaften, die sich in fast allen Fabeln gleichen. Der Fuchs ist dort der Schlaue, Listige, der nur auf seinen Vorteil bedacht ist. Die Eule ist die weise und kluge Person. Die Gans gilt als dumm, der Löwe als mutig, die Schlange als hinterhältig, die Maus als klein. Fabeltiere stellen bestimmte Charakterzüge von Menschen dar. In der Tabelle wird der personifizierte Charakter des Fabeltieres durch einen charakteristischen Fabelnamen unterstrichen: Fabelnamen der germanischen Fabeltradition Name Tier Charakter Adebar Storch stolz Adelheid Gans geschwätzig Henning Hahn eitel und schlau Meister Lampe Hase vorlaut und ängstlich Lupardus Leopard Affe Clown Martin Meister Lampe Hase vorlaut und ängstlich Meister Petz Bär gutmütig Reineke Fuchs schlau Der Aufbau der Fabel: In ihrer strengen Form besitzt die Fabel einen dreigliedrigen Aufbau. 1. Situation 2. Aktion Reaktion 3. Lösung Ergebnis Beispiel: Der Rabe und der Fuchs Ein Rabe trug ein Stück vergiftetes Fleisch, das der erzürnte Gärtner für die Katzen seines Nachbars hingeworfen hatte, in seinen Klauen fort. Und eben wollte er es auf einer alten Eiche verzehren, als sich ein Fuchs herbei schlich und ihm zurief: Sei mir gesegnet, Vogel des Jupiter! Für wen siehst du mich an? fragte der Rabe. Für wen ich dich ansehe? erwiderte der Fuchs. Bist du nicht der rüstige Adler, der täglich von der Rechten des Zeus auf diese Eiche herabkömmt, mich Armen zu speisen? Warum verstellst du dich? Sehe ich denn nicht in der siegreichen Klaue die erflehte Gabe, die mir dein Gott durch dich zu schicken noch fortfährt? Der Rabe erstaunte und freute sich innig, für einen Adler gehalten zu werden. ,Ich muss dachte er, ,den Fuchs aus diesem Irrtume nicht bringen. Grossmütig dumm liess er ihm also seinen Raub herabfallen und flog stolz davon. Der Fuchs fing das Fleisch lachend auf und frass es mit boshafter Freude. Doch bald verkehrte sich die Freude in ein schmerzhaftes Gefühl; das Gift fing an zu wirken und er verreckte. Situation: Der Rabe sitzt mit seinem Stück Käse auf einem hohen Baum. Der Fuchs naht voll Gier nach dem Käse. Aktion: Der Fuchs versucht es mit List. Der Rabe hat im Gegensatz zu den bunten Singvögeln ein schwarzes und nicht glänzendes Gefieder. Im Gegensatz zum Adler, dem König der Vögel, hat er einen unscheinbaren Kopf. Wenn einer heiser ist und nicht singen kann, sagen wir: Er krächzt wie ein Rabe. Der Fuchs sagt das Gegenteil. Er belügt den Raben; er schmeichelt ihm aus Gewinnsucht. Reaktion: Der eitle Rabe will sich zeigen und seine Stimme erklingen lassen. Er ist töricht. Durch die Schmeichelei des Fuchses betört, denkt er nicht daran, dass er den Käse verliert, wenn er den Schnabel öffnet. Ergebnis: Der Fuchs hat sein Ziel mit List erreicht und frisst den Käse auf. Erst jetzt merkt der Rabe, dass er betrogen wurde und für seine Eitelkeit bezahlen muss. Fabeln Arbeitsblatt 1 1. Lies die untenstehende Fabel aufmerksam durch. Der Löwe und die Maus Gerade zwischen den Tatzen eines Löwen kam eine leichtsinnige Maus aus der Erde. Der König der Tiere aber zeigte sich wahrhaft königlich und schenkte ihr das Leben. Diese Güte wurde später von der Maus belohnt so unwahrscheinlich es zunächst klingt. Eines Tages fing sich der Löwe in einem Netz, das als Falle aufgestellt war. Er brüllte schrecklich in seinem Zorn aber das Netz hielt ihn fest. Da kam die Maus herbeigelaufen und zernagte einige Maschen, so dass sich das ganze Netz auseinander zog und der Löwe frei davongehen konnte. 2. Warum handelt es sich um eine Fabel? Nenne drei Gründe. 3. Wie ist die Fabel aufgebaut? Situation: Aktion: Reaktion: Ergebnis: Fabeln Lösungen 1 1. Lies die untenstehende Fabel aufmerksam durch. 2. Warum handelt es sich um eine Fabel? Nenne drei Gründe. 1) Im Mittelpunkt der Handling stehen Tiere (Löwe und Maus) 2) Die Tiere handeln, sprechen und denken wie Menschen 3) Zeit- und Ortsangaben fehlen 3. Wie ist die Fabel aufgebaut? Situation: Zwischen den Tatzen eines Löwen kommt leichtsinnige eine Maus aus der Erde. Aktion: Der Löwe zeigt sich königlich und lässt die Maus am Leben. Reaktion: Die Güte des Löwen wird später belohnt. Die Maus hilft dem Löwen aus dem Netz, in dem er sich verfangen hatte. Ergebnis: Die kleine Maus konnte sich revanchieren und hat dem König der Tiere geholfen. Fabeln Arbeitsblatt 2 Schreibe zusammen mit deiner Kollegin deinem Kollegen eine selbst erfundene Fabel. Achtet auf die Merkmale einer Fabel. Fabeln Arbeitsblatt 3a 1. Schreibe zur untenstehenden Fabel einen selbst erfundenen Schluss. Der Fuchs und der Ziegenbock Meister Reineke ging an einem heissen Sommertag mit seinem Freund, dem Ziegenbock, spazieren. Sie kamen an einem Brunnen vorbei, der nicht sehr tief war. Der muntere Bock kletterte sofort auf den Brunnenrand, blickte neugierig hinunter und sprang, ohne zu zögern, in das kühle Nass. Der Fuchs hörte ihn herumplatschen und genüsslich schlürfen. Da er selber sehr durstig war, folgte er dem Ziegenbock und trank sich satt. Dann sagte er zu seinem Freund: Der Trunk war erquickend, ich fühle mich wie neugeboren. Doch nun rate mir, wie kommen wir aus diesem feuchten Gefängnis wieder heraus? Dir wird schon etwas einfallen, blökte der Bock zuversichtlich und rieb seine Hörner an der Brunnenwand. Das brachte den Fuchs auf eine Idee. Stell dich auf deine Hinterbeine, und stemme deine Vorderhufe fest gegen die Mauer, forderte er den Ziegenbock auf, ich werde versuchen, über deinen Rücken hinaufzugelangen. Du bist wirklich schlau, staunte der ahnungslose Bock, 2. Vergleiche deinen Schluss mit der ursprünglichen Fassung und vergleiche die beiden Fassungen. Welche Fassung gefällt dir besser? Begründe deine Meinung. Schreibe mindestens eine halbe Seite. Der Fuchs und der Ziegenbock Meister Reineke ging an einem heissen Sommertag mit seinem Freund, dem Ziegenbock, spazieren. Sie kamen an einem Brunnen vorbei, der nicht sehr tief war. Der muntere Bock kletterte sofort auf den Brunnenrand, blickte neugierig hinunter und sprang, ohne zu zögern, in das kühle Nass. Der Fuchs hörte ihn herumplatschen und genüsslich schlürfen. Da er selber sehr durstig war, folgte er dem Ziegenbock und trank sich satt. Dann sagte er zu seinem Freund: Der Trunk war erquickend, ich fühle mich wie neugeboren. Doch nun rate mir, wie kommen wir aus diesem feuchten Gefängnis wieder heraus? Dir wird schon etwas einfallen, blökte der Bock zuversichtlich und rieb seine Hörner an der Brunnenwand. Das brachte den Fuchs auf eine Idee. Stell dich auf deine Hinterbeine, und stemme deine Vorderhufe fest gegen die Mauer, forderte er den Ziegenbock auf, ich werde versuchen, über deinen Rücken hinaufzugelangen. Du bist wirklich schlau, staunte der ahnungslose Bock, das wäre mir niemals eingefallen. Er kletterte mit seinen Vorderfüssen die Brunnenwand empor, streckte seinen Körper, so gut er konnte, und erreichte so fast den Rand des Brunnens. Kopf runter! rief der Fuchs ihm zu, und schwups war er auch schon über den Rücken des Ziegenbocks ins Freie gelangt. Bravo, Rotschwanz! lobte der Bock seinen Freund, du bist nicht nur gescheit, sondern auch verteufelt geschickt. Doch plötzlich stutzte der Ziegenbock. Und wie ziehst du mich nun heraus? Der Fuchs kicherte. Hättest du nur halb soviel Verstand wie Haare in deinem Bart, du wärest nicht in den Brunnen gesprungen, ohne vorher zu bedenken, wie du wieder herauskommst. Jetzt hast du sicher Zeit genug dazu. Lebe wohl! Ich kann dir leider keine Gesellschaft leisten, denn auf mich warten wichtige Geschäfte. Fabeln Arbeitsblatt 4 1. Lies die untenstehende Fabel aufmerksam durch. Die Taube und die Ameise An einem heissen Sommertag flog eine durstige Taube an einen kleinen, rieselnden Bach. Sie girrte vor Verlangen, neigte ihren Kopf und tauchte den Schnabel in das klare Wasser. Hastig saugte sie den kühlen Trunk. Doch plötzlich hielt sie inne. Sie sah, wie eine Ameise heftig mit ihren winzigen Beinchen strampelte und sich verzweifelt bemühte, wieder an Land zu paddeln. Die Taube überlegte nicht lange, knickte einen dicken, langen Grasstängel ab und warf ihn der Ameise zu. Flink kletterte diese auf den Halm und krabbelte über die Rettungsbrücke an Land. Die Taube brummelte zufrieden, schlürfte noch ein wenig Wasser und sonnte sich danach auf einem dicken, dürren Ast, den der Blitz von einem mächtigen Baum abgespalten hatte und der nahe am Bach lag. Ein junger Bursch patschte barfüssig durch die Wiesen zum Wasser. Er trug einen selbst geschnitzten Pfeil und Bogen. Als er die Taube erblickte, blitzten seine Augen auf. Gebratene Tauben sind meine Lieblingsspeise, lachte er und spannte siegesgewiss seinen Bogen. Erbost über dieses unerhörte Vorhaben gegen ihren gefiederten Wohltäter kroch die Ameise behände auf seinen Fuss und zwickte ihn voller Zorn. Der Taugenichts zuckte zusammen und schlug mit seiner Hand kräftig nach dem kleinen Quälgeist. Das klatschende Geräusch schreckte die Taube aus ihren sonnigen Träumen auf, und eilig flog sie davon. Aus Freude, dass sie ihrem Retter danken konnte, biss die Ameise noch einmal kräftig zu und kroch dann wohl gelaunt in einen Maulwurfshügel. 2. Was will uns diese Fabel mitteilen? Welches ist die Moral dieser Fabel? Was lernen wir aus dieser Fabel? Schreibe mindestens eine Seite. 4. Ausgewählte Fabeln von La Fontaine Das Schwein, die Ziege und der Hammel Eine Ziege, ein Hammel und ein fettgemästetes Schwein wurden gemeinsam auf einem Karren zum Markt gefahren. Die Ziege reckte ihren Hals und schaute neugierig in die Landschaft. Der Hammel hing seinen Gedanken nach. Nur das Schwein war aufsässig und fand gar keine Freude an diesem Ausflug. Es schrie so entsetzlich, dass es sogar dem gutmütigen Hammel zuviel wurde. Warum machst du denn so einen Lärm? Man kann dabei ja keinen vernünftigen Gedanken fassen. Auch die Ziege schimpfte mit dem Schwein und meckerte: Hör endlich auf mit dem albernen Gezeter und benimm dich anständig. Schau dir die herrlichen, saftigen Wiesen an und sei dankbar dafür, dass du gefahren wirst und nicht zu Fuss gehen musst. Törichte Ziege, dummer Hammel, schnäuzte das Schwein, ihr haltet euch wohl für sehr klug und gebildet, dass ihr mir Vorschriften machen wollt. Glaubt ihr denn, dass der Bauer uns allein zu unserem Vergnügen herumkutschiert? Hättet ihr nur ein Fünkchen Verstand, dann wüsstet ihr, auf welchem Weg wir uns befinden. Bestimmt denkt die leichtsinnige Ziege, man will auf dem Markt nur ihre Milch verkaufen. Du, törichter Hammel, glaubst vielleicht, dass man es einzig auf deine Wolle abgesehen hat. Ich aber für meinen Teil weiss es ganz genau, dass man mich mit dem vielen guten Essen ausschliesslich zu dem Zweck voll gestopft hat, weil man mich töten und verspeisen will. Darum lasst mich um Hilfe schreien, solange ich es noch kann! Wenn du schon so verständig bist, rief die Ziege zornig, weil das Schwein sie beunruhigt und ihr die schöne Fahrt verdorben hatte, dann höre auch auf zu jammern! Du weisst, dein Unheil steht fest, was hilft also noch das Weinen und Klagen, wenn du doch nichts mehr ändern kannst? Der Fuchs und der Hahn Ein Hahn sass auf einem hohen Gartenzaun und kündete mit lautem Krähen den neuen Tag an. Ein Fuchs schlich um den Zaun