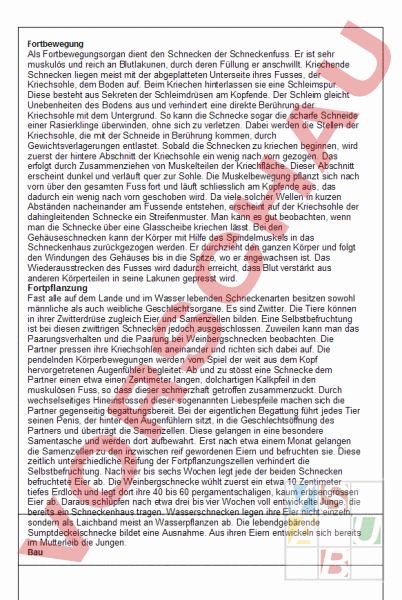Arbeitsblatt: Schnecke
Material-Details
Beschreibung von Fortbewegung, Fortpflanzung,Bau, Verdauung und Atmung, Wasserhaushalt
Versuche
Biologie
Tiere
7. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
23851
786
7
18.08.2008
Autor/in
Kuster Adolf (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Fortbewegung Als Fortbewegungsorgan dient den Schnecken der Schneckenfuss. Er ist sehr muskulös und reich an Blutlakunen, durch deren Füllung er anschwillt. Kriechende Schnecken liegen meist mit der abgeplatteten Unterseite ihres Fusses, der Kriechsohle, dem Boden auf. Beim Kriechen hinterlassen sie eine Schleimspur. Diese besteht aus Sekreten der Schleimdrüsen am Kopfende. Der Schleim gleicht Unebenheiten des Bodens aus und verhindert eine direkte Berührung der Kriechsohle mit dem Untergrund. So kann die Schnecke sogar die scharfe Schneide einer Rasierklinge überwinden, ohne sich zu verletzen. Dabei werden die Stellen der Kriechsohle, die mit der Schneide in Berührung kommen, durch Gewichtsverlagerungen entlastet. Sobald die Schnecken zu kriechen beginnen, wird zuerst der hintere Abschnitt der Kriechsohle ein wenig nach vorn gezogen. Das erfolgt durch Zusammenziehen von Muskelteilen der Kriechfläche. Dieser Abschnitt erscheint dunkel und verläuft quer zur Sohle. Die Muskelbewegung pflanzt sich nach vorn über den gesamten Fuss fort und läuft schliesslich am Kopfende aus, das dadurch ein wenig nach vorn geschoben wird. Da viele solcher Wellen in kurzen Abständen nacheinander am Fussende entstehen, erscheint auf der Kriechsohle der dahingleitenden Schnecke ein Streifenmuster. Man kann es gut beobachten, wenn man die Schnecke über eine Glasscheibe kriechen lässt. Bei den Gehäuseschnecken kann der Körper mit Hilfe des Spindelmuskels in das Schneckenhaus zurückgezogen werden. Er durchzieht den ganzen Körper und folgt den Windungen des Gehäuses bis in die Spitze, wo er angewachsen ist. Das Wiederausstrecken des Fusses wird dadurch erreicht, dass Blut verstärkt aus anderen Körperteilen in seine Lakunen gepresst wird. Fortpflanzung Fast alle auf dem Lande und im Wasser lebenden Schneckenarten besitzen sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane. Es sind Zwitter. Die Tiere können in ihrer Zwitterdrüse zugleich Eier und Samenzellen bilden. Eine Selbstbefruchtung ist bei diesen zwittrigen Schnecken jedoch ausgeschlossen. Zuweilen kann man das Paarungsverhalten und die Paarung bei Weinbergschnecken beobachten. Die Partner pressen ihre Kriechsohlen aneinander und richten sich dabei auf. Die pendelnden Körperbewegungen werden vom Spiel der weit aus dem Kopf hervorgetretenen Augenfühler begleitet. Ab und zu stösst eine Schnecke dem Partner einen etwa einen Zentimeter langen, dolchartigen Kalkpfeil in den muskulösen Fuss, so dass dieser schmerzhaft getroffen zusammenzuckt. Durch wechselseitiges Hineinstossen dieser sogenannten Liebespfeile machen sich die Partner gegenseitig begattungsbereit. Bei der eigentlichen Begattung führt jedes Tier seinen Penis, der hinter den Augenfühlern sitzt, in die Geschlechtsöffnung des Partners und überträgt die Samenzellen. Diese gelangen in eine besondere Samentasche und werden dort aufbewahrt. Erst nach etwa einem Monat gelangen die Samenzellen zu den inzwischen reif gewordenen Eiern und befruchten sie. Diese zeitlich unterschiedliche Reifung der Fortpflanzungszellen verhindert die Selbstbefruchtung. Nach vier bis sechs Wochen legt jede der beiden Schnecken befruchtete Eier ab. Die Weinbergschnecke wühlt zuerst ein etwa 10 Zentimeter tiefes Erdloch und legt dort ihre 40 bis 60 pergamentschaligen, kaum erbsengrossen Eier ab. Daraus schlüpfen nach etwa drei bis vier Wochen voll entwickelte Junge, die bereits ein Schneckenhaus tragen. Wasserschnecken legen ihre Eier nicht einzeln, sondern als Laichband meist an Wasserpflanzen ab. Die lebendgebärende Sumptdeckelschnecke bildet eine Ausnahme. Aus ihren Eiern entwickeln sich bereits im Mutterleib die Jungen. Bau Nahezu alle Vertreter der Weichtiere zeichnen sich durch den Besitz einer festen Kalkschale aus, die dem ansonsten weichen Körper manchmal äusserlich, manchmal innerlich Schutz und Festigkeit verleiht. Zu diesem Tierstamm gehören die Klassen der Schnecken, Muscheln und Tintenfische. Den Grundbauplan der Weichtiere wollen wir am Beispiel der Weinbergschnecke un tersuchen. Der Körper ist eingeteilt in Kopf, Fuss, Eingeweidesack und Mante/. Am Kopf sitzen die Sinnesorgane, der muskulöse Fuss sorgt für die Fortbewegung. Der Mantel ist der umhüllende Bereich über den Eingeweiden. Er bildet auch die harte Kalkschale aus und schützt somit die Eingeweide. Mit Hilfe eines kräftigen Rückziehmuskels können der Fuss und der Kopf in die Gehäuseschale zurückgezogen werden. Durch ihre Körperflüssigkeit kann die Schnecke sich wieder herausdrücken. Verdauung Weinbergschnecken ernähren sich, wie die meisten anderen Schnecken auch, von saftigen Pflanzenteilen. Ihre Zunge ist mit kleinen scharfen Zähnchen aus Chitin besetzt. Mit dieser Reibplatte (Radula) raspelt die Schnecke die Stücke klein. Speicheldrüsen und die Mitteldarmdrüse, auch Leber genannt, geben Verdauungssäfte dazu. Die Ausscheidung der festen unverdaulichen Stoffe erfolgt über die Atemhöhle, in die die Öffnung des Ausscheidungsorgans ein mündet. Atmung, Wasserhaushalt Die Atemhöhle ist mit feinsten Blutkapillaren ausgekleidet, die zum Gasaustausch dienen. Zusätzlich kann die Schnecke über die gesamte feuchte Körperoberfläche Sauerstoff aufnehmen. Die ungeschützte feuchte Haut verdunstet sehr viel Wasser. Je trockener die umgebende Luft, desto mehr Wasser geht verloren. Andererseits kann die Schnecke über die Haut auch Wasser aufnehmen. Die Rote Wegschnecke kann bis zu einem Drittel des Körpergewichts zusätzlich Wasser aufsaugen. Aus diesen Gründen kann man Schnecken als Feuchtlufttiere bezeichnen; sie sind dann aktiv, wenn die Luft feucht ist. Daher trifft man sie vor allem bei Regen, in der. Dämmerung oder nachts. An heissen Tagen ziehen sie sich in ihr Haus zurück. Die Schale ist ein guter Schutz vor Wasserverdunstung. Versuche 1 Beobachte von unten, wie eine Schnecke über eine Glasplatte kriecht. Zur Erklärung der Vorwärtsbewegung kannst Du die Abbildungen auf der Randspalte zu Hilfe nehmen. 2 Eine Schnecke soll über die scharfe Klinge eines Messers oder einer Rasierklinge kriechen. Wie ist es zu erklären, dass sie sich dabei nicht verletzt? 3 Ziehe mit einem Deo-Stift im Abstand von etwa 5 cm einen Kreis um eine Schnecke. Dabei soll sich die Schnecke auf einem sauberen Untergrund befinden; am besten auf einer Glasplatte. Beobachte und deute das Verhalten der Schnecke. Beschreibe den Gebrauch der Fühler. 4 Setze eine Schnecke auf ein Salatblatt und beobachte sie beim Fressen. Welche Haltung nehmen die Fühler beim Fressen ein, wie ist die Stellung des Fusses? 5 Verändere den Versuch, indem Du der Schnecke präparierte Salatblätter zum Fressen anbietest: Bestreiche dazu ein Blatt mit Kochsalzlösung, ein anderes mit Eierfarbe und ein drittes mit Essig. Damit veränderst Du den Geschmack, die Farbe und den Geruch. Notiere Deine Beobachtungen.