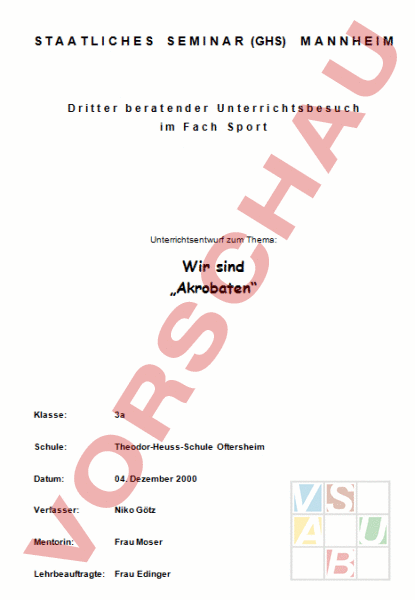Arbeitsblatt: Wir sind Akrobaten
Material-Details
Stichworte: Akrobatik, Zirkus, Körperfiguren, sozialer Kontakt
"Wir sind Akrobaten" beschreibt in einem kompletten Unterrichtsentwurf die didaktikischen und methodischen Bereiche, wenn mit einer Primarklasse (hier 3. Klasse) Akrobatik durchgeführt werden möchte.
Das besondere an diesem Unterrichtsentwurf ist, die Abrundung mit einer Präsentation (Vorführung) der erlernten Figuren.
Bewegung / Sport
Gemischte Themen
3. Schuljahr
14 Seiten
Statistik
25498
2073
109
16.09.2008
Autor/in
Niko Götz
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
STAATLICHES E I A (GHS) MANNHEIM Dritter beratender Unterrichtsbesuch im Fach Sport Unterrichtsentwurf zum Thema: Wir sind „Akrobaten Klasse: 3a Schule: Theodor-Heuss-Schule Oftersheim Datum: 04. Dezember 2000 Verfasser: Niko Götz Mentorin: Frau Moser Lehrbeauftragte: Frau Edinger INHALT 1. BEDINGUNGSANALYSE 3 1.1 Klassengefüge und Lernvoraussetzung 3 2. SACHANALYSE 4 2.1 Akrobatik und Turnen hängen miteinander zusammen 4 2.2 Einteilung der (Körper)Akrobatik nach Melczer-Lukács Zwiefka . 5 3. DIDAKTISCH ANALYSE . 7 3.1 Gegenwart- und Zukunftsbedeutung 7 3.2 Forderung des Bildungsplans . 8 4. LERNZIELE . 9 4.1 Grobziel der Stunde . 9 4.2 Feinziele der Stunde. 9 5. ABLAUF DER STUNDE 10 5.1 Aufwärmen/Einstimmen. 10 5.2 Erarbeitungsphase: Akrobatik mit dem Partner und in der Gruppe 11 5.3 Abschlusspräsentation: Vorführung der Kunststücke . 12 5.4 Abbau der Matten Abschluss der Stunde 12 7. VERLAUFSPLAN 13 8. LITERATURANGABEN UND MATERIAL . 14 3 1. Bedingungsanalyse 1.1 Klassengefüge und Lernvoraussetzung Die Klasse 3a der Theodor-Heuss-Grundschule in Oftersheim besteht aus 11 Jungen und 7 Mädchen im Alter von acht und neun Jahren. Es besitzen 17 Schüler die deutsche und ein Schüler (Bryan) die asiatische Staatsangehörigkeit. Bryan spricht und versteht die deutsche Sprache ohne Probleme. Als auffälligen Schüler erwähnte ich im Entwurf des zweiten Unterrichtsbesuchs Johann. Er hatte meiner damaligen Beobachtung nach Schwierigkeiten, sich in die Klassengemeinschaft einzufügen und distanzierte sich auch räumlich sichtbar von der Klasse. In den letzten Wochen hat sich Johann deutlich mehr in die Klassengemeinschaft integriert. Trotzdem kam es in den letzten drei Wochen zwei mal ohne jegliche Vorzeichen vor, dass er beleidigt und verärgert das Unterrichtsgeschehen verließ und jegliche Mitarbeit und Beteiligung am Unterricht boykottierte. Bei diesen Vorfällen genügte es, ihm sein 5 bis 10 Minuten einzuräumen um ihn schließlich behutsam in das Unterrichtsgeschehen wieder einzubinden. Die möglichst offen gehaltenen Bewegungsaufgaben, die in Gruppen- oder Partnerarbeit ein gemeinsames Erproben und Erfinden von Lösungen erfordern, unterstützen den Integrationsprozess. Hierbei sind die Kinder gefordert, sich auf ihre MitschülerInnen einzulassen und erfahren dabei, dass sie ein Teil der Klassengemeinschaft sind. Zu Bryan gibt es anzumerken, dass seine Frustrationstoleranz in den letzten drei Wochen abgenommen hat. Gab es Konflikte in der Klasse außerhalb oder während des Unterrichts fiel auf, dass er sehr oft beteiligt war. Die gesamte Klasse ist sehr bewegungsfreudig und verfügt inzwischen über ein sehr gutes Sozialverhalten. Dies ermöglicht, mehr und mehr die Methodenkompetenz der Kinder in einen schülerorientierten Unterrichtsverlauf einfließen zu lassen. So schafft es die Klasse sich selbständig zu organisieren, wenn es um Gruppenbildung, Geräteaufbau und -abbau geht und sind fähig, die erbrachten sportlichen Leistungen, die Mitarbeit und das jeweilige Verhalten des Einzelnen oder der Gruppe miteinander zu reflektieren und mit meiner Unterstützung zu beurteilen. 4 2. Sachanalyse Von der Wortbedeutung her ist Akrobatik (der Begriff „Akrobat stammt aus dem Griechischen) zunächst einmal die „Turnkunst (ohne Gerät). Ausgehend von Körperhaltung und Bewegungsabläufen werden in speziellem Training Eigenschaften wie Geschick, Schnelligkeit, Reaktionsvermögen und Gleichgewicht geschult. In der Schule erhält Akrobatik einen besonderen Stellenwert im Bewegungsbereich Turnen, obwohl Turnen und Akrobatik unterschiedliche Bewegungswelten repräsentieren: Turnen gehört eher der Sportwelt an, Akrobatik eher dem Zirkus und dem Kabarett, vielleicht sogar den Künsten. 2.1 Akrobatik und Turnen hängen miteinander zusammen Verstehe ich Turnen als Inbegriff einer Sammlung von Bewegungsfertigkeiten an definierten Turngeräten, ist es kaum möglich, die Bewegungswelt aus der Akrobatik mit der Bewegungswelt aus dem Turnen in Verbindung zu bringen. Bediene ich mich jedoch mit bewegungspädagogischer Absicht dem Bewegungskonzept nach GORDIJN, kann ich darstellen, welche „motorische Bedeutungen im Aktivitätsgebiet des Turnens für Kinder zugänglich sind bzw. eröffnet werden müssen. Dieses Aktivitätsgebiet des Turnens für Kinder teilt GORDIJN in drei „Bedeutungsgebiete ein: 1. Springen: Arrangements, in denen die Bedeutung des Sich-Lösens vom Boden, des Freiseins als Schweben in unterschiedlichen Konstellationen und des Landens auf dem Boden erfahren werden kann. 2. Schwingen: Arrangements, in denen die Bedeutung des Vom-BodenLoskommens, des Freiwerdens und Freibleibens vom Boden durch Bewegungshandlungen für die SchülerInnen deutlich wird. 3. Balancieren: Arrangements, in denen jemand auf begrenzte Fläche am Boden oder oberhalb des Bodens zu bleiben versucht, in denen die Spannung zwischen Gleichgewicht-Verlieren und Gleichgewicht-Wiedererlangen als Bewegungsproblem erfahrbar Balancierens gedeutet. wird. Klettern wird als Sonderfall des 5 Der für diese Stunde ausgewählte Bereich der Akrobatik ist dem Aktivitätsgebiet 3, dem Balancieren, zuzuordnen. Es leuchtet unmittelbar ein, dass in dieses Strukturkonzept weite Teile der Akrobatik einbezogen werden können. Die Integration akrobatischer Bewegungsanregungen bereichert das Turnen und ist ein neuer und den SchülerInnen einsichtiger Weg, turnerische Bewegungserfahrungen zu vermitteln. Das Einbeziehen der Akrobatik in das Schulturnen bereichert den Turnsport mit „neuen interessanten Geräten, mit Möglichkeiten der Partner- und Gruppenarbeit, das Einbinden von Bewegungssequenzen in eine Vorführung und das Unterstützen der gemeinsamen Bewegung durch Musik und Theaterrequisiten, all dies sind Dinge, die dem Turnen (etwa dem Schauturnen) nicht prinzipiell fremd sind, die aber im Bereich der Schule aufgrund der einseitigen Orientierung an turnerischen Fertigkeiten aus dem Blick geraten sind. Akrobatische Bewegungen können und sollen in der Schule den Zugang zu turnerischen Bewegungen eröffnen und zugleich das turnerische Bewegungsverständnis ergänzen, erweitern und partiell verändern.1 2.2 Einteilung der (Körper)Akrobatik nach Melczer-Lukács Zwiefka2 Dynamische Akrobatik Unter statischer Akrobatik ist der gezielte Einsatz von Techniken und Körperkräften zu verstehen, deren Anwendung nötig ist, um bestehende Positionen zu erhalten. Je sicherer ein Gleichgewichtszustand beherrscht wird, desto weniger Muskelkraft muss aufgewendet werden, um das Gleichgewicht zu erhalten. Wenn dagegen das Gleichgewicht labil ist, muss durch permanenten Krafteinsatz die Gleichgewichtsstellung neu ausbalanciert werden. Der Begriff dynamische Akrobatik bezeichnet diejenigen Kräfte und Techniken, mit denen man akrobatische Bewegungsabläufe steuert, meist unter Mitbenutzung des Erdbodens. Wie auch bei der statischen Akrobatik sind die meisten der eingesetzten Bewegungen im alltäglichen Bewegungsreportoire nicht enthalten. Solotechniken Partnertechniken (2 und mehr Pers.) Solotechniken Beispiele: • Gesäßbalance, Kopfstand, Schulterstand • Unterarmstand, Handstand • Knien auf den Oberarmen u.a. Partnertechniken Beispiele: • Schaukeln, Kern und Schale, Gallionsfigur • Flieger, Ikarische Spiele, vers. Pyramiden, u.a. 2 Statische Akrobatik • • 1 • • Solotechniken Partnertechniken (2 und mehr Pers.) Solotechniken Beispiele: • Rolle vorwärts/rückwärts, Flugrolle • Handstandrolle, Fallen, Sprungfeder • Im Handstand gehen, Rückenkippe • Handstandübers., Rad, Flic-Flac, Salto Partnertechniken Beispiele: • Doppelrolle/Doppelrolle seitlich • Bocksprung, Zirkulation, Stützrolle • Partnerschleuder u.a. vgl. TREBELS H., ANDREAS: Turnen und Akrobatik in Sportpädagogik Heft 6/92, 16.Jahrgang, S.15ff. vgl. MELCZER-LUKÁCS, GÉZA ZWIEFKA, HANS JÜRGEN: Akrobatisches Theater. Edition Aragon, 1989, S.15ff. 6 In meinem Unterricht konzentriere ich mich auf jene akrobatischen Handlungen, die ausschließlich auf dem Prinzip des Ausbalancierens der oberen Person(en) basieren und die SchülerInnen in der hierfür notwendigen Haltearbeit nicht überfordert. Solche Figuren (Pyramiden) lassen sich zumindest in der Grobform relativ leicht erlernen. Partner- und Gruppenpyramiden sind aus zwei oder mehreren Personen bestehende akrobatische Figuren, die statisch wirken und im weitesten Sinne an eine Pyramide erinnern. Partner- und Gruppenpyramiden erfordern von allen TeilnehmerInnen Kooperation und Konzentration. Vor dem eigentlichen Bau müssen Position und Bauschritte genau abgesprochen werden. Beim Auf- und Absteigen, sowie beim Abstützen, ist darauf zu achten, dass nicht die Wirbelsäule, sondern Becken und Schulter belastet werden. 7 3. Didaktisch Analyse 3.1 Gegenwart- und Zukunftsbedeutung Eine Alltagsbeobachtung Akrobatik, ist wohl eine der ersten sportlichen Betätigungen, die ein Mensch nach seiner Geburt ausübt. Vater, Mutter, Onkel, Tante usw. übertreffen sich in der Auswahl von verschiedensten Techniken, dem drei Monate alten Baby das Spiel mit dem Gleichgewicht, der Balance oder der Schwerkraft erfahrbar zu machen, wenn dies auch aus der Sicht des Babys rein passiv geschieht. Ob es auf diesen Sachverhalt zurückzuführen ist, dass der Drang der Grundschulkinder anhält, immer noch auf dem Vater oder der Mutter usw. herumzuturnen, möchte ich dahin gestellt lassen. Dieses Unterrichtsthema bietet jedenfalls die Möglichkeit, die im Unterricht gewonnenen akrobatischen Erfahrungen in der außerschulischen Lebenswelt der Kinder, so z.B. im Elternhaus, fortzuführen. Durch die veränderte Lebenswelt der Kinder muss der Schwerpunkt des Grundschulsportunterrichts nicht mehr in der Vermittlung von Fertigkeiten, sondern im Erwerb von grundlegenden Fähigkeiten liegen, da diese Grundvoraussetzungen bei recht vielen Kindern nicht mehr durch Freizeitverhalten in den Unterricht gebracht werden. Die von technischen Medien bestimmte Kinderwelt lässt Primärerfahrungen, hierzu gehören unter anderem auch der Umgang mit anderen Menschen und Dingen, das Handeln und Reflektieren in den Hintergrund treten. In dieser Stunde müssen die Kinder mit „etwas, den Matten, (Boden) und den „anderen, die Partner, die Helfer, die Zuschauer usw. umgehen. Die akrobatischen Bewegungen stellen natürlich Anforderungen an das Tun und an die Bewegungsfertigkeiten der Teilnehmer, aber wesentlich ist, dass die Kinder über die Bewegungen nachdenken können: Mache ich es richtig? Mache ich das Richtige zum richtigen Zeitpunkt? Wie kann ich es noch verbessern? 8 Dieses Nachdenken bezieht sich nicht nur auf die Bewegung, sondern auch auf den Umgang miteinander, auf die Art, wie zusammengearbeitet wird, zwischen denjenigen oben, unten, denjenigen, die Hilfe leisten und den Zuschauern.3 3.2 Forderung des Bildungsplans Der Unterrichtsgegenstand Akrobatik fällt wie bereits erwähnt in den Bereich des Turnens (siehe 2 Sachanalyse) und ist dort dem Balancieren zugeordnet, dem „Balancieren auf- und miteinander und dem „Im-Gleichgewicht-Bleiben. Forderungen des Grundschulbildungsplans die Bewegungsbereiche der Akrobatik beinhalten, sind im Erfahrungs- und Lernbereich (ELb) 1: „SPIELEN-SPIEL . und im Erfahrungs- und Lernbereich (ELb) 2: „SICH BEWEGEN MIT UND OHNE GERÄT . enthalten. Im ELb 1 sollen die Kinder ihre Fähigkeiten erweitern, gemeinsam zu spielen und leistungsschwächere Kinder in das Spiel mit einzubeziehen. Das selbständige Organisieren gewinnt zunehmend an Bedeutung. Balancieren und das Gleichgewicht halten mit dem Partner oder in der Gruppe wird in der Akrobatik mit dem eigenen und dem Körper des Partners (oder der Partner) gefordert und entwickelt. Die Kinder lernen in der ELb 2, sich dem Partner oder der Gruppe anzupassen. Dabei führen sie haltungsfördernde und die Körperspannung wahrnehmende Übungen durch. Akrobatik ermöglicht Partner- und Gruppenformen zur allgemeinen Kräftigung und fordert entschieden die Kinder darin, ihre Bewegungserfahrungen in Übereinstimmung mit dem Partner oder der Gruppe zu machen. 3 vgl. AARTSMA, DICK: Gemeinsam Balance halten. In: Sportpädagogik Heft 6/92, 16.Jahrgang, S.28ff. 9 4. Lernziele 4.1 Grobziel der Stunde Die Kinder sollen mit dem Partner oder in der Gruppe akrobatischen Figuren vorführen. 4.2 Feinziele der Stunde Motorischer Lernzielbereich (mZ): mZ1 Die SchülerInnen sollen ihre Körperspannung verbessern. mZ2 Die SchülerInnen sollen ihre Balance mittels entsprechender Körperhaltung entdecken. mZ3 Die Kinder sollen auf dem Partner/den Partnern ihr Gleichgewicht für 2-5 sec. halten können. Sozialer und kognitiver Lernzielbereich (skZ): skZ1 Die SchülerInnen sollen entsprechende Sicherheitshinweise beachten. skZ2 Die Kinder sollen darauf achten, dass sie ihrem Partner nicht weh tun. skZ3 Die SchülerInnen sollen Vertrauen zueinander entwickeln. skZ4 Die Kinder sollen eine Bewegungsaufgabe in Form einer Abbildung erkennen und in Bewegung umsetzen können. SkZ5 Die SchülerInnen sollen ihre Gedanken und Ideen, wie die Bewegungsaufgabe gelöst werden kann, gegenseitig austauschen. SkZ6 Die Kinder sollen ihre eingeübten Figuren dem Publikum präsentieren. 10 5. Ablauf der Stunde 5.1 Aufwärmen/Einstimmen Allgemeines Aufwärmen Freies Spiel – offener Beginn (nur wenige Minuten) Der Beginn der Stunde entspricht dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder. Die Kinder, die sich schnell umgezogenen haben, erhalten in der Halle die Möglichkeit, ohne meine Mitwirkung sich mit Sprungseilen und/oder Teppichfliesen zu betätigen. Die Kinder haben sich mit mir auf bestimmte Verhaltensregeln während dieser Phase geeinigt, die wir bei einem gemeinsamen Gespräch aufgestellt haben. Diese Verhaltensregeln sind Voraussetzung dafür, dass vor dem offiziellen Beginn der Sportstunde, ohne meine Mitwirkung, Spiele mit dem Sprungseil und den Teppichfliesen gespielt werden dürfen. Die Verhaltensregeln: „Ich streite nicht um Geräte (Seil, Teppichfliese). „Ich nehmen Rücksicht auf andere Kinder. „Ich nehme mich auch mal zurück und höre den anderen Kindern zu. Offizielles Begrüßen Diese erste Besprechungspause nütze ich, um die SchülerInnen und die Gäste offiziell zu begrüßen. Spezifisches Aufwärmen Veranschaulichung: Körperspannung Den Übergang vom freien Spiel zum geleiteten Unterricht vollziehe ich, indem Schülergruppen ihre erfundenen Transportspiele mit Seil und Teppichfliese vorführen und die anderen Kinder daraufhin diese nachahmen oder selbst welche erfinden. Aufwärmspiel zur Körperstabilisation Während dieser Phase der spezifischen Aufwärmung demonstriere ich den Kindern die Wirkung von Körperspannung im Sport. Die Klasse erhält den Auftrag, eine Mumie, die ausgegraben wurde, aus dem „Grab zu heben und aufzustellen. Ich selbst lege mich auf den Boden und stelle diese Mumie dar. 11 Bei zwei Versuchen die Mumie aufzustellen, einmal mit und einmal ohne Körperspannung der Mumie, wird den SchülerInnen klar, dass Körperspannung notwendig ist, um einen Menschenkörper zu bewegen (auf die Beine zu stellen). Mit dieser Einsicht führen die Gruppen noch einmal Transportspiele durch. Die Kinder achten jetzt mehr auf die Körperspannung der zu transportierenden SchülerInnen. Mattenaufbau: Nach meinem Pfiff (eingewöhntes Ritual) und dem entsprechenden Handzeichen sammeln die Kinder die Geräte ein und setzen sich zur weiteren Besprechung ab. Nach dieser spezifischen Aufwärmung stelle ich das Unterrichtsthema „Akrobatik vor. Nun erhalten die SchülerInnen die notwendigen Informationen des Mattenaufbaus. Ich lege den Aufbau der Matten mit Mattenkarten auf dem Hallenboden aus. Die Schüler bauen dem Mattenmodell entsprechend die Matten auf. 5.2 Erarbeitungsphase: Akrobatik mit dem Partner und in der Gruppe Bevor die SchülerInnen mit der Erarbeitung akrobatischer Figuren beginnen, erinnere ich sie noch einmal an die Sicherheitsregeln. Drei Regeln sind mir wichtig: 1. Zur Ausführung der Akrobatik werden die Schuhe ausgezogen! 2. Im Vierfüßlerstand beträgt die Winkelstellung der Arme und Beine zum Rumpf 90! 3. Die Standposition auf einem Partner befindet sich auf dem Steißbein und den Schultern und nicht dazwischen auf der Lendenwirbelsäule! Da sich die SchülerInnen zum zweiten Mal mit Akrobatik im Unterricht beschäftigen (vor vier Wochen habe ich eine Schulstunde lang in die Thematik eingeführt) und sie die Akrobatikkarten deshalb schon kennen, genügt den Kindern der Hinweis, sich paarweise, in 3er- oder maximal in 4er-Gruppen zusammenzufinden, um zwei verschiedene Akrobatikaufgaben gemeinsam zu lösen. Damit die jeweilige Gruppe selbst die zwei Akrobatikbilder auswählen kann, lege ich die Akrobatikbilder nach der Anzahl der erforderlichen Akrobaten geordnet zur Einsicht aus. Haben die Gruppen ihre Akrobatikbilder ausgewählt und ich die Auswahl der Figuren auf Besonderheiten (Schwierigkeitsgrad, Hilfsmittel, Anzahl der Akrobaten) kontrolliert, beginnen die SchülerInnen die akrobatischen Bewegungsaufgaben zu lösen. 12 Während dieser Erarbeitungsphase stehe ich beratend und unterstützend den Schülergruppen zur Seite. An dieser Stelle sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Unterrichtsthema („Akrobatik) dazu dient soziale und koordinative Ziele zu verwirklichen. Der Umgang mit dieser Thematik erfordert einen behutsamen Umgang des Lehrers mit den SchülerInnen sowie der SchülerInnen untereinander. Dabei kann die physische Belastung der Kinder nur ein geringes Maß erreichen und ist beabsichtigt. Die zeitintensive Unterrichtsform die Präsentation nimmt hierbei eine wichtige Rolle ein, soziale und koordinative Ziele zu verwirklichen. 5.3 Abschlusspräsentation: Vorführung der Kunststücke Nun präsentieren die Gruppen ihre Figuren den MitschülerInnen. In Form einer Zirkusaufführung darf abschließend jede Akrobatikgruppe vor dem Zirkuspublikum (MitschülerInnnen und Unterrichtsgäste) eine akrobatische Figur darbieten. Hierzu stellen die Kinder zwei Langbänke entsprechend zurecht und bitten die Gäste Platz zu nehmen. 5.4 Abbau der Matten Abschluss der Stunde Nach der Aufführung stellen die Kinder die Langbänke an die Wand, räumen die Matten auf die Mattenwagen und fahren diese in den Geräteraum. Bevor ich die Kinder zum Umkleiden entlasse, erhalten sie eine Urkunde, die bestätigt, dass sie sich nach dieser erbrachten Leistung Akrobatik-Meister nennen dürfen. 13 7. Zeit -11.20 11.201125 Verlaufsplan Unterrichtsphase Material Aufwärmen/Einstimmen Offener Beginn der Stunde Teilziele (Seite 9) Freies Spielen mit dem Sprungseil und Teppichfliesen (nur kurze Zeit): SKZ2 MZ1 Aufbau: Nun stelle ich das Unterrichtsthema „Akrobatik vor. Die Kinder bauen dem Mattenmodell entsprechend die Matten auf. Erarbeitungsphase Sicherheitshinweise 11.4511.55 Abschlusspräsentation 2 Langbänke 11.5512.05 Aufräumen der Matten Abschluss der Stunde Mattenwagen, Urkunden Anschauliche Demonstration der Körperstabilisation Die SchülerInnen bekommen einen Der Lehrer als Mumie. Die Kinder heben mich „aus dem Sarg und stellen Einblick, wie wichtig richtige Körpermich auf die Füße. spannung im Sport ist. Die veranschaulichte Körperspannung wird nun auch von den zu transportierenden Kindern beachtet. Nach meinem Zeichen räumen die SchülerInnen Seile und Teppichfliessen auf und sammeln sich zur Besprechung. Aufbau der Matten 5 Mattenstationen mit jeweils 2 Matten 11.3511.45 Es sind Spiele allein, zu zweit oder in Gruppen möglich. Ich begrüße die Kinder und die Gäste. Veranschaulichung der Körperstabilisation Transportspiel in der Gruppe Hinweise zur Vermittlung Die Schülergruppen, die Transportspiele mit dem Seil und Teppichfliesen durchführen, demonstrieren ihr Transportspiel, welches als Anregung für Zwei bis vier Kinder in einer Gruppe. die Kinder dient, die nicht solche Transportspiele durchgeführt haben. Die SchülerInnen spielen Transportspiele mit Seil und Teppichfliese. Spezifisches Aufwärmen Offizielle Begrüßung 11.2511.35 Verlauf, Impulse, Aufgaben, Regeln SKZ1 SKZ2 SKZ3 SKZ4 SKZ5 MZ2 MZ3 SKZ6 MZ2 MZ3 Akrobatik in den Gruppen Vor Beginn der Erarbeitung der Akrobatikfiguren weise ich auf drei Sicherheitsregeln hin. Die Paare oder Gruppe finden sich zusammen und suchen jeweils 2 Bildkarten aus. Die Kinder beginnen mit der Erarbeitung der Bewegungsaufgabe. Die Paare, die 3er-, die 4er-Gruppen tauschen untereinander die Bewegungsbilder aus und versuchen, die „neue Bewegungsaufgabe zu lösen. Vorführung der Kunststücke Jede Gruppe präsentiert eine Akrobatikfigur den MitschülerInnen und den Gästen. Abbau der Matten Abschlussgespräch Nach einem abschließenden Gespräch erhalten die Kinder eine Urkunde für ihre Vorführleistung. Der Mattentransport erfolgt jeweils in 4er-Gruppen. Es ist darauf zu achten, dass die Kinder mit den Matten gehen und nicht rennen –Verletzungsgefahr. Nach dem Prinzip vom Leichten zum Schweren und den sportlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten entsprechende kontrolliere ich die Auswahl der jeweiligen Bildkarten. Während der Erarbeitung unterstütze und berate ich die SchülerInnen bei Fragen oder Schwierigkeiten. Hier steht die Vorführung vor Publikum im Vordergrund. Anerkennung der Leistung mittels der Urkunde. 14 8. Literaturangaben und Material BILDUNGSPLAN für die Grund- und Hauptschule Baden-Württemberg. Lehrplanheft 1/1994. Neckar-Verlag, Villingen-Schwenningen 1994. SPORTPÄDAGOGIK: Hrsg. E. Balz, u.a., Zeitschrift für Sport-, Spiel- und Bewegungserziehung, Heft 6/92, 16. Jahrgang, Friedrich Verlag, Velber, 1992. MELCZER-LUKÁCS, GÉZA ZWIEFKA HANS, JÜRGEN: Akrobatisches Theater, Edition Aragon, 1. Aufl., Neuß, 1989. Material: Sprungseile Teppichfliesen Stuhl Bildkarten 10 kleine Matten 2 Langbänke Urkunden für die SchülerInnen