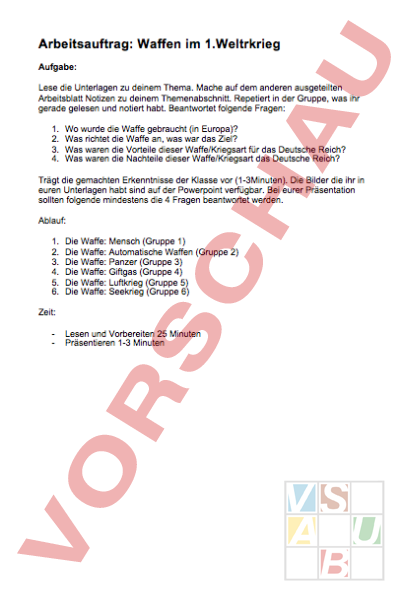Arbeitsblatt: Waffen im 1. Weltkrieg
Material-Details
Gruppenarbeit zum Thema Waffen im 1. Weltkrieg
In Gruppen untersuchen die SS eine Waffe und stellen sie anschliessend im Plenum dem Rest der Klasse vor!
Material für 6 Gruppen
Geschichte
Neuzeit
8. Schuljahr
0 Seiten
Statistik
25939
1255
51
24.09.2008
Autor/in
Jonas Hottiger
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Arbeitsauftrag: Waffen im 1.Weltrkrieg Aufgabe: Lese die Unterlagen zu deinem Thema. Mache auf dem anderen ausgeteilten Arbeitsblatt Notizen zu deinem Themenabschnitt. Repetiert in der Gruppe, was ihr gerade gelesen und notiert habt. Beantwortet folgende Fragen: 1. 2. 3. 4. Wo wurde die Waffe gebraucht (in Europa)? Was richtet die Waffe an, was war das Ziel? Was waren die Vorteile dieser Waffe/Kriegsart für das Deutsche Reich? Was waren die Nachteile dieser Waffe/Kriegsart das Deutsche Reich? Trägt die gemachten Erkenntnisse der Klasse vor (1-3Minuten). Die Bilder die ihr in euren Unterlagen habt sind auf der Powerpoint verfügbar. Bei eurer Präsentation sollten folgende mindestens die 4 Fragen beantwortet werden. Ablauf: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Die Waffe: Mensch (Gruppe 1) Die Waffe: Automatische Waffen (Gruppe 2) Die Waffe: Panzer (Gruppe 3) Die Waffe: Giftgas (Gruppe 4) Die Waffe: Luftkrieg (Gruppe 5) Die Waffe: Seekrieg (Gruppe 6) Zeit: Lesen und Vorbereiten 25 Minuten Präsentieren 1-3 Minuten Die Waffe: Mensch Leben in den Gräben Die Zeit, die ein Soldat an der direkten Frontlinie verbrachte, war üblicherweise kurz. Sie reichte von einem Tag bis zu zwei Wochen, bevor die Einheit abgelöst wurde. Das typische Jahr eines Soldaten konnte in etwa folgendermaßen aufgeteilt werden: • • • • • 15 Frontgraben 10 Unterstützungsgraben 30 Reservegraben 20 Pause 25 anderes (Krankenhaus, Reisen, Ausbildung, etc.) Das Leben in den Schützengräben war miserabel. Man hatte wenig Nahrung, keine Privatsphäre, schlechte Liegeplätze und dauernd Explosionsmusik. In einigen Bereichen der Front kam es seltener zu Kämpfen, so dass das Leben an diesen Abschnitten vergleichsweise einfach war. Andere Sektoren waren der Schauplatz blutiger Kämpfe. Allerdings kam es auch in Abschnitten, die als ruhig angesehen wurden, zu zahlreichen Verlusten. In den ersten sechs Monaten des Jahres 1916, nahmen die Briten an keiner größeren Schlacht teil; trotzdem fielen in dieser Zeit 107.776 britische Soldaten. Tagsüber machten Scharfschützen und Artilleriebeobachter jede Bewegung aus den Schützengräben sehr gefährlich, so dass es meist ruhig war. In den Gräben wurde meist in der Nacht gearbeitet, wenn im Schutz der Dunkelheit Einheiten und Nachschub bewegt, die Gräben ausgebaut und gewartet und der Gegner ausgekundschaftet werden konnten. Posten in vorgeschobenen Stellungen im Niemandsland lauschten auf jede Bewegung in den feindlichen Linien, um einen bevorstehenden Angriff erkennen zu können. Zu Beginn des Krieges wurden überfallartige Überraschungsangriffe durchgeführt. Jedoch machte die verstärkte Wachsamkeit der Verteidiger diese Art der Überfälle immer schwieriger. 1916 wurden die Überfälle zu sehr sorgfältig vorbereiteten Missionen. Auch die Soldaten wurden wie Geschütze und Munition als einzusetzendes Material betrachtet. Ihnen wurde täglich der Einsatz ihres Lebens abverlangt. Der Tod wurde als Heldentod fürs Vaterland verklärt und sollte seinen individuellen Schrecken verlieren. Die roten Linien sind die Fronten um 1916. Dort waren, vor allem im Westen, die Schützengräben. Die Waffe: Automatische Waffen Bei Kriegsbeginn waren die beteiligten Soldaten mit sehr schweren Maschinengewehren ausgerüstet, die zwei oder drei Mann zur Bedienung benötigten. Für das von den Briten im Kriegsverlauf entwickelte Maschinengewehr reichte ein Mann. Die Deutschen folgen gegen Kriegsende mit einer tragbaren Maschinenpistole. Die schwere Artillerie war effizient wie nie zuvor, zudem wurden Geschosse eingesetzt, die besonderen Schaden anrichteten, und die Soldaten gleich reihenweise niedermähten bzw. ihnen wegen des unzureichenden Schutzes von Kopf und Körper erhebliche Versehrungen zufügten. Durch Artilleriefeuer starb rund die Hälfte aller Gefallenen im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg erwies sich das MG 08 aufgrund seines hohen Gewichts als nur bedingt für den Grabenkampf geeignet. Seine Stärken spielte es in gut ausgebauten Stellungen aus: Bei der Abwehr gegnerischer Angriffe zeigte es sehr schnell die enorme Leistungsfähigkeit. Es war aber viel zu schwer, um die eigene Infanterie auch im Angriff zu unterstützen. Weiterentwicklungen wurden notwendig. Der Einsatz von Maschinengewehren dieser Art war, zusammen mit Stacheldrahtverhauen, verantwortlich für die meisten Kriegstoten des Ersten Weltkriegs. Die hohen Verlustziffern waren zum einen der verhältnismäßig hohen Kadenz der MGs zuzuschreiben, die dann zudem in den meist zickzackförmig angelegten Gräben den stürmenden Gegner leicht ins Kreuzfeuer nehmen konnten. Die Drahtverhaue und andere Hindernisse verlangsamten den Vorstoß noch mehr, der Angreifer blieb buchstäblich hängen und war dann ein noch leichteres Ziel. Die Waffe: Panzer Im Herbst 1914, als der Erste Weltkrieg sich an der französischen Front zu einem in festgefahrenen Fronten erstarrten Stellungskrieg entwickelte, wurden auf Seiten der Alliierten erstmals Überlegungen angestellt, wie man mit Hilfe einer machtvollen motorisierten Waffe die erstarrten Fronten wieder in Bewegung setzen könnte. Um trotz Trommelfeuers der feindlichen Linie vorrücken zu können, wurden ab Februar 1916 von den Briten Panzer (sog. Tanks) entwickelt. Die Geländegängigkeit der Tanks sollte es ermöglichen, Breschen in die deutschen Graben- und Sperranlagen schlagen. Erstmals setzten die Alliierten in der Somme-Schlacht Tanks ein mit wenig Erfolg. Die ersten Panzer wurden im Ersten Weltkrieg ab September 1916 von den britischen Streitkräften eingesetzt. Sie waren einfach gepanzerte Fahrzeuge, die entweder mit MGs oder mit Kanonen bewaffnet waren. Das Rüstungsprojekt trug die bewusst irreführende Tarnbezeichnung Tank, mit dem der Bau von beweglichen Wasserbehältern vorgetäuscht werden sollte. Den ersten Panzer-Angriff führte die britische 4. Armee am 15. September 1916 mit mäßigem Erfolg in der Somme-Schlacht durch. Am 20. November 1917 griff die britische Armee mit der für damalige Verhältnisse gewaltigen Anzahl von 375 Tanks die deutschen Stellungen bei Cambrai an. Die ersten Panzer erreichten im Feld geringe Geschwindigkeiten, so dass die eigene Infanterie folgen konnte. Ihr Nutzen bestand vor allem darin, dass sie der Infanterie einen Weg durch ausgedehnte Stacheldrahtverhaue bahnen konnten. Erst die schnelleren, als Kavalleriepanzer bezeichneten, Fahrzeuge wie der Whippet, konnten durch eine Lücke in der feindlichen Verteidigung durchbrechen und das Hinterland angreifen. Die Panzerung war gegen Geschütze, Handgranaten und Flammenwerfer anfällig. Tiefe Gräben konnten bereits ein unüberwindbares Hindernis für die Panzer darstellen. Viele Panzer fielen wegen technischer Defekte aus. Die Waffe: Kriegsschiffe, U-Boote Seekrieg Auf den Weltmeeren standen sich zum Anfang des Krieges hauptsächlich die Kaiserliche Marine Deutschlands und die Grand Fleet Großbritanniens gegenüber. Aufgrund der Übermacht britischer Schiffe konnten die Deutschen 1914 nicht in die Offensive gehen, weswegen besonders die alliierte Schifffahrt im Ärmelkanal ohne große Störungen erfolgen konnte. Aufgrund der Zurückhaltung der Mittelmächte, die dem Krieg auf den Schlachtfeldern Frankreichs vorerst größere Beachtung schenkten, konnten die Briten ungestört die Seeherrschaft über die Nordsee erringen und eine Seeblockade einleiten. Das Ziel der Blockade war es, Deutschland von allen Zufahrten des Seewegs zu trennen. Damit wurden wichtige Rohstoffe von fernen Ländern nach Grossbritannien umgeleitet. Die bedeutsamste Entwicklung war das U-Boot. Die deutschen U-Boote waren in der Lage, die britische Blockade auf europäischer See zu bekämpfen, und den Konflikt letztendlich auch zu gewinnen. Die U-Boote blieben so lange unbemerkt, bis es zu spät war, so dass sie bis zur amerikanischen Küste gelangen konnten. Eine andere Waffe, die in den letzten Kriegsjahren auftrat, waren Flugzeugträger. Sie spielten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Schiffe und Kriege der Zukunft Um das Ungleichgewicht der Kräfte zu kompensieren, leiteten die Deutschen den UBoot-Krieg ein. Nachdem man die Wirksamkeit der U-Boote erkannt hatte, entschloss man sich auch Handelsschiffe zu attackieren, um die Briten von ihrem überlebenswichtigen Nachschub abzuschneiden. Das Ziel der Deutschen war es, mit ihrer Hochseeflotte die Briten entscheidend zu schwächen. Letztlich endete die bisher größte Seeschlacht der Weltgeschichte mit einem Unentschieden. Als sich das Ende des Krieges anbahnte, sollte gegen den Willen der neuen deutschen Regierung am 28. Oktober 1918 noch einmal ein Großangriff auf die britische Marine stattfinden, worauf der Matrosenaufstand von Kiel losbrach und der Seekrieg somit sein Ende fand. Die Meuterei der Matrosen leitete auch die Entwicklung zur Novemberrevolution in Deutschland ein. Die Waffe: Giftgas Der Erste Weltkrieg war der erste Krieg, in dem Giftgas eingesetzt wurde. Der Krieg an der Westfront hatte sich schnell zum Stellungskrieg entwickelt. Geländegewinne waren kaum möglich, da beide Seiten sich in ihren Schützengräben eingegraben hatten. Aus militärstrategischer Sicht erforderte diese Situation den Einsatz einer Flächenwaffe, mit der man dem Feind von oben zusetzen konnte. Die klassische Waffe dafür war die Artillerie. Besonders für die Deutschen ergab sich jedoch das Problem, dass die Sprengstoffproduktion nicht mit dem Bedarf der Militärs Schritt halten konnte. Es mangelte an Rohstoffen, vor allem an Nitrat, welches damals aus Chile über den Atlantik, und damit durch vom Feind kontrolliertes Gebiet, importiert werden musste. In dieser Situation entstand der Plan, statt Sprenggranaten giftige Chemikalien zu verschießen. Der Einsatz von Gift galt zuvor als unmilitärisch und war laut Haager Landkriegsordnung verboten. Die Entwickler neuer Kriegswaffen stellten ethische Bedenken zurück und fingen an, nach geeigneten Stoffen zu suchen. Bis Kriegsende hatte man 3000 verschiedene Substanzen auf ihre Brauchbarkeit als Waffe geprüft. Da man mit durch die Artillerie verschossenem Giftgas augenscheinlich Probleme hatte, erfand man etwas Neues: Man nahm nun Chlorgas, das sehr billig zu erhalten war, da es ein Abfallprodukt der chemischen Industrie war. Um den Stoff zum Feind zu bringen, entwickelte Fritz Haber das Habersche Blasverfahren, mit dem das Chlorgas (schwerer als Luft und daher in Bodennähe konzentriert) nicht verschossen, sondern aus Behältern bei entsprechender Windrichtung in die französischen Schützengräben geblasen wurde. Zum ersten Mal hatte ein Gaseinsatz durchschlagenden „Erfolg: Am 22. April 1915 fielen in Ypern (Belgien) 5.000 Menschen einem deutschen Chlorgaseinsatz zum Opfer, 15.000 weitere erlitten Vergiftungen. Dieses Datum wird heute als Beginn der chemischen Kriegsführung angesehen. Zu dieser Zeit wurden auch die ersten Gasmasken erfunden. Nach einigen Monaten hatten beide Seiten ihre Soldaten flächendeckend mit Gasmasken ausgerüstet. Die Waffe: Flugzeuge, Zeppeline, Ballone Luftkrieg Die wenig robusten Flugzeuge bei Kriegsbeginn wurden hauptsächlich zur Fernaufklärung eingesetzt. Es entwickelte sich die Erkenntnis, dass Ballons und Aufklärer direkt aus der Luft angegriffen werden mussten, da es an ausreichenden und praktischen Möglichkeiten der Luftverteidigung vom Boden aus mangelte. Bomben und Propaganda-Material wurden von Flugzeugen bereits zu Beginn des Krieges über feindlichen Städten abgeworfen. Die Luftschiffe (Zeppelin) wurden einerseits zur Aufklärung, andererseits für Luftangriffe mit Bomben genutzt. Trotz ihres technischen Vorsprungs gegenüber Flugzeugen gingen schon ab den ersten Tagen des Krieges viele deutsche Luftschiffe verloren. Das lag nicht zuletzt daran, dass sie von den mit der Technik unerfahrenen Militärstrategen mit Aufgaben betraut wurden, für die sie nicht geeignet waren. So griffen die Schiffe anfangs am helllichten Tag stark verteidigte Ziele an der Westfront an und wurden nicht selten durch Infanteriefeuer zu Boden gebracht, meist, weil durch die von Kugeln durchsiebte Hülle zuviel Traggas verloren ging. Insgesamt betrachtet, hatten die Bombardierungen einen militärischen und strategischen Nutzen, der weit über die materiellen Schäden hinausging. Großbritannien musste erhebliche Mittel in den Aufbau einer Luftabwehr stecken und eine große Zahl von Fliegereinheiten für die Heimatverteidigung statt für den Kampf an der Front einsetzen. Die Produktionsausfälle durch Bombenalarme waren ebenfalls größer als der direkt angerichtete Schaden. Ende des Krieges Die letzte deutsche Großoffensive vom 15. Juli 1918 bei Reims und in der Champagne verpuffte nahezu wirkungslos, trotz erneut sehr starker Artillerievorbereitung. Begünstigt durch die immer stärkere US-amerikanische Unterstützung konnten die Alliierten bereits am 18. Juli zwischen Marne und Aisne zur Gegenoffensive übergehen. An der Somme, in der Panzerschlacht bei Amiens (8. August 1918) mussten die Deutschen eine schwere Niederlage hinnehmen. Auf deutscher Seite sprach man vom „schwarzen Tag des deutschen Heeres. Das deutsche Heer war bereits deutlich geschwächt. Einerseits wurden schon die ersten Angehörigen des Jahrgangs 1900 an die Front geschickt, andererseits konnte man nicht umhin, Soldaten weit über 30 Jahren und Familienväter weiter an der Front zu belassen. Die mittleren Altersgruppen waren durch die vorausgegangenen Kriegsjahre bereits stark dezimiert. Ab dem Sommer 1918 gerieten zudem immer mehr deutsche Soldaten in alliierte Gefangenschaft. Bereits am 14. August stufte die OHL die militärische Lage als aussichtslos ein. Die deutschen Truppen mussten sich nun langsam aber stetig zurückziehen. Im November 1918 hielten sie nur noch einen kleinen Teil Nordostfrankreichs und gut die Hälfte Belgiens sowie Luxemburg besetzt. Die Deutschen leisteten trotz hoher Verluste und stark abnehmender Truppenstärke bis zum Schluss hartnäckigen Widerstand. Daher gelang den Alliierten bis zuletzt kein entscheidender Durchbruch, was der sogenannten Dolchstoßlegende nach dem Krieg zum Auftrieb verhalf. Ab dem 15. September 1918 brach der Widerstand der bulgarischen Armee nach einem Durchbruch der Alliierten in der mazedonischen Front komplett zusammen. Vor diesem Hintergrund verlangten Hindenburg und Ludendorff am 29. September ultimativ die Ausarbeitung eines Waffenstillstandsangebots durch politische Vertreter des Reiches. Um Verhandlungen auf der Basis des 14-Punkte-Programms des amerikanischen Präsidenten zu erlangen, empfahl Ludendorff zugleich, die Reichsregierung vom Vertrauen des Parlaments abhängig zu machen. Daraufhin forderte der Kaiser mit Erlass am 30. September die Einführung eines parlamentarischen Regierungssystems, was durch Beschluss des Reichstags zur Verfassungsänderung vom 28. Oktober auch umgesetzt wurde (siehe: Oktoberreform). Der neue, vom Parlament bestätigte Reichskanzler Max von Baden hatte Woodrow Wilson bereits am 4. Oktober ein entsprechendes Waffenstillstandsangebot unterbreitet. Die USA forderten daraufhin die Räumung der von den Deutschen besetzten Gebiete, die Einstellung des uneingeschränkten UBoot-Krieges und die Abschaffung der Monarchie. Gerade die Abschaffung der Monarchie wird jedoch von Regierung und SPD abgelehnt. Im Oktober 1918 begann sich die Donaumonarchie aufzulösen. Am 28. Oktober wurden die österreichisch-ungarischen Truppen an der italienischen Front (am Piave) in Venetien entscheidend geschlagen (Schlacht von Vittorio Veneto). Am selben Tag wurde die Gründung der Tschechoslowakei beschlossen, während am darauf folgenden Tag Jugoslawien gegründet wurde. Am 1. November bildete sich eine unabhängige Regierung in Ungarn. Am 3. November unterzeichnete General Viktor Weber Edler von Webenau den Waffenstillstand von Villa Giusti mit den Alliierten. Acht Tage später dankte Kaiser Karl I. ab und verzichtete auf jegliche Beteiligung an der neuen österreichischen Regierung. Ungeachtet der deutschen Waffenstillstandsbemühungen befahl die deutsche Admiralität für den 29. Oktober das Auslaufen der Flotte zu einer letzten, verzweifelten Schlacht („ehrenvoller Untergang) gegen die überlegene Royal Navy. Daraufhin kam es in Wilhelmshaven zu Meutereien. Man verlegte die Flotte deshalb zum Teil nach Kiel und wollte die Meuterer bestrafen. Es brach ein Matrosenaufstand aus, der sich innerhalb weniger Tage zur Revolution, der Novemberrevolution entwickelte. In zahlreichen deutschen Städten wurden Arbeiter- und Soldatenräte gegründet. Kurt Eisner rief in München den Freistaat Bayern aus. Hier folgte im Frühjahr 1919 die Münchner Räterepublik. Die Revolution erfasste am 9. November auch Berlin, wo Reichskanzler Prinz Maximilian von Baden aus Sorge vor einem radikalen politischen Umsturz eigenmächtig die Abdankung des Kaisers bekannt gab und die Reichskanzlerschaft auf den Vorsitzenden der SPD, Friedrich Ebert, übertrug. Am Nachmittag desselben Tages rief Philipp Scheidemann die deutsche Republik aus. Karl Liebknecht vom Spartakusbund proklamierte die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Sowohl der Kaiser als auch sämtliche deutsche Fürsten dankten ab. Kaiser Wilhelm II. floh am 10. November ins niederländische Exil. Ab 7. November verhandelten der französische Marschall Foch und vier deutsche Politiker der Regierung Max von Badens unter Führung von Matthias Erzberger (Vorsitzender der katholischen Zentrumspartei) in einem Salonwagen im Wald von Compiègne über den Waffenstillstand zwischen den Alliierten und dem Deutschen Reich. Nach dem Regierungswechsel drängte Friedrich Ebert auf eine Unterzeichnung des von Frankreich diktierten Vertrages. Am 11. November um 5 Uhr früh unterzeichneten die beiden Parteien den Waffenstillstandsvertrag. Dieser sah unter anderem die Bedingungen für die Räumung der von der deutschen Armee besetzten Gebiete und des linken Rheinufers vor, das zusammen mit drei Brückenköpfen in Mainz, Koblenz und Köln von den Alliierten besetzt wurde. Zudem wurde der Friedensvertrag von Brest-Litowsk aufgehoben. Durch die Verpflichtung zur Abgabe großer Mengen von Transportmitteln und Waffen sowie die Internierung der Hochseeflotte wurde dem Reich die Weiterführung des Krieges praktisch unmöglich gemacht, obwohl der Waffenstillstand immer nur für 30 Tage galt und dann verlängert werden musste. Ab 11. November 11 Uhr schwiegen die Waffen. Arbeitsblatt: Zusammenfassungen zu den Präsentationen Die Waffe: Mensch (Gruppe 1) Die Waffe: Automatische Waffen (Gruppe 2) Die Waffe: Panzer (Gruppe 3) Die Waffe: Giftgas (Gruppe 4) Die Waffe: Luftkrieg (Gruppe 5) Die Waffe: Seekrieg (Gruppe 6)