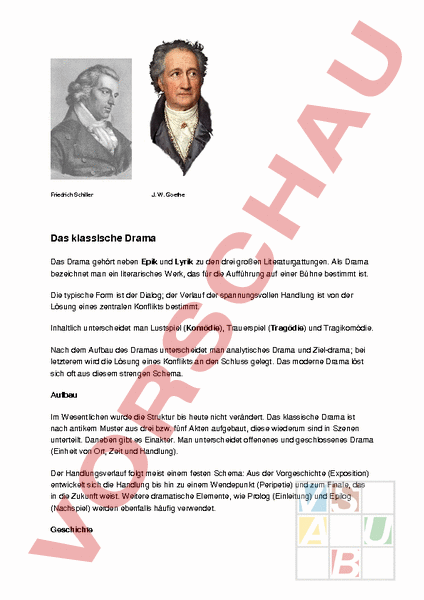Arbeitsblatt: Klassisches Drama
Material-Details
Geschichte und Theorie des klassischen Dramas
Deutsch
Leseförderung / Literatur
9. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
35981
974
12
03.03.2009
Autor/in
re (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Friedrich Schiller J. W. Goethe Das klassische Drama Das Drama gehört neben Epik und Lyrik zu den drei großen Literaturgattungen. Als Drama bezeichnet man ein literarisches Werk, das für die Aufführung auf einer Bühne bestimmt ist. Die typische Form ist der Dialog; der Verlauf der spannungsvollen Handlung ist von der Lösung eines zentralen Konflikts bestimmt. Inhaltlich unterscheidet man Lustspiel (Komödie), Trauerspiel (Tragödie) und Tragikomödie. Nach dem Aufbau des Dramas unterscheidet man analytisches Drama und Zieldrama; bei letzterem wird die Lösung eines Konflikts an den Schluss gelegt. Das moderne Drama löst sich oft aus diesem strengen Schema. Aufbau Im Wesentlichen wurde die Struktur bis heute nicht verändert. Das klassische Drama ist nach antikem Muster aus drei bzw. fünf Akten aufgebaut, diese wiederum sind in Szenen unterteilt. Daneben gibt es Einakter. Man unterscheidet offenenes und geschlossenes Drama (Einheit von Ort, Zeit und Handlung). Der Handlungsverlauf folgt meist einem festen Schema: Aus der Vorgeschichte (Exposition) entwickelt sich die Handlung bis hin zu einem Wendepunkt (Peripetie) und zum Finale, das in die Zukunft weist. Weitere dramatische Elemente, wie Prolog (Einleitung) und Epilog (Nachspiel) werden ebenfalls häufig verwendet. Geschichte Die Anfänge des Dramas liegen im antiken Griechenland. Es entstand im Zusammenhang mit dem DionysosKult (Dionysien). Herausragende Tragödien schrieben Euripides, Sophokles und Aischylos. Von Aristophanes und Menander sind zahlreiche Komödien überliefert. Eine erste Theorie zur Tragödie entwickelte Aristoteles; er forderte vor allem als Ziel die Katharsis, also die Reinigung des Zuschauers von Affekten durch das Stück, sowie die Einheit von Zeit und Ort. Römische Dramen waren stark von den griechischen Vorbildern geprägt (Plautus, Terenz). Im Mittelalter wurden vor allem geistliche Stücke, Passions und Mysterienspiele, aufgeführt. Daneben gab es auch volkstümliche Stücke, die Fastnachtspiele. In Italien griffen Dramatiker der Renaissance (P. Aretino) in ihren Komödien auf die Antike zurück; Ende des 16. Jh.s entstand das Schäferspiel (Tasso). In der Neuzeit griff man das antike Drama wieder auf; die in Frankreich entstandene tragédie classique (Racine, Corneille) stand im Gegensatz zum englischen Drama (Shakespeare, Marlowe), das volkstümliche Elemente mit humanistischen Inhalten verband. Die Theorie für das klassische deutsche Drama entwickelte G.E. Lessing in seiner Hamburgischen Dramaturgie. Er begründete das bürgerliche Trauerspiel und das Ideendrama. Auf Goethe und Schiller gehen die bedeutendsten Dramen der Klassik zurück. Der Naturalismus verstand das Drama als genaues Abbild der Wirklichkeit (Milieudrama, G. Hauptmann). Das epische Theater Brechts setzte neue Maßstäbe für das moderne Drama. Weitere neue Formen sind das absurde Theater (E. Ionesco), das Dokumentartheater (P. Weiss) und das sprachexperimentelle Theater. Akteinteilung des Dramas (nach Gustav Freytag) 1. Exposition (Einleitung Protase) Die Exposition (lat. expositio Darlegung) ist ein wesentlicher Bestandteil des Dramas, Romans oder Theaterstückes. Es meint die wirkungsvolle Einführung des Zuschauers in Grundstimmung, Ausgangssituation, Zustände, Zeit, Ort und Personen des Stückes und Darbietung der für das Verständnis wichtigen Voraussetzungen, die zeitlich auch deutlich vor Beginn der eigentlichen Bühnenhandlung liegen können. Die handelnden Personen werden eingeführt. 2. Komplikation (Steigerung Epitase) Steigende Handlung – mit erregendem Moment Die Situation verschärft sich. 3. Peripetie (Umkehr der Glücksumstände des Helden) Als Peripetie (von altgr.: , plötzlicher Umschlag, unerwartetes Unglück/Glück; im Drama: durch plötzlichen Umschlag bewirkte Lösung des Knotens) bezeichnet man ein Umschlagen des Glücks/Unglücks oder den entscheidenden Wendepunkt im Schicksal eines Menschen. 4. Retardation (Verzögerung) Das retardierende Moment (frz. retarder verzögern) ist eine Szene im Handlungsverlauf eines Dramas, die die Höhepunktentscheidung hinauszögert, indem sie das Eintreten des Gegenteils des Erwarteten noch einmal sehr wahrscheinlich macht. Hier steigt die Spannung noch einmal an. In der Tragödie bezeichnet das retardierende Moment ein Ereignis, welches dazu führt, dass man die trügerische Hoffnung auf die (noch denkbare) Rettung des Helden erhält. 5. Katastrophe Katharsis (Niedergang Lösung) a) Es kommt zur Katastrophe z. B. Hamlet sein Tod, Massensterben b) Alle Konflikte werden gelöst z. B. Nathan der Weise alle sind verwandt und glücklich, Massenumarmung Einige der bekanntesten Verfasser von Schauspielen 1 2 3 4 5 6 7 1 Bertold Brecht 4 Jean Baptiste Racine 6 Euripides 2 Gerhart Hauptmann 3 Gotthold Ephraim Lessing 5 William Shakespeare 7 Sophokles Aufbau von Schillers Wilhelm Tell Erster Aufzug: Szenen der Unterdrückung Trügerische Idylle: 1. Es lächelt der See, er ladet zum Szene Bade Konrad Baumgarten erschlug den Burgvogt Wolfenschießen, weil dieser seine Frau schänden wollte. Wilhelm Tell hilft ihm bei der Flucht. 2. Stauffacher vor seinem Haus in Szene Steinen (Schwyz) Landvogt Gessler neidet Stauffacher sein Haus aus Stein. Die Stauffacherin rät ihrem Mann zur Flucht. 3. Öffentlicher Platz bei Altdorf Szene Fronvogt überwacht den Bau der Burg Zwing Uri, der Gesslerhut wird aufgestellt 4. Walter Fürsts Wohnung Szene Arnold vom Melchtal, dem seine Ochsen ausgespannt wurden, Werner Stauffacher und Walter Fürst beschliessen ein heimliches Treffen auf dem Rütli. Zweiter Aufzug: Der Rütlischwur 1. Edelhof des Freiherrn von Szene Attinghausen Attinghausen volksverbundener Landadliger, Rudenz ehrgeizig in Diensten der Habsburger 2. Die Rütliwiese, von hohen Felsen Szene und Wald umgeben Stauffacher präsentiert die Ideologie der Alten Eidgenossen: Verteidigung der Freiheit, wohlerworbene ererbte Rechte. Schiller legt ihm dazu seine Auffassung des Widerstandsrechts in den Mund. Beschluss zum Burgenbruch, Rütlischwur. Dritter Aufzug: Der Apfelschuss 1. Hof vor Tells Hause Szene Walter: Früh übt sich, was ein Meister werden will Tells Frau Hedwig ahnt Schlimmes, doch Wilhelm Tell lässt sich nicht zurückhalten. 2. Wilde Waldgegend. Berta im Szene Jagdkleid und Rudenz Berta von Bruneck fordert Rudenz auf, sich gegen die Habsburger zu stellen. Es ist ein Feind, vor dem wir alle zittern! 3. Wiese bei Altdorf. Gesslerhut auf Szene der Stange Wilhelm Tell geht achtlos am Hut vorbei, Wachen stellen ihn. Gessler verlangt den Apfelschuss. Tell trifft den Apfel, doch er hält einen zweiten Pfeil für den Landvogt bereit. Gessler lässt ihn abführen. Vierter Aufzug: Der Tyrannenmord Östliches Ufer des 1. Vierwaldstättersees, heftiges Szene Rauschen, Blitz und Donnerschläge Das Schiff des Vogts gerät in Seenot. Man gibt Wilhelm Tell das Steuer. Er entkommt durch einen Sprung auf die Tellsplatte und stösst das Schiff in den Sturm zurück. 2. Edelhof zu Attinghausen Szene Tells Frau beklagt das rohe Herz der Männer. Der sterbende Freiherr stellt fest, dass der Adel überflüssig geworden ist. 3. Die hohle Gasse bei Küßnacht Szene Wilhelm Tell ringt mit seinem Gewissen. Landvogt Gessler weist eine Bittstellerin brutal ab. Tells Geschoss tötet ihn. Fünfter Aufzug: Freiheit! Freiheit! Die Burgen sind gebrochen, Vogt Landenberg ist verjagt. Der 1. Öffentlicher Platz bei Altdorf; auf Gesslerhut soll fortan Zeichen der Freiheit sein. Kaiser von seinem Szene den Bergen brennen Signalfeuer Neffen ermordet. 2. Tells Hausflur Szene Wilhelm Tell weist Johannes Parricida ab und unterscheidet scharf zwischen Tyrannenmord und Vatermord. 3. Talgrund vor Tells Haus Szene Berta und Rudenz werden in den Bund der Eidgenossen aufgenommen.