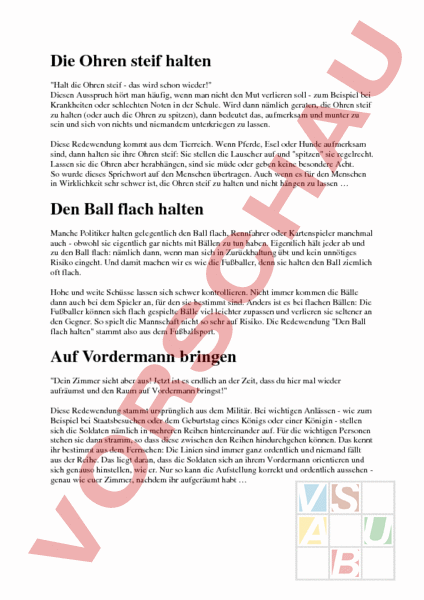Arbeitsblatt: Redensarten 2
Material-Details
Redensarten und ihre Erklärung
Deutsch
Anderes Thema
6. Schuljahr
6 Seiten
Statistik
36774
1012
17
16.03.2009
Autor/in
Beat Weber
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Die Ohren steif halten Halt die Ohren steif das wird schon wieder! Diesen Ausspruch hört man häufig, wenn man nicht den Mut verlieren soll zum Beispiel bei Krankheiten oder schlechten Noten in der Schule. Wird dann nämlich geraten, die Ohren steif zu halten (oder auch die Ohren zu spitzen), dann bedeutet das, aufmerksam und munter zu sein und sich von nichts und niemandem unterkriegen zu lassen. Diese Redewendung kommt aus dem Tierreich. Wenn Pferde, Esel oder Hunde aufmerksam sind, dann halten sie ihre Ohren steif: Sie stellen die Lauscher auf und spitzen sie regelrecht. Lassen sie die Ohren aber herabhängen, sind sie müde oder geben keine besondere Acht. So wurde dieses Sprichwort auf den Menschen übertragen. Auch wenn es für den Menschen in Wirklichkeit sehr schwer ist, die Ohren steif zu halten und nicht hängen zu lassen Den Ball flach halten Manche Politiker halten gelegentlich den Ball flach, Rennfahrer oder Kartenspieler manchmal auch obwohl sie eigentlich gar nichts mit Bällen zu tun haben. Eigentlich hält jeder ab und zu den Ball flach: nämlich dann, wenn man sich in Zurückhaltung übt und kein unnötiges Risiko eingeht. Und damit machen wir es wie die Fußballer, denn sie halten den Ball ziemlich oft flach. Hohe und weite Schüsse lassen sich schwer kontrollieren. Nicht immer kommen die Bälle dann auch bei dem Spieler an, für den sie bestimmt sind. Anders ist es bei flachen Bällen: Die Fußballer können sich flach gespielte Bälle viel leichter zupassen und verlieren sie seltener an den Gegner. So spielt die Mannschaft nicht so sehr auf Risiko. Die Redewendung Den Ball flach halten stammt also aus dem Fußballsport. Auf Vordermann bringen Dein Zimmer sieht aber aus! Jetzt ist es endlich an der Zeit, dass du hier mal wieder aufräumst und den Raum auf Vordermann bringst! Diese Redewendung stammt ursprünglich aus dem Militär. Bei wichtigen Anlässen wie zum Beispiel bei Staatsbesuchen oder dem Geburtstag eines Königs oder einer Königin stellen sich die Soldaten nämlich in mehreren Reihen hintereinander auf. Für die wichtigen Personen stehen sie dann stramm, so dass diese zwischen den Reihen hindurchgehen können. Das kennt ihr bestimmt aus dem Fernsehen: Die Linien sind immer ganz ordentlich und niemand fällt aus der Reihe. Das liegt daran, dass die Soldaten sich an ihrem Vordermann orientieren und sich genauso hinstellen, wie er. Nur so kann die Aufstellung korrekt und ordentlich aussehen genau wie euer Zimmer, nachdem ihr aufgeräumt habt Um die Ecke bringen Hast du gestern Abend den Krimi gesehen? Der Mörder hat sein Opfer einfach still und leise um die Ecke gebracht. Jemanden um die Ecke bringen das hört sich eigentlich ganz nett und hilfsbereit an. Ist es aber gar nicht. Bringt ein Mörder nämlich einen Menschen um die Ecke, dann ist derjenige wenig später tot. Wenn ihr euch auf der Straße von euren Freunden verabschiedet und sie dann um die Ecke verschwinden, dann könnt ihr sie nicht mehr sehen. Ihr wisst zwar, dass sie immer noch da sind, aber für euch sind sie in dem Moment weg. Wird jemand um die Ecke gebracht, dann sorgt ein anderer dafür, dass er verschwindet und ebenfalls nicht mehr da ist. Wie etwa bei einem Mord. Nur dass das arme Opfer dann natürlich nicht so einfach wieder hinter der Ecke hervorkommen kann, wie eure Freunde Jemandem einen Bärendienst erweisen Wenn man jemandem einen Bärendienst erweist, dann heißt das, dass man ihm trotz guter Absicht Schaden zufügt. Die Redewendung gibt es etwa seit 1900. Sie stammt vermutlich von der Fabel Der Bär und der Gartenliebhaber ab. In dieser Geschichte will der eifrige Bär eine Fliege von der Nase des Gärtners vertreiben. Er wirft mit einem Stein nach der Fliege, doch dabei stirbt nicht nur die Fliege, sondern unglücklicherweise auch der Gärtner. Das war ein wirklicher Bärendienst! Frosch im Hals Hat man einen trockenen Hals oder einen Kloß im Hals, dann sagt man häufig Ich habe einen Frosch im Hals. Aber warum denn gerade einen Frosch? Ganz einfach – die Redewendung ist durch ein Wortspiel entstanden: Ein Geschwulst unter der Zunge oder im Rachenbereich – und so ähnlich fühlt sich der Kloß ja an – heißt mit medizinischem Fachbegriff ranula. Der lateinische Name für Frosch ist rana. Und weil sich die beiden Worte so ähneln, ist im Laufe der Zeit die Redewendung Einen Frosch im Hals haben daraus entstanden. Hals- und Beinbruch Das kennt ihr bestimmt auch: Vor wichtigen Klassenarbeiten, bei Theateraufführungen oder bei Sportwettkämpfen wünschen die Teilnehmer sich gegenseitig Hals- und Beinbruch. Kein schöner Gedanke; aber eigentlich erhoffen sie sich nur Glück und gutes Gelingen. Die Redewendung stammt ursprünglich von einem hebräischen Ausdruck ab. Dort sagt man hazlacha uwracha, um sich viel Glück zu wünschen. Die jiddische Form des Glückwunsches heißt: hatslokhe un brokhe. Übersetzt bedeutet das in etwa Glück und Segen. Möglicherweise hat man in Deutschland diesen Ausdruck falsch verstanden und daraus Hals- und Beinbruch gedichtet. Deshalb wünscht man sich noch heute redensartlich Knochenbrüche, wenn man eigentlich Glück meint. Jemandem raucht der Kopf Wenn Wasser kocht, dann dampft es. Der Wasserdampf sieht fast ein bisschen so aus wie Qualm oder Rauch. Uns Menschen wird es (auch ohne Kochstelle) manchmal ziemlich heiß. Nicht nur bei warmem Wetter, sondern auch wenn wir angestrengt nachdenken. Dann steigt unsere Körpertemperatur an und wir bekommen einen roten Kopf. Allerdings qualmen wir im Gegensatz zum kochenden Wasser nicht. Aber weil die Temperatur genauso ansteigt, sagt man beim Kopf des Menschen genau wie bei anderen heißen Dingen auch, dass er raucht. Also bekommen wir rauchende Köpfe, wenn wir über schweren Hausaufgaben sitzen und sehr viel und sehr angestrengt nachdenken. Oder wenn wir uns die Köpfe heiß reden. Wer nämlich lange diskutiert, dessen Körpertemperatur steigt ebenfalls an und er bekommt einen heißen Kopf der dann auch noch sprichwörtlich anfängt zu rauchen. Für n Appel und n Ei Heute musst du unbedingt in den Laden an der Ecke gehen! Da gibt es spottbillige Pullis! Für n Appel und n Ei! Diese Redewendung kommt aus dem niederdeutschen Dialekt und heißt auf Hochdeutsch: Für einen Apfel und ein Ei. Aber seit wann kann man mit Äpfeln und Eiern bezahlen? Sind Gegenstände in großen Mengen vorhanden, kosten sie meist nicht viel. Auf einem Bauernhof gibt es zum Beispiel viele Lebensmittel wie Äpfel und Eier. Weil der Bauer davon ziemlich viele hat, kann er sie für einen geringen Preis verkaufen. Deshalb sagt man sprichwörtlich, wenn es irgendwo günstige Angebote gibt, dass sie für einen Apfel und ein Ei zu kaufen seien. Etwas an die große Glocke hängen Tina und Martin heiraten! Oma Müller ist gestorben! Neuigkeiten wie diese werden meist untereinander weitererzählt, zum Beispiel über das Telefon. Aber damit auch wirklich jeder Bescheid weiß, dass Tina und Martin heiraten wollen, geben die Brautpaare auch eine Annonce in der Zeitung auf. Ähnlich ist es mit den Todes- oder Geburtsanzeigen. Aber wie wurden alle Menschen im Ort über eine wichtige Neuigkeit informiert, bevor es Zeitungen und Telefon gab? Ganz einfach: Die Glocke der Dorfkirche wurde geläutet. So wusste jeder im Ort, dass sich etwas Wichtiges zugetragen hat. Nicht nur, dass Tina und Martin heiraten wollen, sondern auch, dass eine Gefahr droht wenn zum Beispiel ein Feuer ausgebrochen ist. Heute sagt man deshalb noch immer etwas an die große Glocke hängen, wenn eine Neuigkeit weitererzählt wird. Meist handelt es sich dabei allerdings um vertrauliche Angelegenheiten, die andere nicht zu interessieren haben also um Klatsch und Tratsch. Etwas aus dem Ärmel schütteln Die Zaubertricks der großen Magier kennt jeder: Ein Kaninchen aus dem Hut holen oder Geldstücke aus den Ohren ziehen. Den Zauberern fällt das ganz leicht: Sie schütteln ihre Tricks sprichwörtlich aus dem Ärmel. Meist tun sie das sogar wirklich, denn viele Zauberer tragen weite Roben und können darin ganz leicht Geldstücke oder bunte Tücher verstecken, die sie dann ganz einfach, wie aus dem Nichts, hervorzaubern. Aber nicht nur die Kleidung der Zauberer ist groß; im Mittelalter trugen auch ganz normale Menschen breite Roben. Diese Umhänge hatten ebenfalls sehr weite Ärmel, so dass sie oft als Taschen dienten. Denn nichts ist nützlicher, als Gegenstände direkt bei sich zu tragen um sie dann, wenn man sie braucht, ganz einfach aus dem Ärmel schütteln zu können Ein für ein vormachen Glaub dem kein Wort! Der macht dir ein für ein vor! Das sagt man, wenn jemand eine andere Person betrügen will. Dabei sehen die beiden Buchstaben doch völlig verschieden aus. Im lateinischen Alphabet steht der Buchstabe allerdings für das V, und das ist gleichzeitig das Zeichen für die Zahl Fünf. Das kennt ihr bestimmt aus der alten lateinischen Schreibweise: ist Eins, ist Fünf und ist Zehn. Und aus einem lässt sich ganz leicht, wenn man einfach die beiden Striche nach unten verlängert, ein machen so werden auf einer Rechnung aus fünf Geldstücken zehn Geldstücke. Wenn Schuldner früher ihre Geldbeträge bezahlen mussten, wurde ihnen oft ein für ein vorgemacht; ihre Gläubiger hatten durch diesen simplen Trick ganz einfach die Summe auf dem Schuldschein verdoppelt. Und weil der Buchstabe für das steht, heißt es heute ein für ein vormachen, wenn es sich um Täuschungen oder Betrügereien handelt. Jemandem nicht das Wasser reichen können Die gegnerische Fußballmannschaft kann euch nicht das Wasser reichen die Jungs sind viel schlechter als ihr. Macht euch also keine Sorgen, ihr werdet auf jeden Fall gewinnen. Wenn jemand nicht so gut ist wie ein anderer, dann heißt es sprichwörtlich: Er kann ihm nicht das Wasser reichen. Diese Redensart gibt es schon sehr lange; sie kommt ursprünglich aus dem Mittelalter. Damals aßen die Menschen, anders als heute, hauptsächlich mit ihren Händen. Wenn an einem Fürstenhof ein großes Festessen stattfand, haben Diener danach kleine Schälchen mit Wasser gereicht. Darin konnten sich die Herrschaften dann ihre Finger säubern. Die Pagen mussten sich dazu neben die Gäste knien und ihnen die Wassergefäße hinhalten. Aber nicht allen Knechten war es erlaubt, diese Tätigkeit auszuführen. Manche kamen in der Rangordnung der Dienstboten so weit hinten, dass sie noch nicht einmal gut genug dazu waren, den Adeligen das Wasser zu reichen. Daraus ist dieses Sprichwort entstanden. Wenn jemand also beispielsweise nicht so gut ausgebildet ist wie ein anderer, dann kann er ihm nicht das Wasser reichen. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts Keine Ahnung, Ich weiß nicht wovon du sprichst oder Ich hab nichts mit der Sache zu tun. Ganz klar, umgangssprachlich sagt man: Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Aber was haben Hasen damit zu tun? Die Antwort ist: Gar nichts. Diese Redewendung geht nämlich auf einen Mann zurück, der Hase mit Nachnamen hieß. Victor von Hase war ein Jurastudent in Heidelberg, der sich im Jahr 1855 vor Gericht verantworten musste. Er soll damals einem Freund zur Flucht verholfen haben, weil dieser zuvor einen Studenten im Duell erschossen hatte. Als sich Victor von Hase vor Gericht zu dem Fall äußern sollte, sagte er nur: Mein Name ist Hase; ich weiß von nichts. Das hat sich damals so herumgesprochen, dass wir Victors Aussage noch heute als Redewendung benutzen. Einen Vogel haben Ein Nest voller zwitschernder kleiner Vögelchen mitten im Kopf kein Wunder, dass da kein klarer Gedanke aufkommen mag. Das ist zwar eine seltsame Vorstellung, aber die Redewendung der hat doch einen Vogel wird oft benutzt, wenn Menschen etwas Dummes erzählt oder getan haben. Früher wurde dieser Ausspruch jedoch nur zu geisteskranken Menschen gesagt. Es war nämlich ein alter Volksglaube, dass Geistesgestörtheit von Vögeln ausgelöst wurde. Allerdings nicht dadurch, dass die Menschen Tauben züchteten oder Kanarienvögel und Wellensittiche besaßen. Nein, damals wurde angenommen, dass die Vögel direkt im Gehirn nisten sollten. Und wenn dann jemand etwas tat, was die anderen nicht nachvollziehen konnten, dann hatte der wohl einen Vogel im Kopf. Genau so erklärt sich übrigens auch der Ausspruch Bei dir piept es wohl! Etwas hinter die Ohren schreiben Das machst du nie wieder! Schreib dir das hinter die Ohren! Wenn jemand etwas bloß nicht vergessen soll, dann soll er es sich sprichwörtlich hinter die Ohren schreiben. So verlangen es zumindest viele Erwachsene von Kindern. Und genau daher kommt auch diese Redewendung. Früher (also vor etwa drei bis vier Jahrhunderten) war es nämlich so, dass Eltern ihre Kinder zu wichtigen Anlässen mitnahmen: Zum Beispiel zu Grundsteinlegungen, Einweihungen oder ähnlich bedeutenden Gelegenheiten. Dann waren die Kinder ihre Zeugen und sollten der Nachwelt von diesem wichtigen Ereignis erzählen. Weil es aber die meisten Kinder nicht wirklich interessiert, was bei solchen Vertragsabschlüssen geredet wird, und die Eltern aber wollten, dass sie trotzdem aufpassen, haben diese sich ein nützliches Mittel einfallen lassen. Die Erwachsenen zogen den Kindern einfach an den Ohren oder ohrfeigten sie, damit sie sich noch lange an dieses feierliche Ereignis erinnern. Dadurch haben sie es ihnen also direkt hinter die Ohren geschrieben. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Ich verstehe immer nur Bahnhof! Physik, Chemie, Mathematik? Da versteh ich nur Bahnhof. Klar, Bahnhof versteht man, wenn man gar nix versteht. Aber warum ist das so? Warum gerade Bahnhof? Das Sprichwort stammt aus dem Ende des 1. Weltkriegs. Damals waren die Soldaten nach den langen Kämpfen sehr müde und wollten nur nach Hause. Und nach Hause ging es vom Bahnhof aus. Deshalb setzten sie die Vorstellung vom Bahnhof mit der Heimreise in Verbindung. Wenn jemand sie dann auf etwas ansprach, antworteten sie: Ich verstehe immer nur Bahnhof was bedeutete, dass sie über nichts anderes sprechen wollten, als die Heimreise. Und wenn sie zu anderen Themen befragt wurden, dann konnten sie dazu gar nichts mehr sagen, weil sie über das Sachgebiet nicht Bescheid wussten und halt nur noch Bahnhof verstanden. Noch heute verwenden wir diese Redewendung, wenn wir rein gar nichts verstehen oder aber auch, wenn wir ein Gespräch zurückweisen wollen. Mit allen Wassern gewaschen Ist jemand sprichwörtlich mit allen Wassern gewaschen, dann ist er erfahren, gewitzt und ein wenig durchtrieben. Die Redewendung stammt aus der Seemannsprache. Seemänner waren früher oft ihr ganzes Leben lang unterwegs. Sie sahen viele Länder und lernten unterschiedliche Kulturen kennen. Ist nun ein Seemann viel herumgekommen, dann ist er mit allen Wassern gewaschen. Mit allen Wassern der sieben Weltmeere nämlich. Auf Nummer sicher gehen Bist du dir wirklich sicher, dass die Übersetzung der Vokabel richtig ist? Da würde ich lieber auf Nummer sicher gehen und noch einmal im Wörterbuch nachgucken! Die Redenwendung auf Nummer sicher gehen kommt eigentlich von auf Nummer Sicher sitzen. Die Nummer Sicher ist nämlich die Gefängniszelle eines Verbrechers. Die Zellen in einer Haftanstalt sind nummeriert und die Bösewichter sicher dahinter verwahrt. So wurden die beiden Wörter Nummer und sicher einfach zusammengezogen und die Gefängniszelle ist zur Nummer Sicher geworden. Wer allerdings heute auf Nummer sicher gehen möchte, der will natürlich nicht unbedingt direkt ins Kittchen wandern er sichert sich nur gegen alle möglichen Unstimmigkeiten ab. Dann kann er genauso sicher sein, wie ein Inhaftierter in der Gefängniszelle.