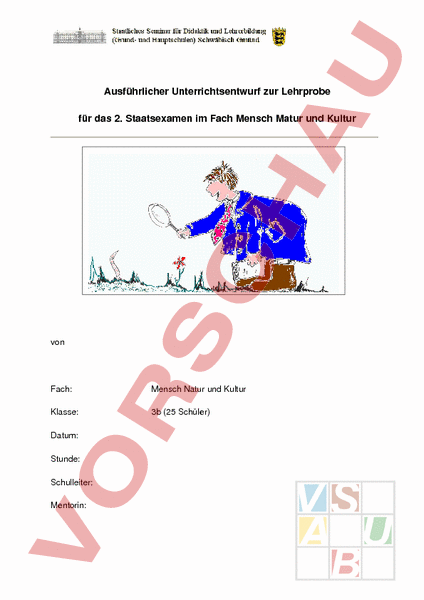Arbeitsblatt: Ausführlicher Unterrichtsentwurf
Material-Details
Unterrichtsentwurf zum Thema: Die Sinne des Regenwurms
(Prüfungslehrprobe)
Biologie
Tiere
3. Schuljahr
15 Seiten
Statistik
39330
1644
17
30.04.2009
Autor/in
Janina Neuwirth
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Ausführlicher Unterrichtsentwurf zur Lehrprobe für das 2. Staatsexamen im Fach Mensch Matur und Kultur von Fach: Mensch Natur und Kultur Klasse: 3b (25 Schüler) Datum: Stunde: Schulleiter: Mentorin: Gliederung 1. Überlegungen zu den Lernvoraussetzungen .3 1.1 Äußere Bedingungen .3 1.2 Bedingungen der Lerngruppe3 2. Didaktische Vorüberlegungen3 2.1 Vorgaben aus dem Bildungsplan.3 2.2 Stundenziele.5 2.3 Begründung des Themas vor dem Hintergrund der Lerngruppe.6 2.4 Vorwissen der Schüler und Eingliederung in die Unterrichtseinheit6 3. Sachanalyse.8 3.1 Allgemeines zum Regenwurm.8 3.2 Sinnesleistung des Regenwurms8 4. Methodische und didaktische Überlegungen9 I. Einstieg und Problematisierung9 II. Erklärung.12 II. Erarbeitung12 IV. Auswertung15 V. Transfer und Erkenntnis17 VI. Stundenabschluss.17 5. Geplanter Stundenverlauf.18 6. Literatur20 2 1. Überlegungen zu den Lernvoraussetzungen 1.1 Äußere Bedingungen 1.2 Bedingungen der Lerngruppe • 2. Didaktische Vorüberlegungen 2.1 Vorgaben aus dem Bildungsplan1 Der Bildungsplan formuliert folgende Kompetenzen, die in dieser Unterrichtsstunde angebahnt werden sollen: A: Fachliche Kompetenzen: LEITIDEE: Mensch, Tier und Pflanze: staunen, schützen, erhalten, darstellen Die Schülerinnen und Schüler können. • Techniken der Naturbeobachtung, der Orientierung in der Artenvielfalt, des Vergleichs an Kriterien und des Entwickelns von Ordnungssystemen anwenden • Ihre Verantwortung für die Bewahrung und Erhaltung der Natur und Umwelt erkennen • Erkennen, dass die heutige und zukünftige Gestaltung und Veränderung von Räumen im Einklang mit der Natur, Sozialem und Wirtschaftlichen erfolgen sollte LEITIDEE: Natur macht neugierig: forschen, experimentieren, dokumentieren, gestalten Die Schülerinnen und Schüler können. • Erscheinungen der belebten (.) Natur und ihre Erfahrung mit ihr gezielt wahrnehmen und dokumentieren • Eigene Fragen stellen, dazu einfach Experimente planen, durchführen, diskutieren, auswerten und optimieren • Erfahrungen miteinander vergleichen und ordnen, Regelmäßigkeiten aufspüren und in anderen Kontexten wiedererkennen 1 Bildungsplan (2004): S. 76 3 LEITIDEE: Erfinderinnen, Erfinder, Künstlerinnen, Künstler, Komponistinnen, Komponisten entdecken, entwerfen und bauen, stellen dar Die Schülerinnen und Schüler können . Haben eigene (.) kreative Fähigkeiten und Interessen entwickelt und ein positives Bewusstsein ihrer eigenen Fähigkeiten ausgebildet 4 B: Soziale und personale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können . • in Partnerarbeit Aufgaben bewältigen (Teamfähigkeit), • sich untereinander arrangieren und organisieren (Konfliktlösefähigkeit), • im Gespräch aufmerksam zuhören und Höflichkeitsregeln (ausreden lassen; warten bis man selbst zu Wort kommt.) einhalten, • sie besitzen eine Kooperationsfähigkeit, • haben Spaß an einem Thema an einer Methode, • entwickeln Selbstvertrauen und bauen eine Werthaltung auf. • Wertschätzung gegenüber einem Lebewesen entwickeln C: Methodische Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler können . elementare Lern und Arbeitstechniken beherrschen, • wie strukturieren, Notizen machen, Darstellen, Vermutungen anstellen und Experimentieren. Sie beherrschen elementare Gesprächs und Kooperationstechniken, wie • die Diskussion, aktives Zuhören, Zusammenarbeiten, Konfliktmanagement, • Argumentation und sie können mit zentralen Makromethoden umgehen, wie zum Beispiel • Partnerarbeit, Klassengespräche (Diskussion) und Problemlösendes. 2.2 Stundenziele Die Schüler. • kennen die verschiedenen Sinne eines Regenwurms. • sind in der Lage, anhand von Versuchsanweisungen zu arbeiten. • beschreiben ihre Versuchsbeobachtungen. • gewinnen Freude an der Beobachtung der Tiere. • kommen in Partnerarbeit zu einem Ergebnis. 5 2.3 Begründung des Themas vor dem Hintergrund der Lerngruppe Das Thema der Unterrichtseinheit hat einen engen Bezug zur Lebenswelt der Kinder. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Regenwurm ihnen draußen beim Spielen, auf dem Weg zur Schule oder im eigenen Garten bereits begegnet ist. Dadurch wird die Motivation der Schüler hoch sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Schüler sollen Erfahrungen in ihrer Umwelt gewinnen, indem sie Eigenschaften und Lebensweisen von einer Nutztierart kennen lernen. Sie erkennen so die Bedeutung des Regenwurms für den Menschen. Die Schüler übernehmen die Verantwortung für die Pflege von den Tieren in der Schule. Hierdurch sollen sie einen achtsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Tieren einüben. Auch über die Lebensbedürfnisse der Tiere lernen sie einiges, insbesondere hinsichtlich ihrer natürlichen Lebensgrundlagen. Sinnliche Erfahrungen sind hierbei von grundlegender Bedeutung. Die Schüler erfahren den Regenwurm als faszinierendes und besonderes Lebewesen, sie lernen ihn wertzuschätzen und zu bestaunen. Grundschulkinder sind gegenüber Unterrichtsthemen aus der Tierwelt besonders aufgeschlossen. Werden die Tiere, wie in unserem Fall, zusätzlich ins Klassenzimmer geholt, steigen Interesse und Neugier der Schüler. Regenwürmer sind zur Beobachtung sehr gut geeignet, da sie über erstaunliche Fähigkeiten bezüglich ihrer Fortbewegung und ihrer Sinnesleistung verfügen. Außerdem lassen sich einfache Versuche durchführen. Hinzu kommt, dass sie leicht zu beschaffen sind und mit einfachen Mitteln in der Schule (Keller) gehalten und gepflegt werden können. Das gezielte Beobachten und Forschen, sowie das anschließende schriftliche Notieren der Ergebnisse, führt die Schüler zu wissenschaftlichem Arbeiten (Experimentieren) hin. Regenwürmer lösen häufig bei Erwachsenen Ekelempfinden aus. Auch in dieser Klasse sind manche Schüler bereits von Vorurteilen beeinflusst worden. Gerade deshalb erscheint es mir wichtig, die Kinder sensibel zu machen. Diese Unterrichtseinheit trägt dazu bei, dass die Schüler das Leben des Regenwurms kennen und achten lernen. 2.4 Vorwissen der Schüler und Eingliederung in die Unterrichtseinheit Vor zwei Wochen bin ich mit der Klasse in das Thema Regenwurm eingestiegen. Zunächst haben sich die Schüler darüber Gedanken gemacht, was sie bereits über den Regenwurm wissen und was sie noch über ihn erfahren wollen. Dies haben wir an einem MindMapBaum 6 im Klassenzimmer festgehalten. Ebenfalls haben wir darüber diskutiert, wie der Regenwurm zu seinem Namen kam. Die meisten Kinder vermuteten, dass er auf Grund des Regens aus der Erde gekrochen kommt und so sein Name entstanden ist. Über die ursprüngliche Bezeichnung des Regenwurms als „reger Wurm waren die Kinder sehr erstaunt. Über das Wochenende haben die Schüler die Aufgaben bekommen, ihre eigenen Regenwürmer zu sammeln und mit in die Schule zu bringen. Daraufhin haben wir die Regenwürmer in ausreichend große Gefäße gesetzt und gemeinsam Pflegeregeln aufgestellt. Dazu haben wir einen Regenwurmdienst eingeteilt, der sich jeweils eine Woche um die Pflege der Regenwürmer kümmert. Im Anschluss daran wurde den Regenwürmern ein Name gegeben und sie auf ihren Körperbau hin untersucht. Dazu wurden Verhaltensregeln für den Umgang mit den Tieren beim Forschen aufgestellt und als (Regenwurmforscherregeln). Orientierungshilfe Die Kinder erstellten im ein Klassenzimmer Regenwurmheft, ausgehängt indem Bilder, Arbeitsblätter, Texte, Aufgaben und natürlich die durchgeführten Versuche festgehalten werden. In der folgenden Stunde haben wir einen Regenwurmbeobachtungskasten mit den verschiedenen Erdschichten und jede Menge Regenwürmern befüllt. Dazu wurde ein Forscherprotokoll angelegt, mit dem sie ihre Beobachtungen protokollieren sollen. In der nächsten Stunde haben die Kinder mittels ihres Vorwissens und von mir dargebotenen Bildern die Bedeutung des Regenwurms erarbeitet. In der anschließenden Stunde führten die Kinder den ersten Versuch zur Fortbewegung eines Regenwurms durch. Die Schüler hatten Schwierigkeiten effektiv zu forschen, da sie allein durch die Beobachtung an ihrem Regenwurm sehr motiviert waren. In dieser Unterrichtsstunde findet also die zweite wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Tieren statt. Deshalb muss ich damit rechnen, dass die Schüler für das Durchführen und Notieren der Versuche noch etwas mehr Zeit benötigen. Mit dem Thema „Welche Sinne ein Regenwurm hat werden sich die Schüler noch eine weitere Stunde befassen. Schließlich soll jeder Schüler die Möglichkeit haben, zu allen thematisierten Sinnen mindestens einen Versuch durchzuführen. In weiteren Stunden werden sich die Schüler über folgende Inhalte informieren: Sinne (schmecken, hören), Bedeutung der Sinne für den Regenwurm, Fortpflanzung, Feinde, Nahrung(saufnahme). 7 3. Sachanalyse 3.1 Allgemeines zum Regenwurm Die Regenwürmer (Lumbricidae) sind im Erdboden lebende, gegliederte Würmer aus der Ordnung der Wenigborster (Oligochaeta). Sie gehören innerhalb des Stammes der Ringelwürmer (Annelida) zur Klasse der Gürtelwürmer (Clitellata), d.h. zu den Wasser oder Feuchtlufttieren mit langgestrecktem, gleichmäßig segmentiertem Körperbau, einem Strickleiternervensystem und einem geschlossenen Blutkreislauf. In Deutschland leben derzeit 39 Regenwurmarten. Nicht alle davon sind ursprünglich hier heimisch. Ihre durchschnittliche Lebenszeit liegt zwischen 3 bis 8 Jahren. Der 9 bis 30 Zentimeter lange Tauwurm oder Gemeine Regenwurm (Lumbricus terrestris) ist neben dem 6 bis 13 Zentimeter langen Kompostwurm (Eisenia foetida) wohl die bekannteste einheimische Annelidenart.2 Ein Tauwurm (Lumbricus terrestris) beim Verlassen seiner Wohnröhre (Nachtaufnahme) 3.2 Sinnesleistung des Regenwurms Regenwürmer besitzen weder Augen und Ohren, noch haben sie eine Nase. Sie sind jedoch mit verschiedenen anderen einfachen Sinnesorganen speziell an das Leben im Boden angepasst. Sehsinn: Mittels LichtSinneszellen am Vorder und Hinterende können sie Hell und Dunkel unterscheiden. Tastsinn: Damit sie sich im Dunkel des Erdreiches und in ihren Wohnröhren zurechtfinden, orientieren sie sich mit Hilfe eines Tast und Gravitätssinnes. Spalten und Hindernisse 2 www.wikipedia.de, 30.04.08 8 sowie das Oben und Unten im Boden können so problemlos geortet werden. Drucksinn: Bodenerschütterungen werden mit dem Drucksinn wahrgenommen. Dies ermöglicht die rechtzeitige Flucht vor einem herannahenden Fressfeind, zum Beispiel einem Maulwurf. Geschmackssinn: Sinnesknospen in der Mundhöhle dienen der Geschmackswahrnehmung.3 Geruchssinn: In der Mundhöhle verfügen Regenwürmer über Sinnesknospen, die auf chemische Reize reagieren und der Geschmackswahrnehmung dienen. Regenwürmer können also Gerüche erkennen und Flüssigkeiten mit scharfem Geruch ausweichen, die ihrer empfindlichen Haut Schaden zufügen könnten.4 Hörsinn: Regenwürmer können nicht hören 4. Methodische und didaktische Überlegungen In dieser Unterrichtsstunde erfahren die Kinder mittels verschiedener Versuche welche Sinnesleistung der Regenwurm besitzt. Die Unterrichtsstunde habe ich wie folgt strukturiert: I. Einstieg und Problematisierung II. Erklärung III. Erarbeitung IV. Auswertung V. Transfer und Erkenntnis VI. Stundenabschluss Ich möchte in diesem Kapitel meine methodischen und didaktischen Überlegungen zu den einzelnen Phasen aufzeigen. I. Einstieg und Problematisierung Zu Beginn der Stunde treffen sich die Schüler in einem Stuhlkreis, um in der nachfolgenden Problematisierung eine bessere Diskussion untereinander zu ermöglichen. Der Regenwurmdienst hat im Vorfeld die Klassenregenwürmer aus dem Keller geholt und für diese Stunde bereitgestellt. Die Beobachtungen am Regenwurmbeobachtungskasten werden in der 3 4 Zentrum für angewandte Ökologie Schattweid 2003: Fredy Vetter – REGENWURM Führer zur Ausstellung, S.18 www.naturlexikon.com, 30.04.08 9 Folgestunde protokolliert. Nach der Begrüßung zeigt der Lehrer mittels eines visuellen Impulses die Problemstellung der Stunde. Welche Sinne hat ein Regenwurm? Durch den Impuls provoziert der Lehrer nach der Bildbeschreibung erste Vermutungen zu der Problemstellung und ein Aufzählen der ihnen bekannten Sinne. Die fünf Sinne sollen mittels Kärtchen an der Tafel gesammelt werden und die Überschrift „Sinne erarbeitet werden. Nachdem die Sinne aufgezählt wurden, hänge ich über die Sinne hören und schmecken ein Tuch, mit der Begründung, dass dies in dieser Stunde nicht Thema sein soll, sondern erst in der nächsten, da die Zeit hierfür nicht ausreicht. Das Thematisieren der fünf Sinne (Geruchssinn, Hörsinn, Sehsinn, Tastsinn, Geschmackssinn) stellt für mich die Basis für das weitere Erarbeiten der Problemstellung dar. Jetzt wird das Kärtchen „Was will ich wissen? in den Kreis geholt. Mir ist es wichtig, dass die Fragen der Schüler ständig in den Unterricht einbezogen werden und die Schüler am Schluss der Einheit erkennen, was sie nun alles dazu gelernt haben. Ich mache die Schüler gegebenenfalls auf die Frage, ob ein Regenwurm Augen, Nase und Hände hat, aufmerksam und so gelangen die Kinder zu dem Forschauftrag, ob ein Regenwurm sehen, riechen und fühlen kann? Dabei ist es mir wichtig, dass die Kinder diesen selbst formulieren und ihn an der Tafel festhalten. Anschließend äußern die Kinder Vermutungen über diese Problemstellung, welche mittels von Symbolen an der Tafel visualisiert werden. Dies erleichtert mir einerseits das Festhalten der Vermutungen und andererseits sind Symbole aussagekräftig und hilfreich hinsichtlich der Strukturierung für schwächere Kinder. Die Visualisierung der Schülerbeiträge hat den Nutzen, dass auch für schwächere Kinder die Struktur und die Erkenntnisse der Gespräche deutlich werden und ihnen helfen, diese nachvollziehen zu können. Vermutete Schwierigkeiten: Kommen die Kinder nicht auf das Stundenthema, die Sinne eines Regenwurms, so erfolgt ein Stützimpuls in Form dieses Bildes: 10 Damit wird sogleich ein Sammeln der fünf Sinne an der Tafel ausgelöst. Nun wird dies übergeleitet, zu der Fragestellung, ob ein Regenwurm auch Augen, eine Nase und Hände hat, um anschließend vermuten zu können, ob er trotzdem über Sinne in diesem Bereich verfügt. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, einen Konsens bezogen auf die Vermutungen zu finden, wenn die Schüler zum größten Teil nicht einer Meinung sind. In diesem Fall, wenn durch Handzeichen keine Mehrheit gefunden werden kann, hängt der Lehrer ein Fragezeichen für die Vermutung an. Alternative Einstiege: Phantasiereise zu den fünf Sinnen des Menschen: Da mein Stundenziel jedoch die Erarbeitung der Sinne des Regenwurms sind und zudem die Klasse im letzten Schuljahr das Thema Sinne ausführlich behandelt hat, kann ich an bereits Bekanntem anknüpfen und diesen Einstieg verwerfen. Eine Geschichte, ein Gedicht über das Leben des Regenwurms: Diese Idee habe ich jedoch verworfen, da gerade in dieser Unterrichtseinheit den Schülern die Realität und Wertschätzung der Regenwürmer nahe gebracht werden soll. Ein Spiel zu dem Sinn Sehen, bei dem den Kindern bewusst wird, dass ein Regenwurm im Reich des Dunklen lebt (wie ein Blinder): Auch diese Idee habe ich verworfen, da dies nicht so effektiv und zielstrebig das Problem thematisieren kann, wie das von mir gewählte Bild. 11 II. Erklärung Im nächsten Schritt, nachdem die Vermutungen geäußert wurden, erkläre ich den Schülern, dass sie nun in ihren schon zu Beginn der Einheit festgelegten Forschergruppen5 erforschen, ob ein Regenwurm riechen, sehen oder fühlen kann. Die Form der Partnerarbeit bietet jedem Schüler die Möglichkeit, in einer kleineren Gruppe an einem Problem effektiv zu arbeiten, zudem erreiche ich dadurch eine höhere emotionale Bindung zu dem jeweils betreutem Regenwurm, da die Kinder sich verantwortlich fühlen und die Verantwortung nicht an andere Gruppenmitglieder abgeben können. Durch die Partnerarbeit können Kinder aufgefangen werden, die sich ekeln, einen Regenwurm in die Hand zu nehmen. Falls der Ekel unter den Kindern überwiegen sollte, so dass hier durch das partnerschaftliche Arbeiten kein Auffangen möglich ist, halte ich Bechergläser bereit, mit denen die Kinder den Wurm nicht anfassen brauchen. Des Weiteren bietet sich bei dieser Thematik die Methode eines Schülerversuches an, da durch handelndem und entdeckendem Lernen nachhaltig gelernt werden kann. Bevor sich die Kinder dem Forschungsproblem stellen, weiße ich auf die aufgestellten Regenwurmforschungsregeln hin. Dies ist wichtig, um den Schülern noch einmal klar zu machen, dass sie mit einem Lebewesen forschen und somit höchste Vorsicht geboten ist. Des Weiteren erkläre ich den Ablauf der Arbeitsphase. Die Schüler werden noch einmal aufgefordert zügig zu forschen, damit ihre Regenwürmer möglichst schnell zurück ins Dunkle zurückkehren können. II. Erarbeitung Ich habe die Sitzordnung so gewählt, dass sich die Schüler, nach der Arbeitsanweisung, nur durch Drehen des Stuhls an ihrem Arbeitsplatz befinden und somit Zeit erspart wird und mögliche Turbulenzen verhindert werden. Ebenso habe ich die Tische so angeordnet, dass jedes Kind die einzelnen Forscherstationen ohne Probleme erreichen kann und ein Ablenken durch andere Kinder reduziert wird. zu Beginn der Einheit wurden Forschergruppen (jeweils zwei Schüler) eingeteilt, welche gemeinsam verantwortlich für ihren Regenwurm sind und so eine Beziehung hergestellt wurde, um das ethische Ziel dieser Unterrichtseinheit zu verwirklichen. 5 12 Die Schüler finden an drei Forschungsstationen jeweils ihren Forschungsauftrag und die Forschungsmaterialien, welche sie sich selbstständig holen und selbst entscheiden können, inwieweit sie auf Material zurückgreifen und wie intensiv (qualitativ und quantitativ) sie einen Versuch planen und durchführen. Der Forschungsauftrag für leistungsschwächere Kinder (Tipp Forscherbögen) befindet sich in einer gelben Kiste und für die leistungsstarken Kinder in der grünen Kiste. Wichtig ist dabei, dass zwischen zwei Forschungsauftragsschwierigkeiten unterschieden wird. Differenzierend sind die Protokolle so aufgebaut, dass einerseits der Versuchsablauf vorgegeben ist und andererseits der Versuchsablauf frei ist und die Forschergruppe selbstständig einen Versuch planen soll. Eine Differenzierung wird also durch das Angebot von Hilfeformulierungen gewährleistet. Diese werden speziell mit Hinblick auf Kinder mit Sprachschwierigkeiten durch Bilder unterstützt. Diese Leistungsdifferenzierung ist wichtig, um den Kindern ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend gerecht zu werden. Quantitativ findet eine Differenzierung in Form von der Anzahl der durchgeführten Versuche statt. Nicht jede Forschergruppe muss alle Versuche durchführen. Um ein Gedrängel an den Stationen zu vermeiden, bestimme ich, welche Forschergruppe mit welchem Versuch beginnt. Somit ist zudem gewährleistet, dass jeder Versuch in der Klasse durchgeführt wurde und in der Auswertungsphase Erkenntnisse aus den Versuchen vorgetragen werden können und somit die zu Beginn der Stunde aufgestellten Vermutungen überprüft werden können. Wie bereits erwähnt, haben die Kinder in der Folgestunde die Möglichkeit, die noch ausstehenden Versuche durchzuführen. Die Schüler protokollieren ihre Versuche auf den differenzierten Forschungsprotokollen. Diese Notiz dient einerseits der Ergebnissicherung und andererseits als Grundlage für die anschließende Auswertung. Sie sollen herausfinden, ob ein Regenwurm sehen kann, ob er Gerüche wahrnimmt und wie er auf Berührung reagiert (Tastsinn). Der Versuch zum Hörsinn eines Regenwurms habe ich auf Grund des hohen Störfaktors Lärm auf die nächste Stunde in Form eines Demonstrationsversuches verlegt, der Geschmackssinn findet ebenfalls in dieser Stunde keine Bedeutung, da er lediglich und bestenfalls durch einen Langzeitversuch erforscht werden kann und dies in dieser einen Stunde und der damit gegebenen zeitlichen Begrenzung nicht möglich ist. Der Regenwurmbeobachtungskasten wird für diese Langzeitbeobachtung genutzt. Für den Fall, dass Kinder früher als erwartet fertig werden, halte ich zusätzliche Aufgabenblätter bereit, auf dem das Gelernte vertieft und erweitert werden kann. Auch diese Aufgaben können die Kinder selbst kontrollieren. 13 Dadurch, dass die Kinder während der Erarbeitungsphase möglichst selbständig arbeiten, habe ich die Möglichkeit mich Kindern mit Problemen zuzuwenden. Am Ende der Arbeitsphase sollen die Schüler ihr Material wieder an die Forschungsstationen zurückbringen. Vermutete Schwierigkeiten: Zu Beginn der Arbeitsphase vermute ich einen höheren Lärmpegel, da die Kinder ihre Regenwürmer aus der Erde holen müssen und diese entweder nicht gleich finden oder andere spannende Tiere entdecken. Im Vorfeld überprüfe ich, ob in jedem Gefäß der Schüler sich ein Regenwurm befindet und setze gegebenenfalls einen Regenwurm dazu. Gern entdecken die Schüler auch Babyregenwürmer und ziehen damit die Aufmerksamkeit ihrer Klassenkameraden auf sich. Wie bereits erwähnt, haben einige Kinder noch Schwierigkeiten ihren Regenwurm anzufassen, dem versuche ich mit Hilfe der Partnerarbeit oder durch meine Unterstützung entgegenzuwirken. Des Weiteren möchte ich durch konsequentes Einhalten der Experimentier und Regenwurmfoscherregeln die Kinder während der Arbeitsphase dazu anhalten effektiv zu arbeiten, sich nicht durch andere Forschergruppen ablenken lassen und das zu erforschen, was der Forscherauftrag verlangt. 14 Alternativen: Eine Möglichkeit wäre es gewesen, nur einen Versuch zu einem Sinn (exemplarisch) von den Schülern durchführen zu lassen und die anderen als Demonstrationsversuch vorzuführen. Es ist mit jedoch wichtig, sowohl die Methodenkompetenz der Schüler zu schulen als auch durch selbsttätiges, handlungsorientiertem Lernen den Kindern nachhaltiges Lernen zu ermöglichen. Aus diesem Grund habe ich mich auch gegen Informationstexte über die Sinne eines Regenwurms entschieden. Ich habe mich dazu entschieden, die für den Versuch notwendigen Materialien auf einem Tisch bereitzustellen. Eine andere Möglichkeit wäre es gewesen, die Materialien bereits in Körben den einzelnen Forschergruppen vorzubereiten. Da mir jedoch auch das selbstständige Arbeiten der Schüler am Herzen liegt, habe ich mich gegen die vorbereiteten Körbe entschieden. IV. Auswertung Mittels eines akustischen Signals beenden die Kinder ihre Arbeit und finden sich wieder im Stuhlkreis ein. Die Schüler sollen nun kurz berichten, ob der Regenwurm sehen, riechen und tasten (fühlen) kann. Die Gesprächsstruktur wird durch das Tafelbild, den aufgestellten Vermutungen, bestimmt. Gemeinsam wird überprüft, ob die Vermutungen richtig waren. Im Anschluss daran stellen die Schüler ihren Versuchsablauf vor und nennen ihre Beobachtungen. Als Hilfestellung und erste Form der Verinnerlichung nach Aebli liegen die Versuchsmaterialien auf einem Tisch bereit. Ein Regenwurm wurde jedoch aus folgenden Gründen nicht bereit gelegt: 1. Aufforderungscharakter Versuch noch einmal durchzuführen (Zeitgrenzen) 2. Der Regenwurm ist ein Lebewesen und nur wenn es nötig ist, aus der Erde geholt werden darf (Regenwurmforscherregeln) und auf Grund meiner Vorbildfunktion und da keine erkennbare Notwendigkeit vorliegt, bleibt der Regenwurm in der Erde. Falls jedoch die Erkenntnisse der Kinder fehlen und die Problemstellung nicht beantwortet werden kann, dann muss der Versuch noch einmal durchgeführt werden (Demonstrationsversuch). Diese Auswertungsphase ergänzt durch ein Fazit der Stunde und den Ausblick auf die nächste Stunde kann bei Zeitknappheit die Stunde beenden. Vermutete Schwierigkeiten: Es können falsche Ergebnisse durch nichtvorhersehbares Verhalten eines Regenwurms zu Stande kommen. (Erklärungsnot des Lehrers, da Schüler diese Erkenntnisse aus ihrem Versuch erlangten und jedes verneinen zu einer Irritierung führt). Mit Hilfe der anderen 15 Forschergruppen und durch gegebenenfalls wiederholtem Ausführen des Versuches möchte ich diesen Schülern die Möglichkeit geben, zu einem richtigen Ergebnis zu gelangen. Alternativen: An dieser Stelle könnte ich noch genauer auf die Sinneszellen eingehen, was also dafür verantwortlich ist, dass ein Regenwurm riechen kann, wenn er keine Nase hat. Diese Frage kann natürlich auch von den Kindern geäußert werden, welche ich nicht ignorieren werde, sondern möglichst einfach erklären werde. 16 V. Transfer und Erkenntnis Nachdem die Vermutungen überprüft wurden, sollen die Schüler die Transferfrage beantworten, welche Bedeutung die Sinne für den Regenwurm haben. Ich lege dazu Bilder in die Stuhlkreismitte auf denen diese Begründungen dargestellt sind. Die Bilder sollen den Sinnen zugeordnet und erklärt werden. Werden die Begründungen im Auswertungsgesprächgespräch bereits durch die Schüler genannt, so visualisiere ich diese lediglich noch einmal durch das Bild. Vermutete Schwierigkeiten: Den Schülern kann es Schwierigkeiten bereiten, sich in die Welt des Regenwurms hineinzudenken, um Schlussfolgern zu können, welche Bedeutung der jeweilige Sinn für den Regenwurm hat. Durch Bilder, auf denen diese Begründungssituationen dargestellt sind, möchte ich den Kindern eine Hilfestellung an die Hand geben. VI. Stundenabschluss Zur Abrundung der Stunde werde ich nochmals auf das Tafelbild zurückgreifen und die Kinder auffordern, aufzuführen was sie heute als Regenwurmforscher herausgefunden haben. Dadurch erkennen sie ihren eigenen Lernzuwachs. Nach dem Aufräumen mit Unterstützung des Regenwurmdienstes werden die Schüler in die Pause geschickt. 17 5. Geplanter Stundenverlauf Zeit Phasen Geplanter Verlauf Medien Ich begrüße die Schüler und stellt die Gäste der heutigen Stunde vor. Bild 10 Minuten Sozialform Einstieg und Problema tisierung Stuhlkreis Unterrichts gespräch Ich zeige ein Bild, auf dem ein Regenwurm mit Nase, Händen und Blindenband dargestellt ist (Provokation) Karten: 5Sinne Sammeln der fünf Sinne Problem stellung Formulieren der Problemstellung: Kann ein Regenwurm sehen, riechen, fühlen? Vermutungen 2 Min. Erklärung 20 Minuten Aufstellen der Vermutungen Erarbeitung Stuhlkreis am Sitzplatz Partnerarbeit Ich erkläre den Schülern, dass sie nun in Partnerarbeit die Forscheraufgaben bearbeiten sollen. Die Gruppen (Partnerarbeit) sollen nun durch kleine Taschen Versuche und genaue Beobachtungen die verschiedenen lampen Forscherbögen (je nach Leistung) bearbeiten. Gerüche: (Essig, Honig) Die Schüler holen das Material selbstständig. 5 Minuten Auswertung 6 Minuten Papier Sie sollen herausfinden, ob der Regenwurm zwischen hell Ohren und dunkel unterscheiden kann, ob er Gerüche stäbchen wahrnimmt und wie er auf Berührung reagiert (Tastsinn). Protokolle Transfer und Stuhlkreis Unterrichts gespräch Erkenntnis Stuhlkreis Unterrichts gespräch Am Ende der Arbeitsphase sollen die Schüler ihr Material wieder an die Forscherstation bringen und ihren Regenwurm zurück in die Erde setzen. Regenwürmer Die Schüler sollen über ihre Beobachtungen berichten und die zu Beginn der Stunde angestellten Vermutungen überprüfen. Materialien (s.o.) Welche Bedeutung haben die Sinne für den Regenwurm? Karte: Ich lege dazu Bilder in die Stuhlkreismitte auf denen diese Bedeutung Begründungen dargestellt sind. Die Bildern sollen den Bilder: Sinnen zugeordnet und erklärt werden. Bedeutung 18 2 Minuten Stunden abschluss Stuhlkreis Zur Abrundung der Stunde werde ich nochmals auf das Tafelbild zurückgreifen und die Kinder auffordern, aufzuzählen was sie heute als Regenwurmforscher herausgefunden haben. Unterrichts gespräch Wenn die Zeit knapp wird, kann die Stunde auch mit der Überprüfung der Vermutungen abgeschlossen werden und der Transfer in der folgenden Stunde mit dem zusätzlichen Versuch zum Hörsinn erarbeitet werden. 19 6. Literatur Kultus und Unterricht: Bildungsplan für die Grundschule, NeckarVerlag, Stuttgart 2004 Kaiser, A.: Praxis handelnder Sachunterricht. Band 1. Baltmannsweiler 1997. Lexika über Tiere Locker, Corinna: Die Regenwurm Werkstatt, Verlag an der Ruhr, Mühlheim,1999 Meyer, H.: Unterrichtsmethoden. 2. Praxisband. Frankfurt 1089. Studienseminar Siegburg: Querbeet. Siegburg 1999. Wittenbruch, W.: Kommentar zum Lehrplan Sachunterricht. Heinsberg 1986. Schülerduden, Die Tiere, Ein Sachlexikon für den Biologieunterricht, Bibliographisches Institut Mannheim/ Wien/ Zürich Dudenverlag, 1987 Strauß, Prof. Dr. Erich: Biologie heute, Schroedel Schulbuchverlag, Hannover, 1994 Zentrum für angewandte Ökologie Schattweid 2003: Fredy Vetter: REGENWURM Führer zur Ausstellung, S.18 Internetseiten: www.naturlexikon.com, 30.04.08 www.wikipedia.de, 30.04.08 20