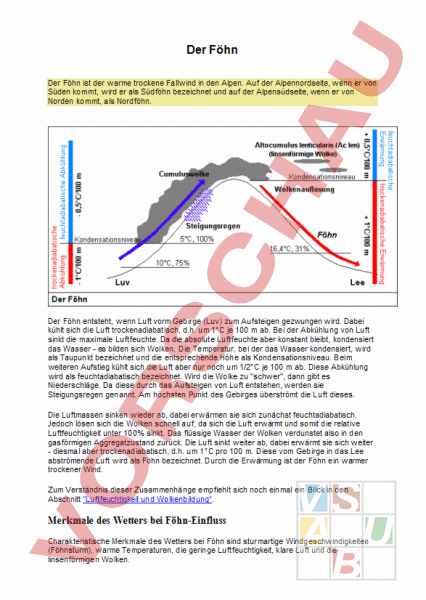Arbeitsblatt: Niederschlagsprofil der Schweiz
Material-Details
Das Niederschlagsprofil der Schweiz nach dem Geografiebuch "Schweiz" dargestellt und erläutert
Geographie
Schweiz
8. Schuljahr
1 Seiten
Statistik
4477
2844
20
14.02.2007
Autor/in
Peter Luzi
Obere Hofstr.3
7270 Davos Platz
7270 Davos Platz
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Der Föhn Der Föhn ist der warme trockene Fallwind in den Alpen. Auf der Alpennordseite, wenn er von Süden kommt, wird er als Südföhn bezeichnet und auf der Alpensüdseite, wenn er von Norden kommt, als Nordföhn. Der Föhn entsteht, wenn Luft vorm Gebirge (Luv) zum Aufsteigen gezwungen wird. Dabei kühlt sich die Luft trockenadiabatisch, d.h. um 1C je 100 ab. Bei der Abkühlung von Luft sinkt die maximale Luftfeuchte. Da die absolute Luftfeuchte aber konstant bleibt, kondensiert das Wasser es bilden sich Wolken. Die Temperatur, bei der das Wasser kondensiert, wird als Taupunkt bezeichnet und die entsprechende Höhe als Kondensationsniveau. Beim weiteren Aufstieg kühlt sich die Luft aber nur noch um 1/2C je 100 ab. Diese Abkühlung wird als feuchtadiabatisch bezeichnet. Wird die Wolke zu schwer, dann gibt es Niederschläge. Da diese durch das Aufsteigen von Luft entstehen, werden sie Steigungsregen genannt. Am höchsten Punkt des Gebirges überströmt die Luft dieses. Die Luftmassen sinken wieder ab, dabei erwärmen sie sich zunächst feuchtadiabatisch. Jedoch lösen sich die Wolken schnell auf, da sich die Luft erwärmt und somit die relative Luftfeuchtigkeit unter 100% sinkt. Das flüssige Wasser der Wolken verdunstet also in den gasförmigen Aggregatzustand zurück. Die Luft sinkt weiter ab, dabei erwärmt sie sich weiter diesmal aber trockenadiabatisch, d.h. um 1C pro 100 m. Diese vom Gebirge in das Lee abströmende Luft wird als Föhn bezeichnet. Durch die Erwärmung ist der Föhn ein warmer trockener Wind. Zum Verständnis dieser Zusammenhänge empfiehlt sich noch einmal ein Blick in den Abschnitt Luftfeuchtigkeit und Wolkenbildung. Merkmale des Wetters bei Föhn-Einfluss Charakteristische Merkmale des Wetters bei Föhn sind sturmartige Windgeschwindigkeiten (Föhnsturm), warme Temperaturen, die geringe Luftfeuchtigkeit, klare Luft und die linsenförmigen Wolken. Die hohen Temperaturen lassen sich mit der Entstehung des Föhns erklären: Beim Aufstieg kühlt sich die Luft um 1/2C je 100 ab, aber beim Absinken erwärmt sich die Luft um 1C je 100 m. Die Erwärmung fällt also doppelt so hoch aus wie die Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeit ist niedrig, da sich die Luft im Luv des Gebirges abregnet. Auch die linsenförmigen Wolken, Altocumulus lenticularis oder umgangsprachlich Föhnfische bzw. Föhnwolken, sind bei Föhn zu beobachten. Wenn Luft das Gebirge anströmt wird sie angehoben. Dieser Prozess setzt sich auch in höheren Schichten fort. Durch das Gebirge wird die Luft in eine Wellenbewegung versetzt. Diese Wellen heißen Leewellen. Steigt die Luft im Wellenberg auf, kühlt sie sich ab und das darin enthaltene Wasser kondensiert; es bilden sich Wolken. Sinkt die Luft zum Wellental ab, erwärmt sie sich wieder und das Wasser verdunstet. Die Wolken lösen sich hier wieder auf. So entstehen die sogenannten Leewellen-Wolken, deren Form an Linsen oder Fische erinnert. Dieses Bild zeigt Altocumulus lenticuaris bei Föhn im deutschen Alpenvorland (bei Germering, nahe München): Berechnung der theoretisch möglichen Temperatur im Lee bei Föhn Da sich die Luft beim Aufsteigen erst feuchtadiabatisch um 0,5C pro 100 abkühlt und beim Absinken trockenadiabatisch um 1C pro 100 erwärmt, kann man die Temperatur im Lee eines Gebirges bei Föhn berechnen. Dazu ermittelt man zuerst die Abkühlung beim Aufstieg und dann die Erwärmung beim Absinken.