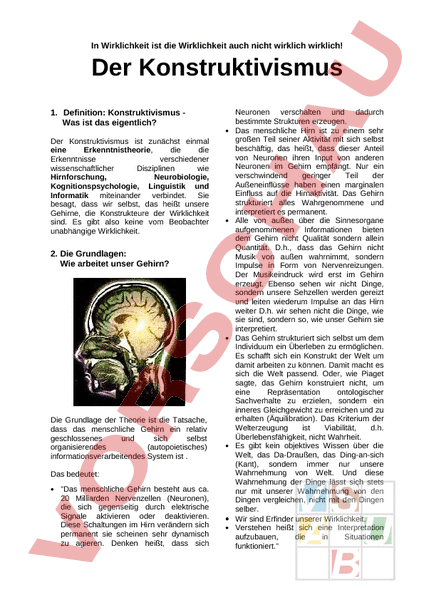Arbeitsblatt: Konstruktivismus
Material-Details
AB mit Texten und Aufgaben, durch die man mit Schülern/innen den philosoph. Konstruktivismus erarbeiten kann
Lebenskunde
Religionslehre / Bibel
12. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
46463
708
3
29.09.2009
Autor/in
Thomas Heger
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
In Wirklichkeit ist die Wirklichkeit auch nicht wirklich wirklich! Der Konstruktivismus 1. Definition: Konstruktivismus Was ist das eigentlich? Der Konstruktivismus ist zunächst einmal eine Erkenntnistheorie, die die Erkenntnisse verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen wie Hirnforschung, Neurobiologie, Kognitionspsychologie, Linguistik und Informatik miteinander verbindet. Sie besagt, dass wir selbst, das heißt unsere Gehirne, die Konstrukteure der Wirklichkeit sind. Es gibt also keine vom Beobachter unabhängige Wirklichkeit. • • 2. Die Grundlagen: Wie arbeitet unser Gehirn? • Die Grundlage der Theorie ist die Tatsache, dass das menschliche Gehirn ein relativ geschlossenes und sich selbst organisierendes (autopoietisches) informationsverarbeitendes System ist • Das bedeutet: • Das menschliche Gehirn besteht aus ca. 20 Milliarden Nervenzellen (Neuronen), die sich gegenseitig durch elektrische Signale aktivieren oder deaktivieren. Diese Schaltungen im Hirn verändern sich permanent sie scheinen sehr dynamisch zu agieren. Denken heißt, dass sich • • Neuronen verschalten und dadurch bestimmte Strukturen erzeugen. Das menschliche Hirn ist zu einem sehr großen Teil seiner Aktivität mit sich selbst beschäftig, das heißt, dass dieser Anteil von Neuronen ihren Input von anderen Neuronen im Gehirn empfängt. Nur ein verschwindend geringer Teil der Außeneinflüsse haben einen marginalen Einfluss auf die Hirnaktivität. Das Gehirn strukturiert alles Wahrgenommene und interpretiert es permanent. Alle von außen über die Sinnesorgane aufgenommenen Informationen bieten dem Gehirn nicht Qualität sondern allein Quantität. D.h., dass das Gehirn nicht Musik von außen wahrnimmt, sondern Impulse in Form von Nervenreizungen. Der Musikeindruck wird erst im Gehirn erzeugt. Ebenso sehen wir nicht Dinge, sondern unsere Sehzellen werden gereizt und leiten wiederum Impulse an das Hirn weiter D.h. wir sehen nicht die Dinge, wie sie sind, sondern so, wie unser Gehirn sie interpretiert. Das Gehirn strukturiert sich selbst um dem Individuum ein Überleben zu ermöglichen. Es schafft sich ein Konstrukt der Welt um damit arbeiten zu können. Damit macht es sich die Welt passend. Oder, wie Piaget sagte, das Gehirn konstruiert nicht, um eine Repräsentation ontologischer Sachverhalte zu erzielen, sondern ein inneres Gleichgewicht zu erreichen und zu erhalten (Äquilibration). Das Kriterium der Welterzeugung ist Viabilität, d.h. Überlebensfähigkeit, nicht Wahrheit. Es gibt kein objektives Wissen über die Welt, das Da-Draußen, das Ding-an-sich (Kant), sondern immer nur unsere Wahrnehmung von Welt. Und diese Wahrnehmung der Dinge lässt sich stets nur mit unserer Wahrnehmung von den Dingen vergleichen, nicht mit den Dingen selber. Wir sind Erfinder unserer Wirklichkeit. Verstehen heißt sich eine Interpretation aufzubauen, die in Situationen funktioniert. Auszüge aus: Frank Thissen, Das Lernen neu erfinden, Vortrag auf der Learntec 1997, leicht verändert Siehe auch unter: www.frank-thissen.de Diese neuen Erkenntnisse haben einen alten philosophischen Streit wieder aufleben lassen, den Streit zwischen Idealismus und Materialismus. Idealismus ist die philosophische Auffassung, dass die Idee, die Vernunft, der Geist oder moderner, das Bewusstsein die Wirklichkeit bestimmen. Im Gegensatz dazu glaubt der Materialismus, dass die materielle Wirklichkeit gegenüber der geistigen primär sei. Ihren klassischen Ausdruck fand der Materialismus in dem Satz von Karl Marx: Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Diese Form des Materialismus ist zugleich naturwissenschaftlich orientiert, erkenntnisoptimistisch und weitgehend antireligiös. 3. Realismus contra Konstruktivismus: Worum geht es bei diesem Streit? Das sog. Skepsisreferat1. fasst diesen Streit wie folgt zusammen: In der Geschichte der Philosophie gab es schon immer einen Konflikt zwischen zwei großen Schulen des Denkens. Auf der einen Seite standen Objektivismus, Materialismus und Realismus, und auf der anderen Seite Subjektivismus, Idealismus und Konstruktivismus. Sehen wir uns beide Richtungen ausführlicher an. Objektivismus, Materialismus und Realismus Drei Grundgedanken einen diese philosophische Richtung: Die Dinge und die Materie existieren außerhalb von uns und unabhängig von unserem Bewusstsein, also objektiv, positiv, materiell, real. 2. Die Materie wirkt auf unsere Sinnesorgane ein und erzeugt Empfindungen. 3. Und unser Erkenntnisvermögen ist ein spiegelartiges Instrument, welches die Dinge der Welt, die Materie, widerspiegelt, abbildet. 1. Dieses Denken, dieses Vorgehen wird heute als Kybernetik 1. Ordnung bezeichnet: Ein Beobachter beobachtet etwas, ohne selbst in Erscheinung zu treten. Und die Kybernetik 1. Ordnung entwickelt Theorien über Beobachtungsgegenstände und fragt z.B.: Wie funktioniert eine Maschine, ein Körper? Dieses Denken ist weit verbreitet, es ist «normal». Subjektivismus, Idealismus und Konstruktivismus Subjektivismus, Idealismus und Konstruktivismus sagen nun, dass da draußen, außerhalb von uns, ohne uns, sicherlich eine Welt existiert, dass wir aber diese wirkliche Welt leider niemals erkennen können, da diese immer nur unsere Vorstellung sein kann. Und woher sollen wir wissen, ob unsere Vorstellung von der Welt der Welt selbst entspricht? Hier wird also gesagt, dass jedes Erkennen prinzipiell an einen Organismus, an einen Beobachter gebunden ist. Das nennt man/frau heute Kybernetik 2. Ordnung. Die Kybernetik 2. Ordnung ist die Kybernetik der Kybernetik, hier wird gefragt, wie funktioniert die Beobachtung von Systemen. Warum wird diese Richtung nun oft Relativismus genannt? Nun, weil unsere Vorstellungen von der Welt niemals Abbild der Welt sein können, sondern immer nur von uns abhängig, auf uns bezogen, relativ zu uns sein können. Warum Idealismus? Idealisten werden diejenigen Philosophen genannt, die nur ihre eigene Existenz und die Existenz ihrer eigenen Empfindungen anerkennen und sagen: Woher soll ich wissen, was wirklich da draußen, außerhalb von mir, ist? Auf diese alte und sehr deutsche Philosophie-Tradition schlagen die Materialisten und Positivisten besonders gerne ein. Warum Konstruktivismus? Dieses Wort soll beschreiben, dass die Welt nicht passiv, also ohne unser Zutun in unseren Kopf hineinkommt. Die Welt erzeugt nicht von selbst in unserem Kopf irgendwelche Bedeutungen! Statt dessen konstruieren wir unser Wissen über die Welt selber! Moderne Realisten werfen den KonstruktivistInnen nun vor, dass sie die Existenz einer von ihnen unabhängigen Welt da draußen verneinen würden. Über diese ihre eigene Erfindung, können sich Realisten ziemlich lustig machen. Zitat: Ein Konstruktivist, der sich auf einem Berge verlor, sagte einem Rettungstrupp, als der ihn fand: Ich danke euch, dass ihr mich erfunden habt. (Bert Hellinger) Im Konstruktivismus wird aber nicht die Existenz einer von uns unabhängigen Welt bezweifelt, sondern es wird nur gesagt, dass wir die von uns unabhängig existierende Welt leider nicht sehen und empfinden können, wie sie wirklich ist, sondern nur, wie wir sie mit Hilfe unserer Erkenntniswerkzeuge konstruiert haben Man muss also bei der Auseinandersetzung mit der Theorie des Konstruktivismus den Bedeutungsunterschied zwischen Realität und Wirklichkeit verstehen. Realität ist hierbei die objektive, von uns nicht erkennbare tatsächliche Welt. Im Gegensatz dazu steht der Begriff Wirklichkeit für unsere subjektive Sicht dieser Realität. Wir können über die Realität also keine Aussage treffen, sondern wissen nur, dass sie existieren muss.) 4. Objektiv oder subjektiv? Was also ist die Wirklichkeit? An dieser Stelle muss zuerst der Begriff der Intersubjektivität erklärt werden. Intersubjektivität ist die These, dass eine von vielen konstruierte subjektive Meinung objektive Züge bekommt. Das ist eine entscheidende Voraussetzung für das Zustandekommen kommunikativer Prozesse zwischen Menschen. Diese Kommunikation kann allerdings nur zwischen Systemen stattfinden, die ähnliches oder sogar gleiches Vorwissen, Erfahrungen, Sprache und Kultur teilen. Weiter nun im Skepsisreferat: Ludwig Fleck (1896–1961), ein polnischer Denker, hat den Umstand, dass wir nur das wahrnehmen können, für das wir Begriffe haben, so ausgedrückt: Um zu sehen, muss man zuerst wissen! Und sehen heißt, im entsprechenden Moment das Bild nachzubilden, das die Denkgemeinschaft geschaffen hat, der man angehört. Das heißt, unsere Wahrnehmungsbegriffe, unsere Einheiten der Wirklichkeitsbetrachtung, erhalten wir aus unserem spezifischen kommunalen System, woher sonst. Fleck drückt es unwiederbringlich so aus: «Wir schauen mit den eigenen Augen, aber wir sehen mit den Augen des Kollektivs!» Was ist also Wirklichkeit? Wirklichkeit ist Gemeinschaft. Dinge sind erst dann wirklich, wenn sich eine Gemeinschaft von Menschen darauf geeinigt hat. Was in uns letztlich wahrnimmt und denkt, ist also gar nicht unser Ich, sondern die soziale Gemeinschaft, der wir angehören, Kultur. Gehen wir weiter: Wenn die Welt, die wir zu erleben glauben, notwendigerweise von uns selbst konstruiert wird, ist es kaum erstaunlich, dass sie uns so relativ stabil erscheint. Wir sehen ja eigentlich nur Bekanntes! Ganz buchstäblich begreifen wir nur das, was von uns längst interpretiert ist. Verum ipsum factum: Was wir sehen, ist wahr, weil wir es selbst gemacht, hergestellt, konstruiert haben. Und weil wir das, was wir sehen, selbst machen, erscheint uns die Wirklichkeit auch so stabil! Nur ein Beispiel: Ein roter Ball unter den verschiedensten Beleuchtungsbedingungen am Morgen, Mittag oder Abend wird von uns immer als der gleiche rote Ball gesehen, erstaunlich! 5. Zwei Zitate zum Schluss: Was will der Konstruktivismus? Der Radikale Konstruktivismus begreift sich selbst als eine Konstruktion und nicht als eine letzte Wahrheit, er ist eine Möglichkeit, die Dinge zu sehen. Für mich ist, dies kann ich auch mit Blick auf meine therapeutische Arbeit sagen, allein die Frage ausschlaggebend, welche Konstruktion sich als die nützlichste und menschlichste erweist. Paul Watzlawick im Buch Abschied vom Absoluten Die Gewissheit der Ungewissheit (2001) Aus der Idee des Konstruktivismus ergeben sich zwei Konsequenzen. Erstens die Toleranz für die Wirklichkeiten anderer denn dann haben die Wirklichkeiten anderer genauso viel Berechtigung als meine eigene. Zweitens ein Gefühl der absoluten Verantwortlichkeit. Denn wenn ich glaube, dass ich meine eigene Wirklichkeit herstelle, bin ich für diese Wirklichkeit verantwortlich, kann ich sie nicht jemandem anderen in die Schuhe schieben. Paul Watzlawick im Buch Die Unsicherheit unserer Wirklichkeit 1. Das Skepsisreferat ist das grundlegende Referat zum Konstruktivismus der Boag (Bochumer Arbeitsgemeinschaft für sozialen Konstruktivismus) www.boag.de Arbeitsblatt zum Konstruktivismus Soweit die Theorie. Man nennt sie auch Erkenntnistheorie oder Epistemologie. Haben Sie den neuen konstruktivistischen Ansatz der Erkenntnistheorie verstanden? Dann ordnen Sie die folgenden sechs Aussagen entweder der traditionellen (realistischen) oder der neuen Erkenntnistheorie zu und bringen Sie die Sätze in eine logische Reihenfolge. Welt ist die Ursache, Erfahrung die Folge. Wirklichkeit ist, was auf den Beobachter passiv einwirkt. Erfahrung ist die Ursache, die Welt die Folge. Welt wird durch Erfahrung konstruiert. Wirklichkeit ist, was der Beobachter aktiv erwirkt. Welt, die schon vor der Erfahrung besteht, wird abgebildet. Realismus Konstruktivismus Und nun zur Praxis -. Überlegen Sie: Was bedeuten diese neun Erkenntnisse für mich? Was habe ich gelernt? Allein das Trauen und Glauben machen beide, Gott und Abgott .Worauf du nun dein Herz hängst und die verlässt, das ist eigentlich Dein Gott. schrieb Martin Luther in der Erklärung zum 1. Gebot im Großen Katechismus. Was bedeutet dieser Satz auf dem Hintergrund der konstruktivistischen Erkenntnistheorie für die Gottesfrage und unseren Glauben?