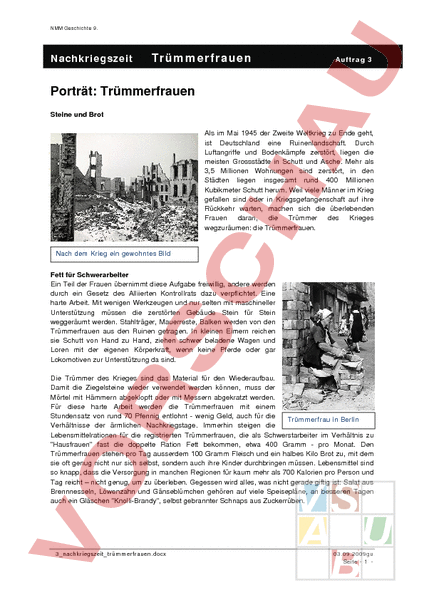Arbeitsblatt: Nachkriegszeit Trümmerfrauen
Material-Details
Arbeitsauftrag
Geschichte
Neuzeit
9. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
46936
1336
26
09.10.2009
Autor/in
Urs Guggisberg
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
NMM Geschichte 9. Nachkriegszeit Trümmerfrauen Auftrag 3 Porträt: Trümmerfrauen Steine und Brot Als im Mai 1945 der Zweite Weltkrieg zu Ende geht, ist Deutschland eine Ruinenlandschaft. Durch Luftangriffe und Bodenkämpfe zerstört, liegen die meisten Grossstädte in Schutt und Asche. Mehr als 3,5 Millionen Wohnungen sind zerstört, in den Städten liegen insgesamt rund 400 Millionen Kubikmeter Schutt herum. Weil viele Männer im Krieg gefallen sind oder in Kriegsgefangenschaft auf ihre Rückkehr warten, machen sich die überlebenden Frauen daran, die Trümmer des Krieges wegzuräumen: die Trümmerfrauen. Nach dem Krieg ein gewohntes Bild Fett für Schwerarbeiter Ein Teil der Frauen übernimmt diese Aufgabe freiwillig, andere werden durch ein Gesetz des Alliierten Kontrollrats dazu verpflichtet. Eine harte Arbeit. Mit wenigen Werkzeugen und nur selten mit maschineller Unterstützung müssen die zerstörten Gebäude Stein für Stein weggeräumt werden. Stahlträger, Mauerreste, Balken werden von den Trümmerfrauen aus den Ruinen getragen. In kleinen Eimern reichen sie Schutt von Hand zu Hand, ziehen schwer beladene Wagen und Loren mit der eigenen Körperkraft, wenn keine Pferde oder gar Lokomotiven zur Unterstützung da sind. Die Trümmer des Krieges sind das Material für den Wiederaufbau. Damit die Ziegelsteine wieder verwendet werden können, muss der Mörtel mit Hämmern abgeklopft oder mit Messern abgekratzt werden. Für diese harte Arbeit werden die Trümmerfrauen mit einem Stundensatz von rund 70 Pfennig entlohnt wenig Geld, auch für die Trümmerfrau in Berlin Verhältnisse der ärmlichen Nachkriegstage. Immerhin steigen die Lebensmittelrationen für die registrierten Trümmerfrauen, die als Schwerstarbeiter im Verhältnis zu Hausfrauen fast die doppelte Ration Fett bekommen, etwa 400 Gramm pro Monat. Den Trümmerfrauen stehen pro Tag ausserdem 100 Gramm Fleisch und ein halbes Kilo Brot zu, mit dem sie oft genug nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Kinder durchbringen müssen. Lebensmittel sind so knapp, dass die Versorgung in manchen Regionen für kaum mehr als 700 Kalorien pro Person und Tag reicht – nicht genug, um zu überleben. Gegessen wird alles, was nicht gerade giftig ist: Salat aus Brennnesseln, Löwenzahn und Gänseblümchen gehören auf viele Speisepläne, an besseren Tagen auch ein Gläschen Knolli-Brandy, selbst gebrannter Schnaps aus Zuckerrüben. 3_nachkriegszeit_trümmerfrauen.docx 03.09.2009gu Seite 1 NMM Geschichte 9. Hamsterfahrten und Zigaretten Was über Lebensmittelkarten nicht verfügbar ist, muss zu horrenden Preisen auf dem Schwarzmarkt organisiert werden. Hier kann ein Pfund Butter über 200 Mark kosten. Für die meisten Frauen ist das unerschwinglich, es sei denn, sie können Tauschware anbieten, Zigaretten zum Beispiel, die heimliche Währung der Schwarzhändler. Für ein paar Stangen amerikanischer Zigaretten kann man sogar fahrtüchtige Autos eintauschen. Das Einkaufen auf dem Schwarzmarkt, Hamsterfahrten aufs Land, die Suche nach geeigneten Schlafplätzen, das Herstellen von Kleidung aus alten Decken und Uniformen all dies geschieht neben der täglichen Arbeit in den Trümmerlandschaften. Manche Frauen überleben ihre Einsätze nicht: Einstürzende Gebäude und fast vollkommen fehlender Arbeitsschutz machen die Aufräumarbeiten zu einem gefährlichen Unterfangen. Trotz dieser schwierigen Bedingungen sind allein in Berlin bis zu 60.000 Frauen mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Darunter Frauen aus Arbeiterfamilien und ehemals reiche Damen der feinen Frauen kochen in der TrümmerGesellschaft, junge Mädchen, die gerade aus der Schule landschaft entlassen worden waren und viele Frauen, die mit den pseudo-idyllischen Familienbildern der Nazi-Ideologie gross geworden sind und jetzt ihre Kinder allein erziehen müssen, weil ihre Männer im Krieg gefallen sind. Die soziale Gemeinschaft der Trümmerfrauen ist prägend für die Jahre der Nachkriegszeit. Die Frauen, die sich täglich auf den Enttrümmerungsstellen treffen, tauschen sich hier über die aktuellen politischen Ereignisse und die neuesten Lageberichte vom Schwarzmarkt aus. In den Trümmern werden Informationen und Rezepte weitergegeben – nicht nur für die dürftige Nachkriegsküche, sondern auch für das psychische Überleben unter der extrem hohen Belastung jener Jahre. Ende der 40er Jahre übernehmen nach und nach neue Baufirmen die Aufräumarbeiten und den Wiederaufbau der zerstörten Städte. Die Trümmerfrauen sind immer seltener Bestandteil des alltäglichen Strassenbilds, denn an den Hebeln und Lenkrädern von Baggern, Lokomotiven und Lastwagen sitzen jetzt wieder Männer. Das Wirtschaftswunder tilgt die Kultur der hart arbeitenden, selbstständigen Frauen vollends. Zwar wird das Bild selbstloser, tapferer Trümmerfrauen zu einem heroischen Symbol für das Rückgrat des Wiederaufbaus, aber für Jahrzehnte bleibt es bei der traditionellen Rollenverteilung: Der Mann geht zur Arbeit, die Frau führt daheim den Haushalt. Und erst im Jahr 1987 gibt es in Form einer Rentenerhöhung auch eine kleine materielle Anerkennung für die Trümmerfrauen, die noch leben. Weshalb mussten die Frauen diese Arbeit verrichten? Wo waren die Männer in der Zeit des Aufbaus? Woher kommt der Name Trümmerfrauen? Wie viele Kalorien hatten die Frauen durchschnittlich pro Tag zur Verfügung? Wie viele Kalorien haben wir heute durchschnittlich zur Verfügung? Wo besorgte man sich nach Möglichkeit zusätzliche Nahrung oder Sachen des täglichen Lebens? Wie viele Wohnungen waren nach dem Krieg zerstört? In welchem Jahr (nach 1945) erhalten die Frauen erstmals eine Anerkennung vom Staat in Form von höheren Renten? Wie viele Frauen waren alleine in Berlin zeitweise im Einsatz? 3_nachkriegszeit_trümmerfrauen.docx 03.09.2009gu Seite 2