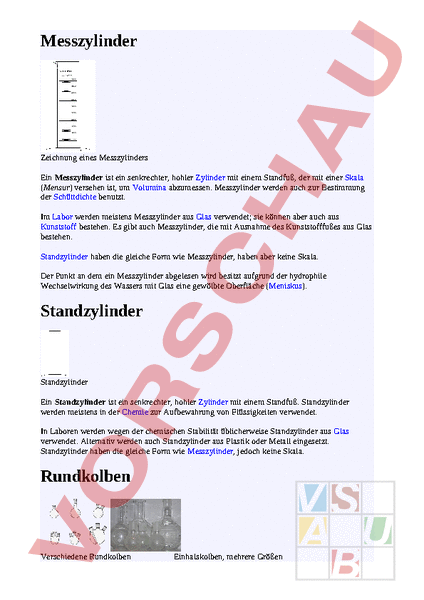Arbeitsblatt: Laborgeräte
Material-Details
Textsammlung zum erarbeiten der einzelnen Laborgeräte, dazu Anleitung zum Hefteintrag unter Lborgeräte Hefteintrag in meiner Sammlung
Chemie
Anderes Thema
9. Schuljahr
12 Seiten
Statistik
47187
1290
2
13.10.2009
Autor/in
Sibsi (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Messzylinder Zeichnung eines Messzylinders Ein Messzylinder ist ein senkrechter, hohler Zylinder mit einem Standfuß, der mit einer Skala (Mensur) versehen ist, um Volumina abzumessen. Messzylinder werden auch zur Bestimmung der Schüttdichte benutzt. Im Labor werden meistens Messzylinder aus Glas verwendet; sie können aber auch aus Kunststoff bestehen. Es gibt auch Messzylinder, die mit Ausnahme des Kunststofffußes aus Glas bestehen. Standzylinder haben die gleiche Form wie Messzylinder, haben aber keine Skala. Der Punkt an dem ein Messzylinder abgelesen wird besitzt aufgrund der hydrophile Wechselwirkung des Wassers mit Glas eine gewölbte Oberfläche (Meniskus). Standzylinder Standzylinder Ein Standzylinder ist ein senkrechter, hohler Zylinder mit einem Standfuß. Standzylinder werden meistens in der Chemie zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten verwendet. In Laboren werden wegen der chemischen Stabilität üblicherweise Standzylinder aus Glas verwendet. Alternativ werden auch Standzylinder aus Plastik oder Metall eingesetzt. Standzylinder haben die gleiche Form wie Messzylinder, jedoch keine Skala. Rundkolben Verschiedene Rundkolben Einhalskolben, mehrere Größen Rundkolben sind die Standard-Reaktionsgefäße in der organischen Chemie. Rundkolben werden in verschiedensten Größen (von 10 ml bis zu 25 l) und auch als Mehrhalskolben hergestellt. Die Normschliff-Rundkolben haben 29 oder 14,5 mm Anschluss-Hülsen für weitere Glasgeräte. Rundkolben dürfen im Gegensatz zu Standkolben (z. B. Erlenmeyerkolben) unter Vakuum gesetzt werden, ohne dass die Gefahr einer Implosion besteht. Zudem ermöglicht die runde Form gleichmäßigeres Erwärmen. Titrierkolben (Stehkolben) Titrierkolben Stehkolben sind Labor-Glasgefäße. Sie ähneln den Rundkolben, besitzen aber einen weiten Hals und einen abgeflachten Boden, so dass sie ohne Gummiring standfähig sind. Die fast runde Form gewährleistet eine gute Vermischung beim Schwenken, durch den engeren Hals kann stärker geschwenkt werden als bei Bechergläsern, ohne dass Flüssigkeit entweicht. Erlenmeyerkolben Erlenmeyerkolben Der nach dem Chemiker Emil Erlenmeyer (1825–1909) benannte Erlenmeyerkolben ist ein Glasgefäß mit einem – im Gegensatz zum Becherglas – nach oben hin enger werdenden Hals. Er wird als Laborgerät genutzt. Im Laborgebrauch existieren verschiedene Varianten des Erlenmeyerkolbens, die Enghals- und die Weithals-Form und je nach Anwendung auch Kolben mit Normschliff. Durch den verjüngenden Hals ist die Gefahr, dass bei Zugabe von Substanzen, beim Schwenken, Rühren oder Sieden Flüssigkeiten aus dem Kolben unkontrolliert entweichen, deutlich kleiner als bei Bechergläsern. So können im Erlenmeyerkolben bequem z. B. Flüssigkeiten vermischt oder Lösungsvorgänge durch – auch relativ heftiges – Schwenken oder Rühren beschleunigt werden. Er eignet sich – wie der Rundkolben – auch gut für den Magnetrührer, kann aber wegen seines flachen Bodens direkt abgestellt werden. (Der Rundkolben hingegen benötigt einen Korkring oder ein Stativ für den festen Stand, letzteres macht ein Schwenken mit der Hand oder ein häufiges Prüfen durch Halten ins Gegenlicht unmöglich.) Dünnwandige Erlenmeyerkolben dürfen nicht evakuiert werden, da wegen des flachen Bodens Implosionsgefahr herrscht. Eine dickwandige Sonderform des Erlenmeyerkolbens ist die Saugflasche. Erlenmeyerkolben wurden ursprünglich aus Glas (heute überwiegend Borosilicatglas oder Duranglas) gefertigt, mittlerweile auch aus verschiedenen Kunststoffen wie Polycarbonat, Polyethylenterephthalat-Copolyester (PETG), Polymethylpenten, Polypropylen, Teflon (FEP). Zudem gibt es Modelle mit Schraubverschluss und Kolben mit Schikanen am Boden, für eine bessere Durchmischung. Die Volumina reichen von 25 bis 5000 ml. Erlenmeyerkolben mit Schliff werden auch als Jodzahlkolben bezeichnet. Spritzflasche verschiedene Plastik-Spritzflaschen Eine Spritzflasche ist ein Laborgerät zum Bereitstellen von Flüssigkeiten wie zum Beispiel Wasser, Aceton oder Ethanol. Spritzflaschen kommen außer im Labor in vielen Bereichen zum Einsatz, wenn es gilt Flüssigkeiten präzise und dosiert einzubringen. Moderne Spritzflaschen bestehen aus einem luftdicht verschlossenen Flaschenkörper aus Polyethylen sowie einem in die Flüssigkeit hineinragenden Kunststoffröhrchen. Die Flüssigkeit wird durch Zusammendrücken der Flasche durch eine kleine Öffnung an der Spitze des Röhrchens herausgepresst, so dass das Ziel des Strahles und die Flüssigkeitsmenge genau dosiert werden können. Die klassische Spritzflasche, auch als „Spritzkolben bezeichnet, bestand aus Glas. Die Flüssigkeit wurde nicht wie heute durch Zusammendrücken herausgepresst, sondern es musste durch ein zweites Röhrchen hineingeblasen werden, so dass die Flüssigkeit durch den Überdruck herausfloss. Sie konnte auch zum Auswaschen von Niederschlägen (ausgefällte Feststoffe) benützt werden. Waschflasche Waschflasche Waschflasche 1000 ml Die Waschflasche (Impinger) oder auch Gaswaschflasche ist ein Laborgerät, in welches ein Gasfluss eingeschaltet wird, wobei das Gas mittels eines Tauchrohres gezwungen wird, durch eine Flüssigkeit zu perlen, bevor es den Behälter wieder verlässt. Es dient dazu Gase zu reinigen (waschen). Die Flasche ist mit einem Lösungsmittel gefüllt, in das das gaszuführende Röhrchen eintaucht. Die direkt eingeleiteten durchperlenden Gase werden von Verunreinigungen teilweise oder ganz befreit, indem diese im Lösungsmittel zurückbleiben. Die gewaschenen Gase können danach durch ein zweites Rohr oben im Gefäß wieder abziehen. Die eigentliche Einleitung des Gases in die Flüssigkeit kann im einfachsten Falle durch ein Glasrohr erfolgen, alternativ werden jedoch perforierte Düsenplatten oder Fritten aus den verschiedensten Materialien verwendet. Auf diese Weise sollen möglichst kleine Gasblasen erzeugt werden, so dass eine große Kontaktfläche zwischen Gas und Flüssigkeit entsteht. Als Material kommt im Labor hauptsächlich Glas zum Einsatz, doch gibt es auch Flaschen aus chemisch beständigen Kunststoffen und in seltenen Fällen sogar aus Metall. Liebigkühler Liebigkühler Der Liebigkühler ist ein Laborkühler, der Dämpfe zum Kondensieren bringt und in einem Röhrchen weiterleitet. Erfinder des Liebigkühlers ist nicht wie der Name vermuten lässt Justus Liebig; der Kühler wurde schon vor Liebig verwendet.[1] Allerdings hat Liebig ihn populär gemacht. Glasstab Ein Glasstab ist ein gewöhnliches Laborgerät, das zum Umrühren von meistens organischen oder leicht reaktiven Gemischen verwendet wird. Er wird universell in allen naturwissenschaftlichen Einrichtungen wie Realschulen, Gymnasien, Universitäten oder Instituten verwendet. Der Glasstab zeichnet sich vor allem durch seine schmutzabweisende Fähigkeit, seine Reaktionsträgheit mit anderen Stoffen und seinen niedrigen Preis aus. Jedoch ist er ein Verschleißmittel, da er meistens nach wenigen Versuchen kaputt geht. Er kann unterschiedlich lang und breit sein das Hauptmerkmal ist die komplette Zusammensetzung aus Glas. Glasstäbe gibt es in unterschiedlichen Längen und Dicken. Zum einen bezieht man Glasstäbe als Meterware und konfektioniert sich seine gewünschten Längen mit einem Glasschneider ab. Zum anderen gibt es spezielle Fertigteile, die beispielsweise einen eingeschmolzenen Hohlraum besitzen, der in der Flüssigkeit gegen Siedeverzug schützen soll. Als Peterson-Jones- oder auch nur Peterson-Haken bezeichnet man einen speziell geformten Labor-Glasstab. Die Grundform besteht am einen Ende aus einer dünnen, hakenförmig gebogenen Spitze und am anderen Ende aus einem flachgedrückten so genannten Elephantenfuß. Peterson-Jones-Haken gibt es in diversen Längen und Größen. Vorzugsweise werden sie als Kratz und Schabwerkzeuge in chemischen Laboren genutzt. Becherglas Becherglas 600 ml Ein Becherglas ist ein zylindrischer Becher, der oben einen abgebogenen Rand und eine Ausguss-Möglichkeit hat. Am Rand ist ein grober Maßstab aufgedruckt. Das Becherglas ist neben dem Erlenmeyerkolben eines der am häufigsten verwendeten Glasgefäße im Labor. Das Becherglas wird für vielfältige Aufgaben verwendet, bei denen ein einfaches Glasgefäß benötigt wird, beispielsweise zum Erhitzen oder zum Zusammengießen verschiedener Flüssigkeiten. Der Vorteil des Becherglases liegt darin, dass das Borosilikatglas hitzeresistent und durchsichtig ist. Außerdem ist das Material relativ preisgünstig. Es werden auch Bechergläser aus Polypropylen angeboten, die jedoch nicht hitzeresistent und auch weniger chemikalienbeständig sind. Neben den Standardproportionen (Becherglas weite breite Form) gibt es auch etwas schmalere und höhere Bechergläser (Becherglas hohe Form). Bechergläser sind in Größen von 5 ml bis 10 Liter und mehr erhältlich. Trichter Trichter Heißwassertrichter zur heißen Filtration Trichter mit dampfbeheizter Schlange zur heißen Filtration Ein Trichter (von lateinisch: traiectorium) ist ein Gerät, mit dessen Hilfe man Flüssigkeiten oder kleingekörnte Stoffe in Gefäße mit kleiner Öffnung z. B. Flaschen einfüllen kann, ohne dabei etwas zu verschütten. Bei hochwertigen Trichtern ist der Hals (der dünne Teil) mit einer Kerbe versehen, welche dazu dient, Luft aus dem zu befüllenden Gefäß entweichen zu lassen. Scheidetrichter Scheidetrichter Ein Scheidetrichter (auch Schütteltrichter) ist ein Glasgerät, das im chemischen Labor verwendet wird, um nicht mischbare Flüssigkeiten zu trennen. Das Gerät hat oben eine Schlifföffnung, die mit einem Stopfen verschlossen werden kann, und unten einen Hahn. Werden nun zwei nicht mischbare Flüssigkeiten (zwei Phasen) eingefüllt (z. B. Wasser und Öl), so sammelt sich die Flüssigkeit mit der größeren Dichte unten an (bei Wasser und Öl also das Wasser) und kann über den Hahn in ein anderes Gefäß abgelassen werden. Die nach unten schmaler werdende Form des Gefäßes erleichtert eine genaue Trennung, also das Schließen des Hahnes, gerade bevor die leichtere Phase anfängt, auszurinnen. In der organisch chemischen Laboratoriumstechnik wird es dazu verwendet um Stoffe zu extrahieren. Dazu gibt man ein Lösemittel hinzu welches den zu extrahierenden Stoff besser löst, jedoch nicht mit dem vorherigen Lösemittel mischbar ist. Nach mehrmaligem Schütteln, Ablassen und Hinzugabe von neuem Lösemittel ist der gewünschte Stoff in dem neuen Lösemittel angereichert. Dieses Verhalten wird für den gelösten Stoff mit dem Nernstschen Verteilungssatz beschrieben. Ungewünschte Stoffe können mit dem richtigen Lösemittel außen vor bleiben oder der Stoff aus schwer verdampfbaren Lösemitteln entfernt werden. Es handelt sich also um eine Reinigungsoperation. Thermometer Ein Thermometer (v. griech.: „thermos warm und „metron Maß) ist ein Messgerät zur Erfassung der Temperatur. Flüssigkeitsthermometer Digitales Thermometer Pipetten Tropfpipette Wegwerfpipetten Ist auf der Pipette eine Volumen-Skala angebracht, spricht man von einer Messpipette. Eine Pipette, die nur eine einzige Markierung für ein definiertes Volumen hat, heißt Vollpipette. Messpipetten sind für unterschiedliche Flüssigkeitsmengen geeignet und damit flexibler, aber auch ungenauer als Vollpipetten. Beide Pipettenarten sind auf Flüssigkeiten mit der Temperatur von 20 C und auf Ausfluss (Ex.) geeicht, Auslaufzeiten werden, wenn nötig, auf den Pipetten angegeben. Unter einer Tropfpipette versteht man ein Glasrohr von ca. 5 mm Durchmesser, welches am unteren Ende verjüngt ist und am oberen Ende mit einem Gummisauger versehen werden kann. Sie dient zum tropfenweisen Dosieren von kleinen Flüssigkeitsmengen. Einfache Wegwerfpipetten aus Kunststoff mit bis zu 10 ml Volumen werden heutzutage für häufige und einfache Dosierarbeiten mit geringer Genauigkeitsanforderung verwendet. Pneumatische Wanne Pneumatische Wannen gehören zur typischen Laborgeräteausstattung. Sie sind einfache Glasschüsseln mit rundem, großem Boden und zylindrisch aufsteigenden Wänden. Man verwendet sie häufig in Demonstrationsexperimenten, wenn Vorgänge in einem Wasserbad für den Zuschauer sichtbar ablaufen sollen. Außerdem kann man sie zur Abfüllung von Gasen verwenden, wenn man zuvor einen mit Wasser gefüllten Standzylinder in der pneumatischen Wanne unter dem Wasserspiegel mit der Öffnung nach unten aufstellt und durch einen Schlauch Gas einleitet. Statt eines Standzylinders werden in Schulen auch manchmal Reagenzgläser als Messbehälter verwendet. Bunsenbrenner Bunsenbrenner Der Bunsenbrenner ist ein kleiner Gasbrenner, bei dem das Brenngas nach dem Prinzip einer Strahlpumpe die Verbrennungsluft teilweise selbst ansaugt. Der Bunsenbrenner wird neben dem Teclubrenner im chemischen Labor häufig zum Erhitzen von Stoffproben oder Flüssigkeiten benutzt. Der Bunsenbrenner ist nach Robert Wilhelm Bunsen (1811–1899) benannt, der das Grundprinzip dahinter jedoch nicht erfand. Die ursprüngliche Erfindung stammt von Michael Faraday und wurde von Peter Desaga, dem Laborassistenten Bunsens, 1855 in Heidelberg entscheidend verbessert. Tiegel (Gefäß) Platin- und Quarzglastiegel mit Tiegelzange Ein Tiegel ist ein feuerfestes und chemisch resistentes Gefäß zum Erhitzen von Stoffen oder zur Herstellung von Schmelzen. Es kann z. B. aus Keramik (Schamotte, Tonerde, Zirconiumoxid und Graphit), Glas oder Metall bestehen. Im Labor werden Tiegel in einer typischen, unten verjüngten Form verwendet, um in einem Tondreieck in einer Flamme erhitzt zu werden. Neben den einfachen Tiegeln aus Porzellan, die meist nur einmal verwendet werden, sind Nickel-, Platin- und Quarzglastiegel die häufigsten Materialien. Platintiegel können, ohne angegriffen zu werden, bei sehr hohen Temperaturen verwendet werden, allerdings besteht bei einigen Probematerialien die Gefahr des Zerspringens oder der chemischen Angreifbarkeit. Quarzglastiegel sind extrem temperaturwechselbeständig und können unbeschadet rotglühend in kaltem Wasser abgeschreckt werden. Oft wird ein Deckel verwendet, um ein Abdampfen zu verhindern und ein Abkühlen des Inneren zu vermeiden. Im Sächsischen und Thüringischen bezeichnet Tiegel oftmals noch eine Bratpfanne. Umgekehrt bezeichnet Pfanne einen großen industriellen Tiegel der Stahlherstellung (Stahlgießpfanne). Abdampfschale Abdampfschalen in verschiedenen Größen Die Abdampfschale ist ein Laborgerät zum Erhitzen von Lösungen. Sie besteht meistens aus Porzellan oder Keramik. Abdampfschalen werden benutzt um überschüssiges Wasser – oder ein anderes Lösungsmittel – zu verdampfen, damit eine konzentrierte Lösung oder der darin gelöste Stoff zurückbleibt. Dieser Vorgang wird in der Fachsprache auch Einengen genannt. Für die Schule gibt es, neben den üblichen weißen, auch schwarze Abdampfschalen, um einen weißen Rückstand besser zeigen zu können. Die Form der Abdampfschale beschleunigt aus drei Gründen das Verdunsten: • • • Die Schale ist relativ flach. Eine relativ große Flüssigkeitsoberfläche begünstigt das Verdunsten. Beim Erhitzen in einem Kolben oder Becherglas kondensiert ein Teil des Dampfes an den Gefäßwänden und fließt zurück in die Lösung. Das ist hier nicht möglich. Durch die offene Form wird der Dampf schon bei leichtem Luftzug abtransportiert. Das Erhitzen einer Flüssigkeit in einer Abdampfschale muss äußerst vorsichtig erfolgen, da die niedrigen Wände ein Verspritzen begünstigen. Zum Rühren oder Schwenken von Flüssigkeiten sind Abdampfschalen kaum geeignet. Zum Eindampfen im Labor wird heute meist ein Rotationsverdampfer bevorzugt, weil dieser wesentlich schneller arbeitet und oft die Verwendung eines Unterdrucks oder eines Vakuums gestattet. Auch Siedeverzüge treten weniger heftig auf, als bei anderen Laborgeräten. Pistill Reibschale und Pistill Der Pistill ist ein Werkzeug, mit dem Reibegut in einer Reibschale zerkleinert wird oder das zur Herstellung von Salben und Cremes in einer Fantaschale genutzt wird. Bei dem Pistill zur Nutzung in einer Reibschale ist die Arbeitsfläche (das kugelförmige Ende) angeraut, um die Reibung zu vergrößern. Dagegen ist der Pistill zur Herstellung halbfester Zubereitungen in der Apotheke glatt. Reibschalen Reibschalen dagegen sind meist aus Porzellan und besitzen an der Innenfläche eine raue Oberfläche. Der hier verwendete Pistill ist ebenfalls an der Arbeitsfläche angeraut. Reibschale und Pistill müssen für einen effektiven Gebrauch so abgestimmt sein, dass der Wölbungsradius der Innenfläche der Reibschale immer größer ist als der Wölbungsradius der Arbeitsfläche des Pistills. Nur so lässt sich das Entstehen von Toträumen während der Arbeit vermeiden. Eine Reibschale dient zum Zerkleinern (Zerreiben) pulverförmiger fester Substanzen, die eine ausreichende Sprödigkeit aufweisen. Die Zerkleinerung wird durch kreisende mit leichtem Druck ausgeführte Bewegungen des Pistills erreicht. Wesentliches Zerkleinerungsprinzip ist dabei die Reibung zwischen den beiden angerauhten Flächen. Bei sorgfältiger Arbeitsweise und geeigneten Pulvern lassen sich Teilchengrößen bis 50 m erreichen Uhrglas Uhrglas mit einer Caesiumfluorid-Probe Uhrgläser (oder: Uhrglasschalen) sind runde, zu den Außenrändern hin leicht konkav gewölbte Glasscheiben mit einem Durchmesser von etwa 4 bis 20 cm, die in der chemischen Labortechnik Anwendung finden. Der Begriff Uhrglas leitet sich von der Anwendung ähnlich gewölbter Gläser als Schutzglas von Taschen- und Wanduhren ab. Durch die konkave Form lassen sich in Uhrgläsern kleine Mengen Flüssigkeiten füllen, um diese verdampfen zu lassen. Uhrgläser aus Borosilikatglas (Duran(R)) kann man auch über Bunsenbrennern erhitzen, um das Verdampfen zu beschleunigen. Uhrgläser werden häufig benutzt, um Bechergläser, Petrischalen oder die Öffnung von Kolben oder Flaschen als Schutz vor Verunreinigung, Spritzern und stärkerer Verdunstung abzudecken. Heute erfolgt im Labor das Abdecken von Gefäßen statt mit Uhrgläsern häufig mit Parafilm oder Alufolie als Verschlussfolie, das vollständige Verschließen oft mit Verschlussstopfen. Des Weiteren eignen sich Uhrgläser dafür, kleinere Mengen von Substanzen ein- und abzuwiegen oder im Trockenschrank zu trocknen. Spatel Löffelspatel Der Spatel ist ein Laborgerät zum Abkratzen, Zerkleinern und Transportieren von Chemikalien. Spatel bestehen aus verschiedenen Materialien (Eisen, Titan, Platin, Halbedelstein, Nickel, Keramik) und können verschiedene Formen haben (z. B. Flachspatel, Drigalskispatel oder Löffelspatel). Spatel können in der Regel nicht zum Rühren in aggressiven Lösungen verwendet werden: Metallspatel – auch solche aus Edelstahl – korrodieren z. B. in (konzentrierten) Säuren, lackierte Spatel werden von manchen Lösungsmitteln angegriffen. Glasstäbe, Teflonstangen oder -Rührfische sind in den meisten Fällen chemisch beständiger als Spatel. Gelegentlich wird der Spatel mit einem Spachtel verwechselt. Reagenzglasgestell Oft werden Reagenzgläser auch in einen Reagenzglaskasten auch bekannt als Reagenzglasständer gestellt. Reagenzglas Ein Reagenzglas (auch „Eprouvette oder „Probierglas genannt) ist ein kleines, einseitig geöffnetes, fingerförmiges Behältnis aus Glas. Reagenzgläser werden in Laboratorien für chemische Reaktionen, Untersuchungen, zur Aufbewahrung von kleinen Flüssigkeitsmengen und vielem Weiteren verwendet. Sie werden in verschiedensten Größen hergestellt (ca. 2 bis 20 cm Länge, Durchmesser zwischen 0,6 und 3 cm). Eine Standardgröße in chemischen Labors ist 16 cm lang und 16 mm im Durchmesser. Verschlossen werden sie mit Kunststofffolien, AluVerschlusskappen, Kork- oder Kunststoffstopfen (umgangssprachlich auch Stöpsel genannt). In Handel gibt es auch Reagenzgläser mit Normschliffen, die mit Schliffstopfen aus Glas oder Kunststoff verschlossen werden. Einige sind mit einer Volumenskala in Millilitern bedruckt. Gläser, die in einer Flamme erwärmt werden sollen (z. B. über dem Bunsenbrenner), sind meist dünnwandig, um Bruch durch thermische Spannungen zu vermeiden. Der Preis eines einfachen Reagenzglases in Standardgröße (16 cm) beträgt ungefähr 10 Cent oder aufwärts, wobei das verwendete Material und die Variation eine entscheidende Rolle spielen. Z. B. kostet eines aus Braunglas mit Normschliff und Olive (die Olive, auch Ansatz genannt, ist ein seitlich abstehendes Glasrohr, an dem man z. B. einen Schlauch anschließen kann) zwischen 3 und weit über 10 €. Reagenzgläser sind in verschiedenen Formen erhältlich, z. B. mit rundem, konischem oder geraden Boden, mit Bördel- oder graduiertem Rand. Bauchzange (Tiegelzange) Die Bauchzange (auch Tiegelzange) ist ein Werkzeug, das zum Fassen von Schmelztiegeln und ähnlich geformten Gegenständen benutzt wird. Die greifenden Teile an den Vorderenden sind halbkreisförmig geformt und gegeneinander gerichtet, so dass sie beim Schließen der Zange einen Kreis bilden. Mit der Bauchzange kann man Tiegel sicher umfassen und halten. Dreifuss Mineralfasernetz oder Asbestdrahtnetz Mit Hilfe des Dreifußes, im Zusammenhang mit dem Mineralfasernetz oder einer Ceranplatte, schafft man eine sichere Auflagefläche für Laborgeräte, die erwärmt werden sollen. Man schafft sich also eine Art Herdplatte, die an jeder Stelle etwa die gleiche Temperatur hat Reagenzglashalter (-klemme) Die Reagenzglasklemme wird benutzt, wenn man eine Chemikalie im Reagenzglas erhitzen will. Die Reagenzglasklemme wird am offenen Ende des Reagenzglases befestigt, damit das Holz der Brennerflamme nicht ausgeliefert ist. Tondreieck Einen Porzellantiegel benutzt man dann, wenn man einen Stoff auf sehr hohe Temperaturen erhitzen will. Damit die Brennerflamme direkt den Tiegel erhitzen kann, wird der Tiegel in ein Tondreieck gesteckt. Das Tondreieck wird (ohne Mineralfasernetz) auf den Dreifuss gelegt. Tiegelzange Mit Hilfe der Tiegelzange können heiße Porzellangeräte bewegt werden. Glasgeräte sollten mit der Tiegelzange nicht bewegt werden. Man kann die Tiegelzange auch dazu benutzen, etwas direkt in die Brennerflamme zu halten (z.B. Magnesiumband).