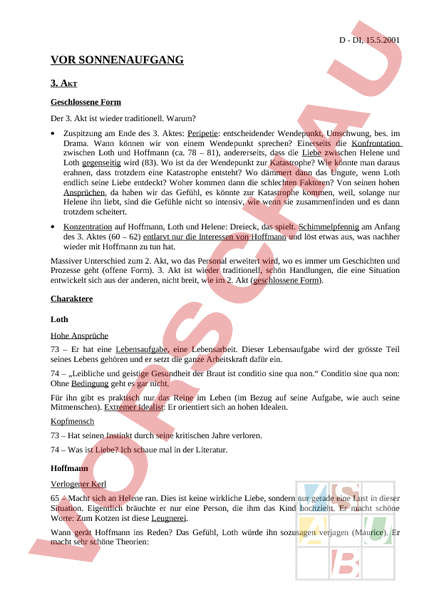Arbeitsblatt: Vor Sonnenaufgang von Gerhart Hauptmann
Material-Details
Zusammenfassung 3. Akt
Hintergrundinformationen und Analyse des Werks
Deutsch
Leseförderung / Literatur
11. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
48664
894
1
08.11.2009
Autor/in
Silvan Wirz
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
D DI, 15.5.2001 VOR SONNENAUFGANG 3. AKT Geschlossene Form Der 3. Akt ist wieder traditionell. Warum? • Zuspitzung am Ende des 3. Aktes: Peripetie: entscheidender Wendepunkt, Umschwung, bes. im Drama. Wann können wir von einem Wendepunkt sprechen? Einerseits die Konfrontation zwischen Loth und Hoffmann (ca. 78 – 81), andererseits, dass die Liebe zwischen Helene und Loth gegenseitig wird (83). Wo ist da der Wendepunkt zur Katastrophe? Wie könnte man daraus erahnen, dass trotzdem eine Katastrophe entsteht? Wo dämmert dann das Ungute, wenn Loth endlich seine Liebe entdeckt? Woher kommen dann die schlechten Faktoren? Von seinen hohen Ansprüchen, da haben wir das Gefühl, es könnte zur Katastrophe kommen, weil, solange nur Helene ihn liebt, sind die Gefühle nicht so intensiv, wie wenn sie zusammenfinden und es dann trotzdem scheitert. • Konzentration auf Hoffmann, Loth und Helene: Dreieck, das spielt. Schimmelpfennig am Anfang des 3. Aktes (60 – 62) entlarvt nur die Interessen von Hoffmann und löst etwas aus, was nachher wieder mit Hoffmann zu tun hat. Massiver Unterschied zum 2. Akt, wo das Personal erweitert wird, wo es immer um Geschichten und Prozesse geht (offene Form). 3. Akt ist wieder traditionell, schön Handlungen, die eine Situation entwickelt sich aus der anderen, nicht breit, wie im 2. Akt (geschlossene Form). Charaktere Loth Hohe Ansprüche 73 – Er hat eine Lebensaufgabe, eine Lebensarbeit. Dieser Lebensaufgabe wird der grösste Teil seines Lebens gehören und er setzt die ganze Arbeitskraft dafür ein. 74 – „Leibliche und geistige Gesundheit der Braut ist conditio sine qua non. Conditio sine qua non: Ohne Bedingung geht es gar nicht. Für ihn gibt es praktisch nur das Reine im Leben (im Bezug auf seine Aufgabe, wie auch seine Mitmenschen). Extremer Idealist: Er orientiert sich an hohen Idealen. Kopfmensch 73 – Hat seinen Instinkt durch seine kritischen Jahre verloren. 74 – Was ist Liebe? Ich schaue mal in der Literatur. Hoffmann Verlogener Kerl 65 – Macht sich an Helene ran. Dies ist keine wirkliche Liebe, sondern nur gerade eine Lust in dieser Situation. Eigentlich bräuchte er nur eine Person, die ihm das Kind hochzieht. Er macht schöne Worte: Zum Kotzen ist diese Leugnerei. Wann gerät Hoffmann ins Reden? Das Gefühl, Loth würde ihn sozusagen verjagen (Maurice). Er macht sehr schöne Theorien: 78/79 – Wiederholung des 1. Aktes: Schöne Phrasen. Als er merkt, dass Loth nicht abreist, wechselt er dann wieder und wird ehrlich und sagt: Volksverführer seit ihr! (81) und nennt Loth einen Tugendmeier (81), fordert ihn auf, besser zu arbeiten (82), tu was, komm zu was, dann kannst du mitreden. Schimmelpfennig Knallhart zu Hoffmann, bringt die Sachen auf den Punkt. Geht klug mit Hoffmann um und ist nicht käuflich in dieser Welt, in der eben alles durch Geld bestimmt wird. Beibsts Ankündigung, dass dieser Arzt eine besondere Person ist, hat sich bewahrheitet. Helene 66 – tritt Hoffmann mutig entgegen 67 – Steht zu ihrer Meinung und ist sehr schlagfertig, kann sich also präzis ausdrücken. „Man muss für das Verkehrte einen Sinn haben. Sie sagt nicht einfach: „Du bist verkehrt. Packt ihn beim Wort und dreht es um: „Wie viele Eltern mögen wohl alljährlich über die Leichen ihrer Kinder schreiten, ohne dass jemand. (68) Helene hat Format. Sie macht nur kurze Einwürfe, aber knallhart. Tagebuch Helene spontan • Helene bringt die Sache aufs Wort • Sie schwankt zwischen dem Gefühl endlich wegzukommen (auf einen Punkt hin zu kommen, sie formuliert, was sie genau will) und dem Bewusstsein, wo die schwächen der Beziehung liegen und der Hoffnung, das es dann doch geht. Gedankenvielfalt. • Sie möchte mit ihrer Gabe (Emotionalität) das Verstandesmässige Loths verändern. Thema: Beziehung eingehen in einer solchen Ausgangslage? Text: Bildung Unterricht zur Zeit Helenes an den Schulen: Keine naturwissenschaftlichen Fächer. Konsunat durfte sie besuchen als Tochter. Sie hatte dort Zeit, sich mit Literatur auseinanderzusetzen, mit Moral, Philosophie, etc., damit sei einfach eine bessere Partie ist, wenn sie dann endlich sich anbieten kann, also einen Mann findet, der mit ihr eine Familie gründet. • Helene möchte vielleicht wieder mehr mit Idealen, wie an der Schule, konfrontiert werden. • Angst: Loth ist meine Chance, hier wegzukommen. Frauen mussten, gemäss Text, warten, bis um sie angehalten worden ist und das ist ihre einzige Lebensperspektive. Sie kann gar nicht einfach weggehen, sie muss abgeholt werden. Sie ist zu diesem Leben verdammt im 19. Jahrhundert. Sie würde von der Gesellschaft gar nicht akzeptiert, wenn sie einfach weggeht. Sie wird wahrscheinlich diese Chance wahrnehmen, obwohl Loth noch ein wenig verändert (wenn möglich) werden müsste. Wir können den Text ganz aktuell lesen. Es gibt auch heute Männer und Frauen, die sich unter besimmten Umständen begegnen Text: Frauen im 19. Jahrhundert Frau in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Sie konnte nicht ungehindert reisen, man käme sonst ins Gerede. Sie könnte auch nicht ins nächste Dorf gehen und dort Beziehungen knüpfen zu Frauen. Eine Frau, wie Helene, muss das Leben praktisch als öde empfinden, weil sie gar keine Aufgabe hat. Früher hatte die Frau die Aufgabe, den Haushalt zu führen und ertrank fast in dieser Aufgabe. Da Helene einer neureichen Familie angehört, ist sie von dieser Aufgabe entbunden (es gibt Dienstmädchen). Nichts tun und für nicht da sein Doppelte Passivität. Lieber einfacheres Leben. Text: Veränderung der Liebes- und Eheauffassung Heute Ehe aus Liebe. Bis Mitte des 18. Jahrhunderts Ehe war eine Vernunftsangelegenheit. Es ging darum, für die Tochter jemanden zu finden, der sie versorgt und unterhält. Für den Sohn: Er muss eine Frau finden, die ihm Söhne gebärt. Ob das Liebe/ Zuneigung war, oder nicht, das war überhaupt keine Frage. Die Eltern schlossen die Ehe für ihre Kinder. Vernunft, geschäftsmässig, sehr sachlich. 18. Jahrhundert „Liebe: Einen guten Menschen finden. Auswirkungen auf die Schule: Literatur wurde wichtig, Bildung wurde wichtig, damit eben auch die beiden Menschen gesprächsfähig werden (die Frauen mussten sich auch bilden lassen) und versuchen diesen Ansprüchen der Bildung, wie sie eben Goethe und Schiller von guten Menschen formulieren, auch zu erreichen (Begriffe: Neigung und Pflicht, etc.). Romantik ab 1900 Zwei, die sich lieben (verliebt, leidenschaftlich lieben, erotisch lieben, tiefe Gefühle füreinander; nicht einfach verehren, gutfinden). Das wurde allerdings rasch wieder zurückgedrängt. Eine solche Beziehung kann man nicht in einer Ehe leben. Liebe ist Ehe, da braucht es keinen Trauschein. Aber das ist eigentlich Liebe. Zusammensein ist nicht etwas Vernunftmässiges oder Idealistisches, sondern eben Gefühle. Trotzdem hat das unsere Vorstellung bis heute nachhaltig geprägt und das, was heute Soziologen fragen ist, ob so etwas überhaupt lebenslang möglich ist oder nicht.