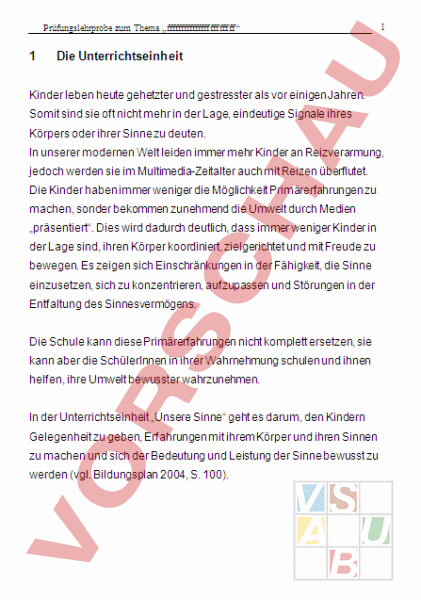Arbeitsblatt: Unsere 5 Sinne
Material-Details
Sachanalyse zu "Unsere 5 Sinne"
Diverses / Fächerübergreifend
Anderes Thema
2. Schuljahr
11 Seiten
Statistik
5138
2327
56
09.03.2007
Autor/in
Sandra Nowak
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Prüfungslehrprobe zum Thema „fffffffffffffffffffffff 1 1 Die Unterrichtseinheit Kinder leben heute gehetzter und gestresster als vor einigen Jahren. Somit sind sie oft nicht mehr in der Lage, eindeutige Signale ihres Körpers oder ihrer Sinne zu deuten. In unserer modernen Welt leiden immer mehr Kinder an Reizverarmung, jedoch werden sie im Multimedia-Zeitalter auch mit Reizen überflutet. Die Kinder haben immer weniger die Möglichkeit Primärerfahrungen zu machen, sonder bekommen zunehmend die Umwelt durch Medien „präsentiert. Dies wird dadurch deutlich, dass immer weniger Kinder in der Lage sind, ihren Körper koordiniert, zielgerichtet und mit Freude zu bewegen. Es zeigen sich Einschränkungen in der Fähigkeit, die Sinne einzusetzen, sich zu konzentrieren, aufzupassen und Störungen in der Entfaltung des Sinnesvermögens. Die Schule kann diese Primärerfahrungen nicht komplett ersetzen, sie kann aber die SchülerInnen in ihrer Wahrnehmung schulen und ihnen helfen, ihre Umwelt bewusster wahrzunehmen. In der Unterrichtseinheit „Unsere Sinne geht es darum, den Kindern Gelegenheit zu geben, Erfahrungen mit ihrem Körper und ihren Sinnen zu machen und sich der Bedeutung und Leistung der Sinne bewusst zu werden (vgl. Bildungsplan 2004, S. 100). Prüfungslehrprobe zum Thema „fffffffffffffffffffffff 1.1 Aufbau der Unterrichtseinheit • Einführungsstunde: Unsere 5 Sinne • Sehen • Hören • Tasten • Riechen • Schmecken • Abschlussparcour: Kennst du deine 5 Sinne? 2 RAHMENBEDINGUNGEN 2.1 BESCHREIBUNG DES SCHULORTES 2.2 BESCHREIBUNG DER SCHULE 2.3 BESCHREIBUNG DER KLASSE 2 Prüfungslehrprobe zum Thema „fffffffffffffffffffffff 3 3 SACHANALYSE 3.1 Unsere Sinne „Mit allen Sinnen will ein Kind die Welt in sich aufnehmen, es will die Dinge und Ereignisse sehen, hören, befühlen und anfassen, will sie schmecken und riechen, sich in und mit ihnen bewegen. Renate Zimmer Bevor sich ein Kind sprachlich mitteilen kann, gewinnt es bereits ein umfangreiches Wissen. Nur aufgrund seiner Erfahrungen durch Wahrnehmung und Bewegung kann es dieses Wissen erlangen. Wahrnehmen ist ein aktiver Prozess. Das Kind setzt sich mit allen Sinnen mit seiner Umwelt auseinander. Diese liefern dem Kind viele Informationen über seine Umwelt und vermitteln ihm die Erfahrung, selbst Teil dieser Welt zu sein (vgl. Renate Zimmer, S. 5, 2004). In der Gegenwart hat die sinnliche Wahnnehmung wieder an Bedeutung gewonnen. Die Schule solle ein Gegengewicht bilden zur Abstumpfung der Sinne in einer von Hör- und Sehreizen überfluteten Welt. Die Schüler sollen hier die Bedeutung und Leistung der Sinne erkennen und in ihrer Lebenswirklichkeit nutzen (vgl. Bildungsplan Grundschule 2004, S.100, 2004). Ein Sinnesorgan nimmt Informationen in Form von Reizen aus der Umwelt auf, indem es sie in elektrische Impulse umwandelt, die entlang von Nervenfasern weitergeleitet und dann vom Gehirn in Wahrnehmungen umgewandelt werden. Die eigentliche Umwandlung der eintreffenden Reize wird von den Rezeptoren des Sinnesorgans vollzogen. Der Rest des Sinnesorgans dient zur geeigneten Übertragung des Signals auf nachgeschaltete Nerven, die für die Weiterleitung zu den Prüfungslehrprobe zum Thema „fffffffffffffffffffffff 4 zentralen Verarbeitungsstellen im Gehirn sorgen (vgl. Man unterscheidet üblicherweise die fünf Sinneskanäle des Menschen: Gehörsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn, Gesichtssinn, und Tastsinn. Die moderne Physiologie kennt für den Menschen noch vier weitere Sinne, die Thermozeption (Temperatursinn), Nozizeption (Schmerzempfindung), den Gleichgewichtssinn und die Propriozeption (Körperempfindung oder Tiefensensibiliät) (vgl. 3.2 Sehen Das wichtigste Sinnesorgan des Menschen ist das Auge. Es ist für etwa 70% der Wahrnehmung verantwortlich. Die wichtigste Rolle beim Sehen spielt die im Inneren des Augapfels liegende Netzhaut. (vgl. Kunterbunt 2, S. 61, 2004). Hier treffen die Lichtstrahlen auf Millionen von Lichtsinneszellen, die die Strahlen zu Nervenmeldungen umwandeln und über den Sehnerv zum Gehirn geleitet werden. Die äußeren sichtbaren Teile des Auges haben vor allem Schutzfunktion. Die Augenbraue Regentropfen und Schweiß oder Staub zurück. Die Tränenflüssigkeit wird durch die Augenlider gleichmäßig verteilt. Mit den Wimpern schützen sie das Auge vor dem Eindringen von Fremdkörpern. Das Auginnere wird durch die weiße Lederhaut geschützt, die vorne in die durchsichtige Hornhaut übergeht. Die Iris (Regenbogenhaut) reguliert durch die Pupille (Blendöffnung in der Iris) den Lichteinfall und die Linse lenkt die Lichtstrahlen auf die Netzhaut (vgl. Pusteblume 2, S. 16, 2004). Prüfungslehrprobe zum Thema „fffffffffffffffffffffff 5 Abb.1 Auge, Pusteblume 2, S. 16 Abb.2 Das Auge, Pusteblume 2, S.17 3.3 Hören Das Ohr ist ein Sinnesorgan mit doppelter Funktion. Es ist neben der Hörfunktion verantwortlich für das Gleichgewichtsgefühl, das vom Innenohr vermittelt wird und hauptsächlich von den Bogengängen bestimmt wird. In diesen Bögen befinden sich Sinneszellen (Härchen), die von einer Gallertmasse umgeben sind. Werden Kopf oder Körper gedreht, bewegt sich die Flüssigkeit in den Bogengängen nicht gleich mit und reizt somit die Gleichgewichtssinneszellen (vgl. Kunterbunt 2, S.61, 2004). Beim Hören werden Schallwellen von der Ohrmuschel aufgefangen und gelangen durch den Hörgang zum Trommelfell, das aus einer dünnen Membran besteht. An ihm sitzt der Hammer, eines von drei Gehörknöchelchen. Über Ambross und Steigbügel werden die mechanischen Impulse zur Schnecke weitergeleitet. Dieses Organ enthält eine Flüssigkeit und eine große Zahl von Hörsinneszellen. Diese Prüfungslehrprobe zum Thema „fffffffffffffffffffffff 6 wandeln die mechanischen Reize in elektrische Signale um. Über den Hörnerv werden sie zum Gehirn geleitet, wo sie weiterverarbeitet werden (vgl. Pusteblume 2, S. 22, 2004). Abb. 3 Ohr, Pusteblume 2, S. 22 Abb. 4 Das Ohr, Pusteblume 2, S. 23 Von der Laufzeitdifferenz und der akustischen Differenz, mit der der Schall die Ohren erreicht, hängt das Raumhören ab. Als Laufzeitdifferenz bezeichnet man den Zeitunterschied, mit dem die Schallwellen auf die Ohren treffen. Bei der akustischen Differenz ist der Lautstärkenunterschied in den beiden Ohren gemeint, der sich ergibt, wenn sich bspw. ein Auto von links nähert und somit vom linken Ohr als lauter empfunden wird. Das Gehirn ermittelt aus diesen beiden Differenzen die Schallquelle. Das räumliche Hören ermöglicht es, sich in seiner Umwelt besser zurechtzufinden (vgl. Kunterbunt 2, S. 62, 2004). 3.4 Fühlen Prüfungslehrprobe zum Thema „fffffffffffffffffffffff 7 Die Haut ist eine Schutzhülle und Sinnesorgan. Sie ist das größte Organ des Körpers und umhüllt eine Fläche von bis zu zwei Quadratmetern und wiegt vier bis zwölf Kilogramm. Die Haut schützt den Organismus vor Krankheitserregern, Sonneneinstrahlung, Überhitzung und Austrocknung. Sie gibt uns die Fähigkeit, Wärme, Kälte, Druck, Berührung, Schmerz und Vibration wahrzunehmen. Für diese Empfindungen liegen die Rezeptoren in der so genannten Oberhaut und Lederhaut (vgl. Kunterbunt 2, S. 56, 2004). Die Tastkörper liegen in den Fingerspitzen besonders dicht zusammen und ermöglichen z.B. Blinden die Zeichen der Blindenschrift zu ertasten. Tast- und Fühlsinn sind die aktive (tasten) und passive (fühlen) Variante desselben Vorgangs (vgl. Pusteblume 2, S. 25, 2004). Wärmerezeptoren und Kälterezeptoren ermöglichen beispielsweise die Temperaturempfindung, indem sie die Temperatur an der Hautoberfläche registrieren und die Werte über das Rückenmark weiter zum Gehirn leiten. Über eine Erwärmung durch Umverteilung des Blutstroms beziehungsweise Abkühlung durch Schwitzen reguliert das Gehirn schließlich die Körpertemperatur. Das Gehirn kann aber auch Befehle an die Muskeln leiten und so z.B. das Zurückziehen der Hand bei Berührung einer heißen Herdplatte veranlassen (vgl. Kunterbunt 2, S. 55, 2004). 3.5 Schmecken Die Zunge fungiert als wichtiger Hilfsapparat für die Nahrungsaufnahme, als Tast- und Geschmacksorgan. Wir nehmen mit ihr die Geschmacksrichtungen süß, salzig, sauer und bitter wahr. Prüfungslehrprobe zum Thema „fffffffffffffffffffffff Auf dem Zungenrücken befinden sich vier Arten von Papillen mit insgesamt 9000 Geschmacksknospen, die den „Geschmack in elektrische Impulse umwandeln und ihn zum Gehirn weiterleiten. Von der Zungenspitze wird vornehmlich der Geschmack „süß wahrgenommen, von den Zungenrändern „salzig und „sauer und vom hinteren Teil der Zunge „bitter (vgl. Kunterbunt 2, S.58 ff, 2004). Abb. 5 Zunge, Pusteblume 2, S. 28 3.6 Riechen Die Nase ist ein Bestandteil des Atemweges und das Geruchssinnesorgan des Menschen. Durch die Aufnahme von Duftstoffen dient sie der Prüfung von Atemluft und Nahrung. Die Nasenflügel wechseln sich alle drei bis vier Stunden ab, sodass immer nur eins der beiden Nasenlöcher riecht und atmet, während das andere eine Ruhepause hat. Sie folgen dabei einem System der Arbeitsteilung. 8 Prüfungslehrprobe zum Thema „fffffffffffffffffffffff 9 Die Nase verfügt als Riechorgan über zahlreiche Sinneszellen, die vom Riechnerv ausgehen. An den Riechzellen sitzen Riechhärchen. Diese sind in der Lage, in der Luft gelöste Duftmoleküle, die mit der Atemluft in die Nase gelangen, aufzufangen. Dabei wird die Sinneszelle veranlasst, einen Nervenimpuls zu erzeugen. Die Geruchsreize werden über den so genannten Riechkolben an die verschiedenen Gehirnzentren übermittelt, in denen die Gerüche bewusst wahrgenommen werden und Empfindungen auslösen (vgl. Kunterbunt 2, S. 59, 2004). Abb. 6 Nase, Pusteblume 2, S. 28 Der Geschmacks- und Geruchssinn sind eng miteinander verbunden, da die Schmeck- und Riechempfindungen sich in der Wahrnehmung zu einer Einheit vereinigen. Wie auch der Geschmackssinn zählt auch der Geruchssinn zu den chemischen Sinnen, weil die Übertragung der Informationen an chemische Prozesse gebunden ist. Die Papillen auf der Zungenoberfläche und die Geruchszellen im Riechfeld reagieren auf Geschacks- und Aromastoffe. Es handelt sich hierbei um die Wahrnehmung gelöster Moleküle durch Sinnrezeptoren. De Geruchssinn ist 20000-mal stärker entwickelt als der Geschmackssinn. Die beiden Prüfungslehrprobe zum Thema „fffffffffffffffffffffff 10 Sinne stellen eine Schutzfunktion beim Atmen, Essen und Trinken dar und besteht darin, in einem begrenzten System auf riechbare Schadstoffe aufmerksam zu machen (vgl. Pustblume 2, S. 25, 2004). 4 INTENSIONEN 4.1 BEZUG ZUM BILDUNGSPLAN „Der Unterricht im Fächerverbund () MeNuk () zielt auf die forschende Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lebenswirklichkeit. Bewusst wird der Unterricht zunehmend anwendungs- und problemorientiert, explorativ, aktiv entdeckend und kreativ, themen- und projektorientiert gestaltet. Ausgehend von Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Anteilnahmen und Betroffenheit sind Empfindungen und Erfahrungen Voraussetzung für Weltbegegnung, Welterkundung und Weltaneignung. Die Schülerinnen und Schüler eignen sich Orientierungswissen an und werden befähigt, das im Verlauf der Grundschulzeit erworbene Wissen in außerschulischen Situationen zu nutzen. Voraussetzung hierfür ist die Entwicklung der eigenen Urteilsfähigkeit (Bildungsplan Grundschule 2004, S. 98). „Sinnliche Wahrnehmung ist Grundlage für Erfahrungen und Erkenntnisse und bildet die Basis für kreative Lernprozesse. Der vielseitige Gebrauch der Sinne, Umgang mit unterschiedlichen Materialien und vielfältige Praktische Übungen schaffen die Grundlage, () sich auszudrücken. () Ästhetische Wahrnehmungsprozesse Prüfungslehrprobe zum Thema „fffffffffffffffffffffff 11 sprechen Sinne und Verstand an der Schülerinnen und Schüler in ihrer Ganzheit an und ermöglichen es ihnen, das Ästhetische als Teil ihrer Persönlichkeit zu entfalten (Bildungsplan Grundschule 2004, S.97). Der Bildungsplan 2004 fordert im Bereich „Menschliches Leben im ersten Kompetenzfeld „ Wer bin ich – Was kann ich: Kinder entwickeln und verändern sich, stellen sich dar, dass die SchülerInnen „die Bedeutung und die Leistung der Sinne erkennen und in ihrer Lebenswirklichkeit nutzen können. Hierzu wird auf Wahrnehmungsübungen, Hörspiele mit Tönen, Klängen und Geräuschen als Inhalte verwiesen (vgl. Bildungsplan 2004, S. 100).