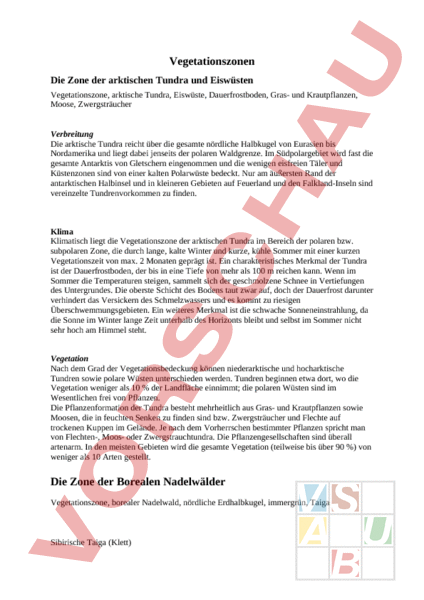Arbeitsblatt: Vegetationszonen der Erde
Material-Details
Überblick über die Vegetationszonen der Erde (Lesetext + Bilder)
Geographie
Gemischte Themen
9. Schuljahr
12 Seiten
Statistik
53474
1452
10
26.01.2010
Autor/in
Martin Hähner
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Vegetationszonen Die Zone der arktischen Tundra und Eiswüsten Vegetationszone, arktische Tundra, Eiswüste, Dauerfrostboden, Gras- und Krautpflanzen, Moose, Zwergsträucher Verbreitung Die arktische Tundra reicht über die gesamte nördliche Halbkugel von Eurasien bis Nordamerika und liegt dabei jenseits der polaren Waldgrenze. Im Südpolargebiet wird fast die gesamte Antarktis von Gletschern eingenommen und die wenigen eisfreien Täler und Küstenzonen sind von einer kalten Polarwüste bedeckt. Nur am äußersten Rand der antarktischen Halbinsel und in kleineren Gebieten auf Feuerland und den Falkland-Inseln sind vereinzelte Tundrenvorkommen zu finden. Klima Klimatisch liegt die Vegetationszone der arktischen Tundra im Bereich der polaren bzw. subpolaren Zone, die durch lange, kalte Winter und kurze, kühle Sommer mit einer kurzen Vegetationszeit von max. 2 Monaten geprägt ist. Ein charakteristisches Merkmal der Tundra ist der Dauerfrostboden, der bis in eine Tiefe von mehr als 100 reichen kann. Wenn im Sommer die Temperaturen steigen, sammelt sich der geschmolzene Schnee in Vertiefungen des Untergrundes. Die oberste Schicht des Bodens taut zwar auf, doch der Dauerfrost darunter verhindert das Versickern des Schmelzwassers und es kommt zu riesigen Überschwemmungsgebieten. Ein weiteres Merkmal ist die schwache Sonneneinstrahlung, da die Sonne im Winter lange Zeit unterhalb des Horizonts bleibt und selbst im Sommer nicht sehr hoch am Himmel steht. Vegetation Nach dem Grad der Vegetationsbedeckung können niederarktische und hocharktische Tundren sowie polare Wüsten unterschieden werden. Tundren beginnen etwa dort, wo die Vegetation weniger als 10 der Landfläche einnimmt; die polaren Wüsten sind im Wesentlichen frei von Pflanzen. Die Pflanzenformation der Tundra besteht mehrheitlich aus Gras- und Krautpflanzen sowie Moosen, die in feuchten Senken zu finden sind bzw. Zwergsträucher und Flechte auf trockenen Kuppen im Gelände. Je nach dem Vorherrschen bestimmter Pflanzen spricht man von Flechten-, Moos- oder Zwergstrauchtundra. Die Pflanzengesellschaften sind überall artenarm. In den meisten Gebieten wird die gesamte Vegetation (teilweise bis über 90 %) von weniger als 10 Arten gestellt. Die Zone der Borealen Nadelwälder Vegetationszone, borealer Nadelwald, nördliche Erdhalbkugel, immergrün, Taiga Sibirische Taiga (Klett) Verbreitung Die Zone der Borealen Nadelwälder (boreal nördlich) erstreckt sich in einem breiten Band rund um die nördliche Halbkugel und liegt im Bereich der subpolaren Breiten. Dabei umspannen in Eurasien die immergrünen Nadelwälder den gesamten Kontinent vom fernen Osten Russlands bis nach Skandinavien. Die westlicher gelegenen Wälder sind eher artenarm, doch nimmt die Artenzahl zu, je weiter man nach Osten vordringt. Die borealen Wälder von Nordamerika werden von zahlreicheren Baumarten gebildet als die in Eurasien. Wegen der Nord-Süd-Ausrichtung der Nordamerikanischen Gebirgsketten erstrecken sich die Nadelwälder entlang der Bergrücken des amerikanischen Kontinents bis weit in die gemäßigte Zone hinein. Die südlichsten Vorkommen der immergrünen Nadelwälder liegen an den Ostseiten der Kontinente, auf den Westseiten ist die Verbreitungsgrenze infolge warmer Meeresströmungen wesentlich weiter nach Norden verschoben. Dabei ist die Vegetationszone des Borealen Nadelwaldes nur auf der Nordhalbkugel ausgebildet. Auf den entsprechenden Breitengraden der Südhalbkugel kann sich mangels Landmasse nicht das für diese Vegetationsformation charakteristische winterkalte Kontinentalklima einstellen. Klima Innerhalb dieser Vegetationszone ist das Klima durch lange, schneereiche Winter (im Inneren der Kontinente teilweise bis -70 C) und kurze, meist kühle Sommer gekennzeichnet. Die Temperaturen steigen allenfalls vier Monate über 10 C; die kalte Jahreszeit dauert sechs und mehr Monate. Die Vegetationsperiode ist dementsprechend kurz, unter ungünstigen Bedingungen beträgt die Wachstumszeit nicht mehr als ein bis zwei Monate. Die Mittel der jährlichen Niederschlagssummen bewegen sich in den meisten Gegenden von 250 500 mm, wobei die Schneeanteile etwas geringer sind als die Regenanteile. In weiten Bereichen ist auch in dieser Zone der Boden noch durch Dauerfrost beeinflusst und taut nur während der wärmeren Jahreszeit oberflächlich auf. Auch hier bilden sich große Überschwemmungsflächen, da die sommerlichen Schmelzwässer nicht in den Boden eindringen können. Vegetation Im Vergleich mit den Wäldern südlicherer Breitengrade sind die Borealen Wälder, die nach deren russischen Namen auch Taiga genannt werden, in Struktur und Vegetation sehr einheitlich. Die Pflanzenformation besteht aus Fichten, Kiefern, Lärchen, Tannen und Birken, ist aber sonst eher artenarm. Den spärlichen Unterwuchs bilden vor allem Zwergsträucher sowie Flechten und Moose. Die zum Teil geschlossenen Wälder werden polwärts immer lichter und sind außerdem von vielen Sümpfen und Mooren durchsetzt. Meist stehen Bäume desselben Alters dicht beieinander. Sie zeigen einen schmalen, spitzen Wuchs, der das Abrutschen der winterlichen Schneemassen erleichtert. Aufgrund des Dauerfrostbodens sind, bei einer Auftautiefe von einem halben bis einen Meter im Sommer, Fichten und Lärchen (als Flachwurzler) die bevorzugte Vegetation. Die Zone der sommergrünen Laub- und Mischwälder Vegetationszone, Laub- und Mischwälder, sommergrün, Nadelhölzer, Laubfall, lange Vegetationszeit, Trockenperioden, artenreiche Krautschicht Europäischer Laubmischwald (Klett) Verbreitung Das Verbreitungsgebiet der sommergrünen Laubwälder beschränkt sich fast ausschließlich auf die nördliche Halbkugel, wobei sich drei Hauptverbreitungsgebiete unterscheiden lassen. In Europa erstreckt sich die Zone der Laub- und Mischwälder von den Britischen Inseln über Frankreich, Mittel- und Osteuropa bis zum Ural. Im Fernen Osten sind sommergrüne Laubwälder im Nordosten Chinas, in Korea und in Japan zu finden. In Nordamerika erstrecken sich die sommergrünen Laubwälder südlich der Großen Seen in östliche Richtung bis zum Atlantischen Ozean sowie bis zum Golf von Mexiko. Zudem gibt es noch drei weitere kleinere Vorkommen auf der Südhalbkugel (Mittel-Chile, Tasmanien und Gebiete auf der Südinsel Neuseelands). Klima Klimatisch ist diese Vegetationszone durch eine relativ lange Vegetationszeit (mind. halbjährlich, unter ozeanischen Bedingungen bis zu gangjährlich) ohne ausgeprägte Trockenperioden und eine mäßig kalte, 3 4 Monate dauernde Winterzeit gekennzeichnet. Der Witterungsablauf ist hochgradig unbeständig und bestimmt durch Niederschläge und Wetterluftmassen mit den unterschiedlichsten Eigenschaften. Die jährliche Niederschlagssumme liegt bei 500 1.000 mm und fällt gleichmäßig über das Jahr verteilt; zum Teil auch mit Schneefällen, doch liegt keine lang anhaltende Schneedecke. Vegetation Die Pflanzenformation der sommergrünen Laub- und Mischwälder besteht vorwiegend aus Buchen- bzw. Eichenwäldern, die in Kombination mit Sträuchern und einer artenreichen Krautschicht auftreten. In höheren und kühleren Lagen treten an die Stelle der Laubbäume die immergrünen Nadelhölzer, besonders Fichten und Kiefern. Mit ihren an Trockenheit angepassten Nadeln erlangen diese vor allem im Winter eine höhere Kälteresistenz und sind bei Eintritt der warmen Witterung im Frühjahr wieder schneller produktionsfähig als die Laubvegetation; die kürzere Vegetationszeit wird dadurch besser ausgenutzt. Während Laubbäume eine Dauer der Vegetationszeit mit Tagesmitteln über 10 C von mindestens 120 Tagen verlangen, kommen Nadelbäume bereits mit 30 Tagen aus. Das charakteristischste Merkmal der sommergrünen Laub- und Mischwälder ist der herbstliche Laubfall. Er dient hauptsächlich dem Schutz vor Austrocknung der gesamten Pflanze in der kalten Jahreszeit. Voraussetzung ist allerdings, dass die im Frühjahr neu gebildeten Blätter eine genügend lange und warme Vegetationszeit von mindestens vier Monaten zur Verfügung haben. So können das Wachstum und das Ausreifen der Pflanzenorgane und die Anlage von Stoffreserven für das Fruchten und für den Austrieb im nächsten Jahr gewährleistet werden. Die heutigen europäischen Laub- und Mischwälder entsprechen nur in Ausnahmen dem Urzustand, in der Regel sind die Waldgebiete zu Wirtschaftswäldern umgewandelt worden. In Europa kommt echter Urwald nur noch in vereinzelten und speziell geschützten Gebieten vor, z.B. im Neuenburger Urwald zwischen Aurich und Wilhelmshaven in Ostfriesland. Die Zone der immergrünen Hartlaubgewächse Vegetationszone, Hartlaubgewächs, immergrün, mediterraner Klimatyp, Hartblättrigkeit, ätherische Öle Mittelmeervegetation Hartlaubgewächse (Klett) Verbreitung Die Vegetationszone der immergrünen Hartlaubgewächse hat sich in fünf voneinander isolierten Regionen mit mediterranem Klimatyp entwickelt, die besonders küstennah an den Westseiten der Kontinente liegen und von denen die bekannteste die Mittelmeerregion ist. Weitere Gebiete liegen in Kalifornien, Zentral-Chile, am Kap der Guten Hoffnung in Südafrika und in Südwest-Australien. Klima Um die charakteristische Vegetation hervorzubringen, benötigten die Pflanzen einen milden, feuchten Winter und warme, trockene Sommer. Das auffälligste klimatische Kennzeichen ist die Konzentration der Niederschläge auf die kühle Jahreszeit, die zugleich die Vegetationsperiode ist. Mindestens vier Sommermonate haben Temperaturmittel über 18 C und kein Wintermonat liegt unter 5 C, jedoch kann es zu gelegentlichen Frösten kommen. Die auffälligen jahreszeitlichen Gegensätze im Witterungsablauf erklären sich aus der Verschiebung der unterschiedlichen Luftdruckbereiche innerhalb der atmosphärischen Zirkulation. Vegetation Zur typischen Pflanzenformation der immergrünen Hartlaubgewächszone gehören Korkeiche, Kiefer, Ölbaum und zahlreiche Kräuter wie Rosmarin, Thymian und Lavendel. Die sommerliche Dürre, der Nährstoffmangel in den Böden und die hohe Waldbrandgefahr haben bei vielen dieser Pflanzenarten Anpassungsmechanismen erzwungen, um überleben zu können. Dies sind z. B. die Hartblättrigkeit (Sklerophyllie) – die der Formation ihren Namen gegeben hat. Die Pflanzen haben meist kleine, feste immergrüne und saftarme Blätter, die auch manchmal nadelförmig verformt oder mit einer Wachsschicht überzogen oder teilweise behaart sind. Die Blätter können bei Wassermangel ihre Poren verschließen, um die Wasserverdunstung zu verhindern. Eine andere Anpassungsform ist die der Einlagerung von ätherischen Ölen (bes. bei Kräutern), auch um den Verdunstungsgrad zu verringern. Der Schutz vor den auftretenden Waldbränden zeigt sich z. B. in Form von einer relativen Resistenz gegen Hitze (dicke Borke, Knospenschutz) oder einer hohen Regenerationsfähigkeit der Pflanzen. Im Verlauf der letzten Jahrtausende wurde die ursprüngliche Vegetation in fast allen Gebieten dieser Vegetationszone durch den Einfluss des Menschen stark verändert. Wo die Pflanzen nicht durch Weinberge und Olivenhaine ersetzt worden sind, ist ein niedriges, dichtes Buschwerk, die Macchie, die vorherrschende Vegetationsform am Mittelmeer. Die Macchien wiederum sind vielerorts zur niedrigen Strauchheide, der Garigue, degradiert. Zu beiden Vegetationsgesellschaften gehören viele Pflanzenarten, die reich an aromatischen Ölen sind. Die den Macchien ähnlichen Waldgebiete der am Kap der Guten Hoffnung in Südafrika beheimateten Formation zeichnen sich durch eine außergewöhnlich große Artenzahl aus, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden ist (Endemiten). Im Südwesten Australiens dominieren Eukalyptusbäume und Proteasträucher die Jarra- und Karriwälder, die sich dort in den Winterregengebieten entwickelt haben. In Chile liegt südlich der Wüstengebiete immergrünes Buschland, das Matorral genannt wird. In Mittel- und Südkalifornien sind die Hügel an der Küste von einer Hartlaubvegetation bedeckt, die das Chaparral bildet. Die Zone der subtropischen Feucht- und Lorbeerwälder Vegetationszone, Suptropen, Feuchtwälder, Lorbeerwälder, Regenwald, Niederschlag, Passat Verbreitung Die Verbreitung der Vegetationszone der subtropischen Feucht- und Lorbeerwälder ist sehr fragmentarisch. Die einzelnen Vorkommen verteilen sich auf die Ostseiten der Kontinente in den warmgemäßigten immerfeuchten Subtropen, wo die Regenfälle das gesamte Jahr über andauern und der Sommer sehr heiß ist. Die Gebiete liegen im Südosten der USA (von North Carolina bis Texas), an der Ostküste Südamerikas (von Süd-Brasilien über Uruguay bis Argentinien), im östlichen Südafrika, an der Südostküste Australiens und weiter nördlich in Ostasien (China, Südkorea und Japan). Klima Die Niederschläge fallen über das Jahr verteilt, mit Maxima in den Sommermonaten. Die winterlichen Niederschläge können in den küstenferneren Gebieten so weit abfallen, dass das Pflanzenwachstum mehr oder weniger stark eingeschränkt wird. Mindestens vier Sommermonate haben Mitteltemperaturen über 18 C. Im kältesten Wintermonat bleiben die Mitteltemperaturen gewöhnlich über 5 C. Leichte Fröste treten allerdings regelmäßig auf. Die seltenen Fröste bis etwa -10 C stellen ein erhebliches Risiko für manche Dauerkulturen, wie z. B. Zitrusplantagen, dar. Ein weiteres Handicap bilden Hurrikans bzw. Taifune, die mit hohen Windgeschwindigkeiten und Starkregen in Küstennähe nicht selten beträchtliche Bodenabträge, Überschwemmungen und Sturmschäden bewirken. Vegetation In den mittleren Breiten führen die dort vorherrschenden Westwinde feuchte Luftmassen an die Westküsten der Kontinente, was dort starke Regenfälle zur Folge hat. Auf ähnliche Weise sorgt der Passat an den subtropischen Ostküsten für Regen. Das Zusammenwirken der hohen Niederschlagsmengen und der vergleichsweise milden Temperaturen förderte das Entstehen dichter Wälder, in denen immergrüne Arten, sowohl Laub- als auch Nadelbäume, dominieren. Die natürliche Vegetation besteht in den regenreichsten Gebieten aus üppigen, mehrschichtigen Regenwäldern, sonst aus halbimmergrünen Feuchtwäldern oder Lorbeerwäldern, seltener auch aus Hochgrasfluren. Die häufigsten Pflanzenarten sind Lorbeer, Bambus, Baumfarne, Palmen, regional Koniferen und Gräser. Die Zone der winterkalten Steppen und Wüsten Vegetationszone, winterkalte Steppe, Wüste, Prärie, Pampa, Brände, trockenliebende Gräser, krautige Pflanzen, hochwüchsige Stauden, Zwiebelgewächse Winterkalte Steppe Eurasiens (Klett) Verbreitung Die weiten geschlossenen Steppengebiete im Bereich der gemäßigten Breiten auf der Nordhalbkugel kommen sowohl in Eurasien (vom Schwarzen Meer bis nach Nordost-China) als auch in den Great Plains Nordamerikas (hier wird die Vegetationseinheit als Prärie bezeichnet) vor. Auf der Südhalbkugel nimmt die gemäßigte Klimazone einen weit geringeren Flächenanteil ein, als auf der nördlichen Seite. Deshalb kommen in dieser Zone, mit Ausnahme der Pampas Argentiniens und Uruguays, auch keine größeren Grasflächen vor. Klima Die Vegetationszone ist klimatisch durch eine lange Sommertrockenheit und tiefe Winterkälte geprägt. Der Jahresniederschlag, der hier zwischen 200 400 mm liegt, reicht nicht aus, um einen geschlossenen, von Bäumen dominierten Vegetationstyp entstehen zu lassen. Die Niederschläge fallen unregelmäßig über das Jahr verteilt und nicht selten treten monatelange Dürreperioden auf. Die Vegetationsperiode beschränkt sich auf den Frühsommer. Vegetation Die typische baumlose Pflanzenformation der Steppe setzt sich überwiegend aus trockenliebenden Gräsern und krautigen Pflanzen zusammen; kennzeichnend sind zudem auch hochwüchsige Stauden und Zwiebelgewächse. Im Maße abnehmender Niederschläge kommen verschiedene Steppentypen wie Wald-, Grasund Wüstensteppe vor. Aufgrund der klimatischen Verhältnisse sind die Wachstumsbedingungen für Gräser optimal, es bildet sich eine mehr oder weniger geschlossene 0,1 1 hohe Vegetationsdecke aus. Neben dem Klima spielt der Faktor Feuer auch eine entscheidende Bedeutung für die Ausbildung von Grasland. Das Wachstum von Gras setzt unmittelbar nach Bränden oder nach dem Abmähen erneut ein, während Holzgewächse in der Regel durch Brände oder Kahlschläge vollständig absterben. Zudem verhindert Feuer die Streuanhäufung, durch die der Graswuchs behindert wird. Die Zone der Wüsten und Halbwüsten Vegetationszone, Wüste, Halbwüste, Savanne, Subtropen, kalte Meeresströmungen, Wassermangel, Tag- und Nachtklima, kleine Blätter, Wachsschicht Tropische Wüste (Klett) Verbreitung Die Vegetationszone der subtropischen Wüsten und Halbwüsten bedeckt weite Gebiete in Nord-Afrika (Sahara) und Vorderasien, Südwest-Afrika (Namib, Kalahari), ZentralAustralien und an der Westküste Chiles (Atacama) sowie das Übergangsgebiet zwischen Mexiko und der USA. Dabei sind die Übergänge von Wüste, Halbwüste zur Savannen oder savannenähnlicher Vegetation fließend; entscheidend ist die Länge und Intensität der Trockenperioden. Die meisten der subtropischen Küstenwüsten sind auf kalte Meeresströmungen zurückzuführen, z. B. ist die Atacamawüste an der Pazifikküste von Chile und Peru durch den Humboldtstrom beeinflusst und die Namibwüste durch den Benguelastrom vor der Westküste Afrikas. Durch die kalten Meeresströmungen kommt es kaum zu Wolkenbildungen über dem Wasser und dies ist auch der Grund, weshalb an dieser subtropischen Küste nur selten Regen fällt. Klima Für das Klima im Bereich der subtropischen Wüsten und Halbwüsten ist ein extremes Temperaturgefälle zwischen Tag und Nacht und ein damit verbundener tagesrhythmischer Wechsel des Luftfeuchtigkeitsgehalts typisch; dabei ist der Winter nur ein wenig kühler als der sehr heiße Sommer. Ausgeprägte atmosphärische Hochdruckgebiete halten heiße, trockene Luftmassen über jene Regionen der Erde, die nördlich und südlich an die Tropen angrenzen. In diesen Landstrichen kommt es nur ganz selten zu Niederschlägen, der dann mit jjährlichen Mengen zwischen 50 250 mm fällt. Vegetation In den subtropischen Wüsten und Halbwüsten liegen die Deckungsgrade der Dauervegetation unter 50 %. Die Verteilung der Pflanzen ist entweder diffus (Halbwüsten) oder kontrahiert (Wüsten). Wenn es sich um feine Böden mit hohem Wasserhaltevermögen handelt, dominieren Gräser. Die tiefgründiger wurzelnden Gehölzpflanzen sind demgegenüber auf gröberen Böden überlegen, wo die Wassergehalte niedriger bleiben und sich höhere Anteile des Bodenwassers in größerer Tiefe befinden. In den Halbwüsten besteht der Pflanzenwuchs hauptsächlich aus harten Büschelgräsern und Sträuchern, die spezielle Anpassungsmechanismen zur Wasserspeicherung ausgebildet haben. So speichert eine wichtige Gruppe der Wüstenpflanzen (z. B. Aloe, Agave, Wolfsmilch, Kakteen und andere Sukkulenten) das Wasser im Gewebe der Stämme, Blätter oder Wurzeln. Andere Anpassungsformen an die extremen Klimabedingungen sind sehr kleine Blätter, die nur während der kurzen Regenzeit erscheinen oder Blätter, die von einer dicken Wachsschicht umgeben oder dicht behaart sind. Manche Pflanzen haben auch ihre Sprossachse stark verkürzt, so dass die Transportwege für Wasser und Nährstoffe verkürzt werden. In Wüsten fehlt eine Vegetation fast vollständig, was durch den extremen Wassermangel und die intensive Sonneneinstrahlung bedingt ist. Wenn es doch zu Regenfällen kommt erwacht die Wüste zum Leben und es sprießen überall die bis dahin im Boden ruhenden Samen, doch lokale Salzanreicherungen schränken das Artenspektrum stark ein. Die Zone der Savannen und Trockenwälder Vegetationszone, Savanne, Trockenwald, Halbwüsten, Monsunwälder, saisonale Niederschlagsverteilung, Dorn-, Trocken- und Feuchtsavanne Dornenstrauchsavanne (Klett) Verbreitung Die Vegetationszone der Savannen und Trockenwälder erstreckt sich in Afrika sowohl nördlich als auch südlich der tropischen Regenwälder. Mit steigender Trockenheit gehen sie in Halbwüsten über. In Asien bedecken Monsunwälder große Teile von Indien und Südostasien. Auch im Norden von Australien gibt es derartige Waldländer und Savannen. Auf der Südhalbkugel erstrecken sich Trockenwälder entlang der Pazifikküste von Mexiko und Zentralamerika sowie über einen großen Teil von Kuba, der Halbinsel Yucatán und den Westen von Ecuador. Auch über große Teile des Kernlands von Brasilien, Argentinien, Bolivien und Paraguay befinden sich savannenartige Baumformationen. Klima Charakteristisch für die sommerfeuchten Tropen ist die ausgeprägte Saisonalität der Niederschlagsverteilung. In den meisten Fällen gibt es eine sommerliche Regenzeit und eine winterliche Trockenzeit. Die feuchte Zeitspanne ist für die Pflanzen größtenteils identisch mit der Vegetationsperiode. Vegetation Gewöhnlich wird die Savannenzone nach den Merkmalen Dauer und Ergiebigkeit der Regenperiode, die im Jahresmittel zu erwarten sind, unterteilt: Dornsavanne (2 bis 4 Regenmonate, mit etwa 400 600 mm Niederschlag), Trockensavannen (5 bis 7 Regenmonate, mit etwa 500 1.000 mm Niederschlag) und Feuchtsavanne (7 bis 9 Regenmonate, mit 1.000 1.500 mm Niederschlag). Diese Dreiteilung drückt sich auch in einer Differenzierung von Vegetation, Böden und Landnutzung aus. So ist z. B. der Graswuchs in den Trockensavannen (auch Kurzgrasflure genannt, mit Grashöhen 0,5 1,5 m) deutlich niedriger als in den Feuchtsavannen (die auch als Langgrasflure bezeichnet werden, mit Grashöhen von 2 3 m). Dabei zeichnet sich die Vegetationsformation der Savannen durch eine ausgedehnte homogene Grasfläche mit verstreut darin stehenden Bäumen und Sträuchern aus. Die Übergänge von lichten Wäldern (Savannenwäldern; hier dominieren die Bäume) zu Savannen und baumfreien Graslandschaften (Grasland, Steppe) sind fließend. Die Bäume der Savannen zeichnen sich durch drei auffallende Eigenschaften aus: Sie haben oft eine schirmförmige Krone, sind weitgehend feuerfest (Brände ausgelöst durch Blitzschlag, in neuerer Zeit auch durch menschliche Einwirkungen, sind keine Seltenheit), und haben tiefgehende, bis zum Grundwasser reichende Wurzeln, die bis zu einer Tiefe von 40 Metern reichen können. An einigen Stellen werden die Bäume zu schmalen Streifen entlang von ausgetrockneten Flussbetten zurückgedrängt, man spricht hier von Galeriewäldern. Natürliche Savannen kommen nur bei Jahresniederschlägen unter 600 mm vor; sekundäre Savannen entstehen durch trockenzeitliche Busch- und Grasbrände, die oft vom Menschen verursacht werden. Die so entstandenen Schäden beeinflussen die Savannen-Ökosysteme in vielfältiger und nachhaltiger Weise. Es entsteht ein Vegetationsmosaik aus verschieden alten Degenerationsstadien (mit unterschiedlichen Vegetationsstrukturen und Artenzusammensetzungen). Die Zone der Tropischen Regenwälder Vegetationszone, Tropischer Regenwald, immerfeuchte Tropen und Subtropen, Äquatornähe, artenreichste Vegetationseinheit, immergrün Tropischer Regenwald (Klett) Verbreitung Die Vegetationszone der Tropischen Regenwälder ist vorwiegend in den immerfeuchten Tropen und Subtropen in Äquatornähe verbreitet. Es gibt drei große tropische Regenwaldgebiete, eines im mittleren und westlichen Afrika (Kongobecken), eines in Südamerika (Amazonasbecken, mit dem größten zusammenhängenden Regenwaldgebiet der Erde) und ein weites Gebiet in Südostasien (Indien, Malaysia, Indonesien). Aber auch außeräquatorial gibt es kleinere Vorkommen des tropischen Regenwaldes, die in Australien, Ozeanien und Mittelamerika liegen. Klima In den hochtropischen Regionen gibt es ein ganzjährig gleich bleibendes Klima, es lassen sich keine Jahreszeiten unterscheiden – Temperatur, Niederschlag und Tageslänge sind kaum oder nur geringen Schwankungen unterworfen. Die Tropischen Regenwälder entwickeln sich nur in einem ganzjährig nahezu einförmigen Klima mit Temperaturen von über 24 C. Über das ganze Jahr verteilt sich eine Regenmenge von mindestens 1.500 mm (vielfach werden Werte von 2.000 4.300 mm registriert, die meist zwei Spitzen aufweisen) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von mehr als 75 bis 80 %. Etwa ein Drittel des Niederschlagswassers bleibt im mehrschichtigen Blätterdach der Bäume sowie ddes Untergehölzes hängen und verdunstet von dort unmittelbar. Vegetation Der Tropische Regenwald ist die artenreichste Vegetationseinheit der Erde (z. T. mehr als 100 Baumarten pro Hektar) und die charakteristische Pflanzenformation der immerfeuchten Tropen. Die Folge der Wachstumsbedingungen ist ein üppiges Vegetationswachstum. Die Bäume sind immergrün und haben häufig kräftige Blätter als Schutz vor den starken Niederschlägen. Der Laubwechsel verteilt sich über das ganze Jahr, ebenso die Blüte und die Fruchtreife. Das Holz zeigt keine Jahresringe, da ganzjährig ein gleichmäßiges Dickenwachstum möglich ist. Gekennzeichnet ist der Tropische Regenwald durch drei (selten durch fünf) Baumstockwerke: das obere besteht aus 50 60 hohen Baumriesen, dabei wird die Standfestigkeit durch kräftige Brettwurzeln erhöht; das mittlere aus 30 40 hohen Bäumen, die ein geschlossenes Kronendach bilden; das untere erreicht 15 Höhe und besteht meist aus Jungpflanzen. Durch den Lichtmangel in der Bodenregion fehlt eine Krautschicht fast vollständig. Der Wald ist reich an Lianen, die sich zum Licht hinaufranken und deren Stämme bis zu 20 cm Dicke haben können; Baumgräser machen den Regenwald oft undurchdringlich. Aufgrund der hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit werden diese organischen Substanzen schnell abgebaut und stehen dem Boden als Nährstoff zur Verfügung. Diese schnelle Wiederaufnahme und Rückführung von Nährstoffen in die Vegetation ist der Grund dafür, dass der Regenwaldboden verhältnismäßig nährstoffarm ist.