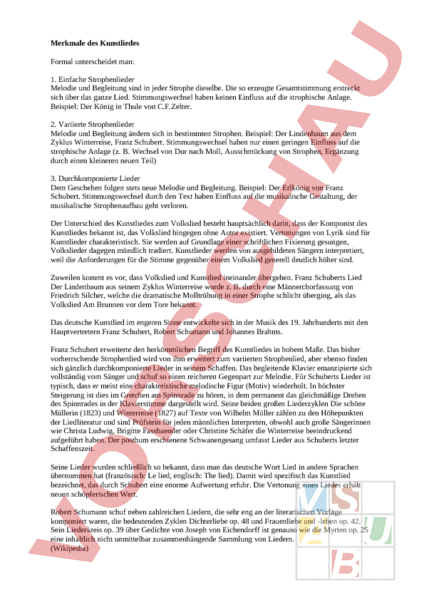Arbeitsblatt: Kunstlied - Merkmale
Material-Details
Informationstext zu Entstehung und Aufbau des Kunstliedes
Musik
Musikgschichte
12. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
57157
4827
24
18.03.2010
Autor/in
Marco Schlawitz
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Merkmale des Kunstliedes Formal unterscheidet man: 1. Einfache Strophenlieder Melodie und Begleitung sind in jeder Strophe dieselbe. Die so erzeugte Gesamtstimmung erstreckt sich über das ganze Lied. Stimmungswechsel haben keinen Einfluss auf die strophische Anlage. Beispiel: Der König in Thule von C.F.Zelter. 2. Variierte Strophenlieder Melodie und Begleitung ändern sich in bestimmten Strophen. Beispiel: Der Lindenbaum aus dem Zyklus Winterreise, Franz Schubert. Stimmungswechsel haben nur einen geringen Einfluss auf die strophische Anlage (z. B. Wechsel von Dur nach Moll, Ausschmückung von Strophen, Ergänzung durch einen kleineren neuen Teil) 3. Durchkomponierte Lieder Dem Geschehen folgen stets neue Melodie und Begleitung. Beispiel: Der Erlkönig von Franz Schubert. Stimmungswechsel durch den Text haben Einfluss auf die musikalische Gestaltung, der musikalische Strophenaufbau geht verloren. Der Unterschied des Kunstliedes zum Volkslied besteht hauptsächlich darin, dass der Komponist des Kunstliedes bekannt ist, das Volkslied hingegen ohne Autor existiert. Vertonungen von Lyrik sind für Kunstlieder charakteristisch. Sie werden auf Grundlage einer schriftlichen Fixierung gesungen, Volkslieder dagegen mündlich tradiert. Kunstlieder werden von ausgebildeten Sängern interpretiert, weil die Anforderungen für die Stimme gegenüber einem Volkslied generell deutlich höher sind. Zuweilen kommt es vor, dass Volkslied und Kunstlied ineinander übergehen. Franz Schuberts Lied Der Lindenbaum aus seinem Zyklus Winterreise wurde z. B. durch eine Männerchorfassung von Friedrich Silcher, welche die dramatische Molltrübung in einer Strophe schlicht überging, als das Volkslied Am Brunnen vor dem Tore bekannt. Das deutsche Kunstlied im engeren Sinne entwickelte sich in der Musik des 19. Jahrhunderts mit den Hauptvertretern Franz Schubert, Robert Schumann und Johannes Brahms. Franz Schubert erweiterte den herkömmlichen Begriff des Kunstliedes in hohem Maße. Das bisher vorherrschende Strophenlied wird von ihm erweitert zum variierten Strophenlied, aber ebenso finden sich gänzlich durchkomponierte Lieder in seinem Schaffen. Das begleitende Klavier emanzipierte sich vollständig vom Sänger und schuf so einen reicheren Gegenpart zur Melodie. Für Schuberts Lieder ist typisch, dass er meist eine charakteristische melodische Figur (Motiv) wiederholt. In höchster Steigerung ist dies im Gretchen am Spinnrade zu hören, in dem permanent das gleichmäßige Drehen des Spinnrades in der Klavierstimme dargestellt wird. Seine beiden großen Liederzyklen Die schöne Müllerin (1823) und Winterreise (1827) auf Texte von Wilhelm Müller zählen zu den Höhepunkten der Liedliteratur und sind Prüfstein für jeden männlichen Interpreten, obwohl auch große Sängerinnen wie Christa Ludwig, Brigitte Fassbaender oder Christine Schäfer die Winterreise beeindruckend aufgeführt haben. Der posthum erschienene Schwanengesang umfasst Lieder aus Schuberts letzter Schaffenszeit. Seine Lieder wurden schließlich so bekannt, dass man das deutsche Wort Lied in andere Sprachen übernommen hat (französisch: Le lied, englisch: The lied). Damit wird spezifisch das Kunstlied bezeichnet, das durch Schubert eine enorme Aufwertung erfuhr. Die Vertonung eines Liedes erhält neuen schöpferischen Wert. Robert Schumann schuf neben zahlreichen Liedern, die sehr eng an der literarischen Vorlage komponiert waren, die bedeutenden Zyklen Dichterliebe op. 48 und Frauenliebe und -leben op. 42. Sein Liederkreis op. 39 über Gedichte von Joseph von Eichendorff ist genauso wie die Myrten op. 25 eine inhaltlich nicht unmittelbar zusammenhängende Sammlung von Liedern. (Wikipedia) Es singt das lyrische Ich Das Kunstlied des 19. Jahrhunderts Mit dem Aufkommen des Bürgertums wendet sich die Musik des 19. Jahrhunderts dem Ausdruck des Subjekts zu. Durch die Kompositionen von Schubert, Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy wird das Kunstlied zu einer typischen Kunstform des Jahrhunderts der Bürger: Ichbezogene Texte von Dichtern wie Eichendorff oder Mörike werden von einer Solo-Stimme vorgetragen; der subjektive Ausdruck derer Lyrik abermals gesteigert. Das Lied ist ein zum musikalischen Vortragen geschriebener Text. Es kennt mittlerweile für jede Situation des Alltags eine untergeordnete Spezies: Arbeitslieder wie etwa das Shanty erleichtern körperliche Routinen, Gesellschaftslieder begleiten beliebte Freizeiteinsätze wie Busfahrten (siehe Mundorgel), Trinken und andersartigen Drogenkonsum. Von diesen Liedformen unterscheidet sich das Kunstlied, da es für eine Konzertsituation geschrieben wird. Und da es geschrieben wird, unterscheidet es sich auch vom mündlich überlieferten Volkslied. Es singt das lyrische Ich, so ist das Kunstlied auf einen nicht angemessenen, aber wenigstens knappen Nenner zu bringen. In einer Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen verändert sich die Kunst. Und im 19. Jahrhundert, nach der Unabhängigkeitserklärung der USA (1776) mit ihren demokratischen Grundwerten, der Revolution in Frankreich von 1789 bildet sich in Europa wie in den USA das Bürgertum als Träger der neuen wirtschaftlich-gesellschaftlichen Epoche, des Kapitalismus. Die Idee des freien Bürgers wird in Philosophie und Kunst begleitet von der Forderung des von Zwängen der Religion und absoluter Herrschaft losgelösten Subjekts. Das Kunstlied verdoppelt sogar dieses Ideal der Kunst des 19. Jahrhunderts, insbesondere der Kunst der Romantik. Vertont es doch zumeist subjektive, oft in der ersten Person Singular erzählende Texte von Dichtern wie Wilhelm Müller, Eichendorff oder Mörike ohnehin subjektiven Texte werden schließlich von einer Solostimme, meist in Begleitung eines Klavieres, vorgetragen. Franz Schubert gilt als der Hauptkomponist des deutschsprachigen Liedes. Als Sohn eines Volksschullehrers wurde Franz Peter Schubert 1797 in Wien geboren, wo er im Jahr 1828 an einer Typhuserkrankung starb. In seinem kurzen Leben hinterließ Schubert über 660 Lieder. Bereits im Alter von 17 Jahren ließ sich der Komponist von den Gedichten eines Goethe inspirireren und schrieb Lieder wie das Heidenröslein. Schon hier vermochte Schubert vorwegzunehmen, was er in Liederzyklen wie Die schöne Müllerin und Winterreise ausformte. Zur Lyrik Wilhelm Müllers, die sich besonders in der Winterreise ganz im Stile der sich ansagenden Romantik in Sound und Melodieführung der Musik angleicht, setzt Franz Schubert sich behutsam entfaltende Kompositionen. Sie leben von einer bis dahin nicht gehörten Expressivität der Singstimme, die das starke psychologische Motiv als Gestaltungsmittel in die Liedkunst einführt. Somit gelingt es Franz Schubert, das Kunstlied in den Formenkanon der Musik einzuführen. Durch ihn angeregt, komponieren Mitte des 19. Jahrhunderts Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Carl Loewe und Carl Maria von Weber eigene Liederzyklen. Schumann vertont etwa die Gedichte von Eichendorff, Adalbert von Chamisso und Heinrich Heine. Um 1860 werden die ersten reinen Liederabende als Form gesellschaftlicher Unterhaltung gegeben. Ab etwa dieser Zeit vervielfältigen sich auch die Stile im Liedschaffen. So wagen Franz Liszt und Wagner den Aufbruch in die freie Deklamatorik, während sich Johannes Brahms hörbar am Volkslied orientiert. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich der Berliner Bariton-Sänger Dietrich Fischer-Dieskau (der beste Liedersänger der Welt, so The Times) um eine erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit für das Kunstlied verdient gemacht. (Genrelexikon Klassik, musicline.de)