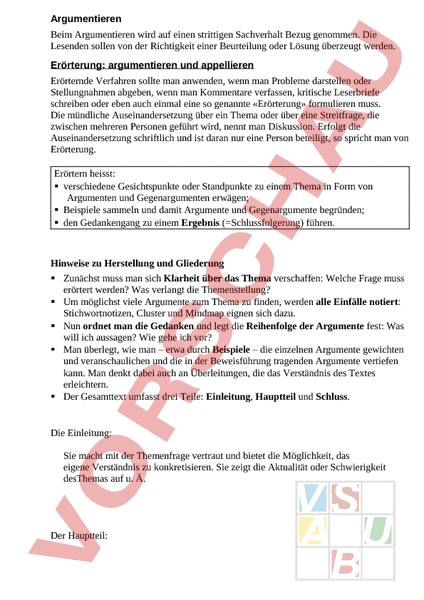Arbeitsblatt: Argumentieren
Material-Details
Theorie zum Aufsatzthema Argumentieren/Erörtern
Deutsch
Texte schreiben
8. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
57686
616
3
25.03.2010
Autor/in
Lilian Berner
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Argumentieren Beim Argumentieren wird auf einen strittigen Sachverhalt Bezug genommen. Die Lesenden sollen von der Richtigkeit einer Beurteilung oder Lösung überzeugt werden. Erörterung: argumentieren und appellieren Erörternde Verfahren sollte man anwenden, wenn man Probleme darstellen oder Stellungnahmen abgeben, wenn man Kommentare verfassen, kritische Leserbriefe schreiben oder eben auch einmal eine so genannte «Erörterung» formulieren muss. Die mündliche Auseinandersetzung über ein Thema oder über eine Streitfrage, die zwischen mehreren Personen geführt wird, nennt man Diskussion. Erfolgt die Auseinandersetzung schriftlich und ist daran nur eine Person beteiligt, so spricht man von Erörterung. Erörtern heisst: verschiedene Gesichtspunkte oder Standpunkte zu einem Thema in Form von Argumenten und Gegenargumenten erwägen; Beispiele sammeln und damit Argumente und Gegenargumente begründen; den Gedankengang zu einem Ergebnis (Schlussfolgerung) führen. Hinweise zu Herstellung und Gliederung Zunächst muss man sich Klarheit über das Thema verschaffen: Welche Frage muss erörtert werden? Was verlangt die Themenstellung? Um möglichst viele Argumente zum Thema zu finden, werden alle Einfälle notiert: Stichwortnotizen, Cluster und Mindmap eignen sich dazu. Nun ordnet man die Gedanken und legt die Reihenfolge der Argumente fest: Was will ich aussagen? Wie gehe ich vor? Man überlegt, wie man – etwa durch Beispiele – die einzelnen Argumente gewichten und veranschaulichen und die in der Beweisführung tragenden Argumente vertiefen kann. Man denkt dabei auch an Überleitungen, die das Verständnis des Textes erleichtern. Der Gesamttext umfasst drei Teile: Einleitung, Hauptteil und Schluss. Die Einleitung: Sie macht mit der Themenfrage vertraut und bietet die Möglichkeit, das eigene Verständnis zu konkretisieren. Sie zeigt die Aktualität oder Schwierigkeit desThemas auf u. Ä. Der Hauptteil: Er entwickelt die Behauptung, begründet mit Argumenten, widerlegt mit Gegenargumenten, so dass ein überzeugender Gedankengang entsteht. Hierbei kann man von zwei grundsätzlichen Möglichkeiten Gebrauch machen: – dem steigernden Aufbau: die Argumente werden nacheinander aufgezählt, es gibt keine Gegenargumente, aber eine abschliessende Zusammenfassung; – dem dialektischen Aufbau, d. h. der Hauptteil wird dadurch in zwei Abschnitte gegliedert; in Pro und Contra. Zuerst werden die Gegenargumente erwähnt und im zweiten Teil kommen die Argumente. Der Schluss: Nun werden die Darlegungen zusammengefasst, oder es wird noch ein Streiflicht auf eine Frage geworfen, die mit dem behandelten Thema zusammenhängt, so dass der Leser eine weitere Anregung zum Nachdenken erhält. Beim Schreiben ist ausserdem zu beachten: Behauptungen müssen belegt werden. Argumente lassen sich am besten mit Beispielen aus der eigenen Erfahrung stützen. Form und Sprache Abschnitte setzen Überleitungen zwischen Argumentationen verwenden sachliche, präzise Sprache benützen auf einen kontradiktorischen und objektiven Stil achten Beispieltext: Spicken in Prüfungen – lohnt sich das? Unsere Klasse hat in der heutigen Matheprüfung wieder einmal gespickt. Hast Du Remo gesehen? Sein Arm war mit Formeln voll geschrieben. Solche Aussagen vernimmt man nach Prüfungen häufig. Mit Spicken wird jeder Schüler einmal konfrontiert. Schon unsere Vorfahren kannten sich darin sehr gut aus. Und die Methoden sind heute noch die gleichen. Das Spicken verhilft dazu, dass ein Schüler mit wenig Aufwand gute Resultate erreichen kann. Der Arbeitsaufwand bei der Vorbereitung hängt natürlich vom Umfang des Stoffes ab, ist aber klein, verglichen mit jenem, den das Auswendiglemen und die Auseinandersetzung mit der Grundstruktur des Lernstoffes erfordert. Es ist auch gar nicht so schlecht, wenn man seinen Spick immer wieder auf den neusten Stand bringt, sei es wegen Platzmangels oder wegen der Verbesserung in der Darstellung. Durch das Verkleinern und Umschreiben des Spicks prägt man sich einiges vom Lernstoff ein. Durch den Spick erhöhen sich auch Selbstbewusstsein und Sicherheit des Schülers. Er fühlt sich wohl und glaubt, dass nichts mehr schief gehen kann. Ausserdem führt ein gutes Prüfungsresultat dazu, dass der Ehrgeiz des Schülers gesteigert wird. Es ist im Instinkt des Menschen, sich zu verbessern und sich in der Konkurrenz mit anderen zu behaupten. Dies kann der Schüler tun, indem er zu sich sagt: Denen werde ich es zeigen. Andererseits ist aber auch leicht einzusehen, dass ein Spick keinen langfristigen Lernerfolge zeitigen kann. Denn die Grundstruktur des Lernstoffes wird mit Spicken nicht verstanden. Überdies verschwendet man viel Zeit mit Fragen wie: Wie soll ich es anstellen, dass mich mein Lehrer nicht erwischt? Wo wäre mein Spick wohl am besten aufgehoben? usw. In dieser Zeit würde man sich gescheiter die Grundstruktur und die Vokabeln des Lernstoffes erarbeiten. Damit hätte man für einen ehrlichen Prüfungserfolg viel getan. Aber auch während der Prüfung wird ein Schüler, der unredliche Mittel einsetzt, von der Angst und dem schlechten Gewissen geplagt, was zu Konzentrationslücken führen kann. Weiterhin fehlt einem solchen Schüler jegliches solides Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, weil die guten Resultate ja erschwindelt wurden. Im Berufsleben wird er Mühe haben, überzeugend zu wirken und sich deshalb auch nicht behaupten können. Noch wichtiger scheint mir schliesslich, dass man ohne eigenes mühevolles Lernen auch nicht erfährt, wie wichtig Arbeitsdisziplin und Verantwortung sind. Wer spickt, kommt vielleicht zu kurzfristigen Erfolgen, aber er setzt sich unnötiger Angst aus und beweist, dass er zu wenig Arbeitsdisziplin und Selbstvertrauen hat. Spicken ist ein Betrug an sich selbst. Deshalb lohnt es sich nicht. (Sabina E., Gymnasiastin, 17-jährig)