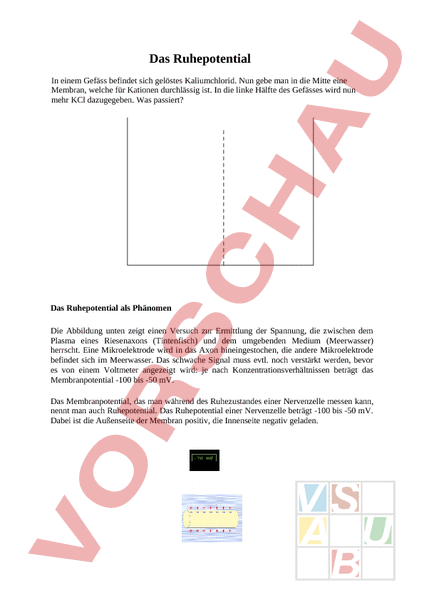Arbeitsblatt: Ruhepotential
Material-Details
Text zur Erklärung wie das Ruhepotential entsteht. Mit Lückentext
Biologie
Neurobiologie
12. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
59017
2939
7
15.04.2010
Autor/in
Patricia Droz
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Das Ruhepotential In einem Gefäss befindet sich gelöstes Kaliumchlorid. Nun gebe man in die Mitte eine Membran, welche für Kationen durchlässig ist. In die linke Hälfte des Gefässes wird nun mehr KCl dazugegeben. Was passiert? Das Ruhepotential als Phänomen Die Abbildung unten zeigt einen Versuch zur Ermittlung der Spannung, die zwischen dem Plasma eines Riesenaxons (Tintenfisch) und dem umgebenden Medium (Meerwasser) herrscht. Eine Mikroelektrode wird in das Axon hineingestochen, die andere Mikroelektrode befindet sich im Meerwasser. Das schwache Signal muss evtl. noch verstärkt werden, bevor es von einem Voltmeter angezeigt wird: je nach Konzentrationsverhältnissen beträgt das Membranpotential -100 bis -50 mV. Das Membranpotential, das man während des Ruhezustandes einer Nervenzelle messen kann, nennt man auch Ruhepotential. Das Ruhepotential einer Nervenzelle beträgt -100 bis -50 mV. Dabei ist die Außenseite der Membran positiv, die Innenseite negativ geladen. Einfache Erklärung des Ruhepotentials Um die Sache einfach zu machen, konzentrieren wir uns ganz auf die Ionen, die sich im Innern des Axons befinden. Im Plasma des Axons befinden sich viele sowie viele organische . Die organischen Anionen sind so groß, dass sie nicht durch die Membran des Axons nach außen diffundieren können. Die Kaliumionen aber sind klein genug; sie können nach außen diffundieren, wie die beiden roten Pfeile in der Abbildung andeuten. Lassen wir jetzt einmal zwei dieser Kaliumionen nach außen diffundieren: Die Konzentrationsverhältnisse haben sich geringfügig geändert, der KaliumKonzentrationsunterschied ist geworden (beachte die kleineren roten Pfeile). Aber es sind zwei positive Ladungen nach außen transportiert worden, also ist es im Zellinnern jetzt gegenüber der Außenseite. Es bildet sich eine Membranspannung, die der Diffusion der Kaliumionen entgegenwirkt (blaue Pfeile). Die negative Ladung auf der Membraninnenseite sozusagen, dass weitere Kaliumionen nach außen diffundieren (die blauen Pfeile in der Abbildung sind genau so groß wie die roten Pfeile, es herrscht quasi ein Gleichgewichtszustand). Was würde passieren, wenn dennoch ein weiteres Kaliumion nach außen gelangte? Schauen wir uns auch das im Bild an: Die negative Ladung im Innern wäre noch größer, der Kaliumgradient noch kleiner. Im Endeffekt würden die Kaliumionen wieder in die Zelle hineingetrieben, angezogen von der starken negativen Ladung im Zellinnern. Sehr schnell wird sich wieder der Gleichgewichtszustand einstellen: In diesem Gleichgewichtszustand ist die Spannung zwischen Membraninnen- und außenseite so groß, dass praktisch keine Ionen mehr diffundieren. Die Membranspannung, die man zu diesem Zeitpunkt messen kann, nennt man Lückentext zum Ruhepotential Zellmembranen bestehen aus einer Lipid-Doppelschicht, die praktisch undurchlässig für Ionen ist. Ionen können jedoch über spezielle Proteine (_) die Membran passieren. Diese Kanäle sind sehr selektiv und lassen nur jeweils eine Sorte Ionen durch, sie können geöffnet oder geschlossen sein. Das Zelläussere ist reich an (_) und (_) im Inneren hingegen dominieren organische Anionen (vor allem Aminosäuren) und (_) Sticht man mit Mikroelektroden in eine beliebige Körperzelle ein, misst man immer eine Potentialdifferenz (Spannung) gegenüber der Umgebung. Das Zellinnere ist gegenüber dem Zelläusseren geladen. Diese Potentialdifferenz nennt man (_) Wie kommt es dazu? Das Zellinnere und das Zelläussere weisen über ihre ganze Ausbreitung eine ähnliche Nettoladung auf (siehe mittl. Bild, S.286). Wie aus dem Kaliumchloridexperiment herauszulesen ist, spielen die Ionen, für welche die Membran nicht durchlässig ist, damit keine Rolle bei der Ausbildung der Potentialdifferenz. Die Kanäle, die im Ruhezustand hauptsächlich offen sind, sind (_) Dies bedeutet, dass (_) wegen dem (_) von innen nach aussen wandern, durch die (_) aber wieder zurückgezogen werden bis ein Gleichgewicht entsteht. Sie sammeln sich in Membrannähe so an, dass das (_) gegenüber dem (_) positiv geladen ist. Da im Ruhezustand auch einige Natriumkanäle leicht geöffnet sind, würde dies wegen der Ladungsdifferenz und der Konzentrationsdifferenz zum (_) der Ionen und zum allmählichen Verschwinden des (_) führen. Dies findet aber nicht statt wegen der Natrium-Kalium-Pumpe, einem Transport-Protein, das unaufhörlich unter Energieverbrauch drei Natriumionen nach aussen schafft, während gleichzeitig zwei Kaliumionen nach innen befördert werden. Dies ist also der zweite Mechanismus, der zum (_) beiträgt. In Nervenzellen (Ruhezustand) wird ca. 30% des gesamten Energieumsatzes durch diese Pumpe verbraucht, nach Aktionspotentialen sind es gar 60%.