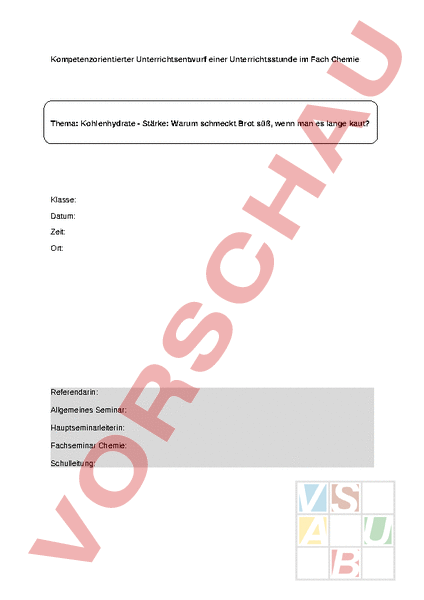Arbeitsblatt: Kohlenhydrate Stärke
Material-Details
Lehrprobe Warum schmeckt Brot süß, wenn man es lange kaut?
Chemie
Anderes Thema
10. Schuljahr
22 Seiten
Statistik
59746
1487
10
30.04.2010
Autor/in
Anne Schmidt
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Kompetenzorientierter Unterrichtsentwurf einer Unterrichtsstunde im Fach Chemie Thema: Kohlenhydrate Stärke: Warum schmeckt Brot süß, wenn man es lange kaut? Klasse: Datum: Zeit: Ort: Referendarin: Allgemeines Seminar: Hauptseminarleiterin: Fachseminar Chemie: Schulleitung: 1 Inhalt 1 Das Thema der Lehr- und Lernprozesse; Thema der Unterrichtssequenz /-einheit sowie mittel- und langfristiger Kompetenzerwerb3 2 Fachlicher Schwerpunkt und didaktische Analyse4 3 Die Lern- und Arbeitsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler.7 4 Kompetenzen, Standards, Leitideen9 5 Die individuelle Kompetenzentwicklung der Lernenden.11 6. Die Begründung der Lehr- und Lernstruktur11 7 Die Konkretisierung der Lehr- und Lernprozesse.14 8 Literatur16 9 Unterschrift.16 10 Anlagen17 2 1 Das Thema der Lehr- und Lernprozesse; Thema der Unterrichtssequenz /-einheit sowie mittel- und langfristiger Kompetenzerwerb Thema der Unterrichtsreihe Kohlenhydrate chemisch betrachtet Kompetenzen/ Standards Die Schülerinnen und Schüler1 unterscheiden zwischen Mono-, Di- und Polysacchariden. beschreiben die Gewinnung von Rübenzucker. beschreiben chemische Reaktionen von Kohlenhydraten. beschreiben, veranschaulichen und erklären chemische Sachverhalte der Kohlenhydrate mit Hilfe von Modelldarstellungen und unter Verwendung der Fachsprache. Thema der Stunde 1 Kohlenhydrate Einführung 2 Gewinnung und Reindarstellung von Rübenzucker Von der Rübe zum Zucker 3 Klassifizierung der Kohlenhydrate 4/5 Zusammensetzung und Eigenschaften der Monosacharide Glucose Fruktose 6 Traubenzucker Fruchtzucker Rübenzucker Zusammensetzung und Eigenschaften des Disaccharids Saccharose 7 8 9 10 11 Zusammenführung der bisherigen Ergebnisse zu Kohlenhydraten Monound Disaccharide. Kohlenhydrate Stärke: Warum schmeckt Brot süß, wenn man es lange kaut? Cellulose: Kleiner Unterschied – große Wirkung Kompetenzbereich Fachwissen: Die SuS reaktivieren ihr Vorwissen zum Thema Kohlenhydrate und diskutieren unterschiedliche Ansichten. Kompetenzbereich Fachwissen: Die SuS erstellen ein Fließschema zur Zuckerherstellung und beantworten Fragen zu diesem Prozess, nachdem die Thematik anhand eines Filmes und in Form von Sachtexten erarbeitet wurde. Kompetenzbereich Fachwissen: Die SuS informieren sich anhand eines Fachtextes und ordnen Kohlenhydrate tabellarisch in Mono-, und Disaccharide, wobei charakteristische Eigenschaften zugeordnet werden. Kompetenzbereich Erkenntnisgewinn: Die SuS führen Nachweisreaktionen zu den funktionellen Gruppen der Kohlenhydrate durch. Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Die SuS entwickeln Fragestellungen, die durch chemische Kenntnisse und Untersuchungsmethoden zu beantworten sind. Sie planen unter Anleitung qualitative experimentelle Untersuchungen und führen diese sachgerecht durch. Kompetenzbereich Kommunikation: Die SuS kommunizieren unter Verwendung der Fachsprache ihre bisherigen Versuchsergebnisse im Plenum und vervollständigen die zu Beginn der Unterrichtsreihe begonnene Tabelle. Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Die SuS wenden Schritte aus dem experimentellen Weg der Erkenntnisgewinnung an (Formulierung von Untersuchungsfragen, Experimentieren unter Beachtung von Sicherheits- und Umweltaspekten). Sie wenden vorhandene Kenntnisse zur Problemlösung in Form von Versuchsplanung, Durchführung und Auswertung an. Fachbereich Erkenntnisgewinnung: Die SuS führen qualitative experimentelle Untersuchungen durch, protokollieren diese und werten die Ergebnisse sachgerecht aus. LEK 1 Im Folgenden wird „die Schülerinnen und Schüler aus Gründen der besseren Leserlichkeit entweder mit SuS abgekürzt oder als „Schüler zusammengefasst. 3 2 Fachlicher Schwerpunkt und didaktische Analyse Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Kohlenhydrate – Energielieferanten und Baustoffe von Lebensformen sollen die SuS hauptsächlich Kompetenzen aus dem Struktur-EigenschaftKonzept erlangen. Die Reihe soll zudem die Kompetenz Erkenntnisgewinnung der SuS dahingehend fördern, dass ihnen ein strukturiertes Vorgehen zur Problem-Analyse nähergebracht werden soll. Die SuS sollen anhand von bekannten Nachweisreaktionen einen ihnen vom submikroskopischen Bau her unbekannten Stoff (Mehl, Stärke) analysieren. Die Entscheidung ist in folgenden curricularen, sachlogischen, didaktischen und lerngruppenspezifischen Überlegungen begründet. Im Rahmenlehrplan (RLP) werden die Polysaccharide Stärke und Cellulose als mögliche Inhalte genannt, um die chemischen Eigenschaften der Kohlenhydrate in Form von chemischen Reaktionen, Struktur-Eigenschaftsbeziehungen und Modelldarstellungen zur Erklärung von chemischen Sachverhalten zu benutzen (curriculare Begründung). Da die Ernährung der SuS eine immanente Bedeutung in dieser Lebensphase hat (richtige und falsche Ernährungsgewohnheiten, Diäten, Fast-Food), bietet es sich an, das Thema aus dieser Perspektive für den Unterricht aufzuarbeiten. Es ist davon auszugehen, dass den meistens Schülern nicht bewusst ist, dass Stärke aus Glucosemonomeren aufgebaut ist, und dass diese Monomere im Rahmen des physiologischen Abbaus der Stärke (Verdauung) entstehen. Die Schülermotivation lässt sich über diesen Bezug steigern (lerngruppenspezifische Überlegung). Kohlenhydrate lassen sich folgendermaßen einteilen: Stoffgruppe/Summenformel Wichtige Name im Alltag Vertreter Monosaccharide C6H12O6 Glucose Fructose Traubenzucker Fruchtzucker Disaccharide Saccharose Rohr- oder Rübenzucker C12H22O11 Polysaccharide Maltose Malzzucker Lactose Milchzucker Amylose Bestandteile der Amylopektin Stärke Glycogen Tierische Stärke Cellulose Cellulose Zusammensetzung; Bindungstyp -D-Glucose und ß-DFructose; ,-1,2-glycosidische Bindung 2x -D-Glucose; -1,4-glycosidische Bindung D-Galactose und DGlucose, -1,4-glycosidische Bindung D-Glucose-Monomeren, -1,4-glykosidische Bindung D-Glucose-Monomeren; -1,4-glykosidische und etwa alle 25 Monomere -1,6-glykosidische Bindung D-Glucose; -1,4-glykosidische und alle 8 bis 12 Glucosebausteine -1,6glykosidische Bindung -D-Glucose; -1,4glykosidische Bindung 4 Kohlenhydrate haben eine zentrale Funktion im Stoffkreislauf der Energiegewinnung und – speicherung. Die SuS haben in den vorangegangenen Stunden die Glucose und Fructose als typische Vertreter der Monosacharide, sowie Saccharose und Maltose als Vertreter der Disaccharide kennengelernt. Die Hydroxylgruppe ist den SuS als funktionelle Gruppe von den Alkoholen her bekannt. Die Aldehydgruppe und die Ketogruppe wurden als neue funktionelle Gruppen eingeführt. In diesem Zusammenhang wurden die Fehlingprobe und die Silberspiegelprobe als Nachweisreaktionen für die Aldehydgruppe eingeführt, wobei die SuS erkannt haben, dass auch Fructose eine positive Reaktion bei diesem Nachweis zeigt. Dieser Sachverhalt wurde den SuS didaktisch reduziert vermittelt, indem auf Nebenreaktionen der Fruktose, die für dieses Ergebnis verantwortlich sind, von mir hingewiesen wurde. Dies sind die Keto-Enol-Tautomerie und das Zerbrechen der Kohlenstoffatomkette, wobei Abbauprodukte der Fructose (Glycerinaldehyd) in alkalischen Lösungen entstehen. Der enzymatische Nachweis (GOD-Test) als Nachweisreaktion für Glucose wurde von den SuS ebenfalls durchgeführt und ist ihnen als ein für Glucose spezifischer Nachweis, der auf einer Enzymreaktion beruht, bekannt. Der Test erfolgt mit Hilfe des Enzyms Glucoseoxidase. Die Glucoseoxidase, eine Dehydrogenase, ist ein Protein mit Flavin-adenin-dinucleotid (FAD) als prosthetischer Gruppe. Das Enzym wird im Folgenden als Pr-FAD abgekürzt. Pr-FAD katalysiert die Oxidation von ß-D-Glucose zu ß-D-Glucono- -lacton und wird dabei selbst unter Wasserstoffaufnahme zu Pr-FAD-H2 reduziert. In einer Folgereaktion wird Pr-FAD-H2 durch Oxidation wieder in den aktiven Zustand Pr-FAD überführt, wobei Wasserstoffperoxid gebildet wird. In einer dritten Reaktion wird das gebildete Wasserstoffperoxid mit oAminotoluol (o-Toluidin) zu einem blauen Farbstoff, der auf den gelb eingefärbten GODTeststreifen eine grüne Farbe verursacht, umgesetzt2. -D-Glucose ß-D-Glucose ß-D-Glucono--lacton Abbildung 1: Reaktionsschema zum GOD-Test In der zu zeigenden Stunde sollen die SuS erkennen, dass Stärke, als Hauptbestandteil des Mehls, aus Glucose-Monomeren aufgebaut ist. Da in der vorangegangenen Stunde der 2 Roche Packinsert Glucose Oxidase: 5 Aufbau der Disaccharide Saccharose und Maltose behandelt wurde, ist zu erwarten, dass die SuS aus der Fragestellung „Wieso schmeckt Brot süß, wenn man lange genug kaut? Hypothesen erstellen können, die durch entsprechende Fragestellungen und geeignete Untersuchungsmethoden analysiert werden können. Stärke ist aus miteinander verknüpften -Glucosemonomeren aufgebaut und damit ein Polysaccharid. Sie enthält einen in Wasser löslichen Anteil (Amylose) und einen unlöslichen Anteil (Amylopektin). Der Amyloseanteil der Stärke beträgt ca. 20%. Jedes Makromolekül besteht aus 250-300 -Glucosebausteinen und bildet unverzweigte Ketten aus -1,4glykosidisch verknüpften Glucoseeinheiten, während die Makromoleküle des Amylopektins (ca. 80%) aus mehreren tausend -Glucosebausteinen aufgebaut sind und verzweigte Ketten bilden (-1,6-glykosidische und -1,4-glykosidische Verknüpfungen)3. Die SuS werden allerdings zu diesem Zeitpunkt zunächst nur die unverzweigte Kettenstruktur der löslichen Amylose kennenlernen (didaktische Reduktion), da der Fokus auf der Bildung von Bindungen zwischen den Ringformen der Monosaccharide und den daraus resultierenden unterschiedlichen Eigenschaften (Struktur-Eigenschaften-Konzept) beruht. Die SuS haben in den vergangenen Stunden ihr Interesse an weiteren Nachweisreaktionen geäußert, und werden in dieser Stunde den Stärkenachweis mittels der Iod-KaliumiodidLösung (lugolsche Lösung) durchführen. In der Iod-Kaliumiodid-Lösung liegen Iod und Kaliumiodid im Verhältnis von 1:2 in Wasser vor. Das Problem, dass elementares Iod in Wasser kaum löslich ist, wird durch Zugabe von Kaliumiodid gelöst4: Der Stärkenachweis beruht auf einer charakteristischen und sehr empfindlichen Farbreaktion. Die I5-Ionen können sich in die Stärke-Moleküle einlagern. Die Einschlussverbindung hat bei Amylose eine blaue und bei Amylopektin eine rotviolette Farbe. Der Unterschied beruht darauf, dass die Amylose-Moleküle schraubenförmig gedreht sind, wodurch sich die Lichtabsorption verändert. Die SuS sollen den Nachweis in einer aus Zeitgründen bereits hergestellten löslichen Stärkelösung durchführen. Durch Zugabe der -Amylase-Lösung soll die Reaktion, die beim Brotkauen im Mund erfolgt, simuliert werden. Ein separater Versuchsansatz (Spucken in die Stärkelösung) wird auf Verlangen ebenfalls Berücksichtigung finden. Als Nachweisreaktionen sollen zum einen der Stärkenachweis vor und nach der Zugabe des Enzyms, sowie der Glucose-Nachweis vor und nach Zugabe des Enzyms durchgeführt werden. Bei der Vorbereitung dieser Schülerversuche hat sich herausgestellt, dass nach Zugabe der Amylase es zwar zu einer Entfärbung der lugolschen Lösung gekommen ist, jedoch ließ sich 3 P.Y. Bruice: Organische Chemie, S. 1131 ff. 4 E. Riedel: Anorganische Chemie, S. 406; 6 Glucose weder mit der Fehling-Probe, noch mit einem GOD-Teststreifen nachweisen. Dieses wurde mit verschiedenen Amylasen beobachtet. Die -Amylase wird von den Speicheldrüsen des Pankreas sezerniert und hydrolisiert die -1,4-glykosidische Bindung in Amylopektin und Amylose, wobei vornehmlich Maltose, Maltotriose und -Dextrine entstehen5. Maltose ist ein reduzierender Zucker und müsste demnach positiv bei der Fehling-Probe reagieren. Da in der Maltose -D-Glucose vorkommt, könnte dies der Grund sein, warum der GOD-Test nicht anschlägt, dies erklärt aber nicht die ausbleibende Reaktion der Fehling-Probe. Da ich dieses Problem derzeit nicht lösen kann, ich aber den Versuch für die Erkenntnisgewinnung der Schüler für unerlässlich halte, habe ich mich dazu entschieden, die Amylase-Lösung mit Glucose zu versetzen. Als Alternative könnte die Hydrolyse der Stärke auch mit Säure durchgeführt werden. Dieses entspricht aber nicht dem Einstieg in die Stunde (Brot wird beim Kauen süß), zudem sollen die SuS bei ihrer Problemlösung nicht durch andere chemische Stoffe und Reaktionen abgelenkt werden. Wissenschaftlich korrekt wäre bei der Versuchsplanung der Einsatz von Blindprobe und positiver Kontrolle, die aber hier zum einen aus zeitlichen Gründen und andererseits auch aus Gründen der didaktischen Reduktion nicht berücksichtigt werden. Die SuS wären, was Durchführung und Auswertung angeht an dieser Stelle überfordert und würden das Ziel der Stunde nicht erreichen. Außerdem müsste bei diesem Ansatz berücksichtigt werden, dass die zu untersuchende Substanz aus anderen Zuckern und/oder Substanzen bestehen könnte. Aus didaktischen Überlegungen wird dieses in der zu zeigenden Stunde nicht gemacht werden. Falls die SuS jedoch selbstständig eine Nachweisreaktion für Fructose zur Lösung der Stundenfrage vorschlagen, werde ich diesen Versuch auf eine der nächsten Stunden legen. 3 Die Lern- und Arbeitsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler Die Klasse 10c setzt sich aus 32 SuS (22 Schülerinnen und 10 Schüler) zusammen. Es handelt sich um die Englisch-Profilklasse. Die Schüler der Klasse 10c werden seit Beginn des Halbjahres von mir unterrichtet. Die Klasse hat zwei Stunden Chemieunterricht pro Woche, die montags in der 5. und 6. Stunde stattfinden. Der Unterricht findet regulär im Chemiehörsaal statt, kann aber bei Bedarf und nach Absprache in den Fachraum C2, der 6-8 Plätze zum experimentellen Arbeiten zur Verfügung stellt, verlegt werden. Eine zu Beginn des Schulhalbjahres erhobene inhaltliche und methodische Leistungsstandanalyse der Schüler hat zum Teil deutliche Defizite auf fachlicher und methodischer Ebene dargelegt. Außerdem ist die Motivation der Schüler stark zweigeteilt. Ein Großteil der Schüler wird das Fach mit Beendigung der 10. Klasse nicht weiter fortführen. 4 Schüler () beabsichtigen Chemie als Leitungskurs zu wählen, 2 Schüler () planen einen viersemestrigen Grundkurs und 2 Schüler () werden einen zweisemestrigen 5 L. Streyer: Biochemie (1988): S. 355f. 7 Grundkurs zu belegen. Interessant ist, dass die Leitungskurswahl nicht von den Leistungsträgern erfolgt ist, sondern von eher durchschnittlichen Schülern. Die Schüler experimentieren sehr gerne, wobei die Einhaltung der Sicherheitsregeln vielen Schülern Schwierigkeiten bereitet. Der Zusammenhang zwischen Experiment und Erkenntnisgewinn ist vielen Schüler ebenfalls nicht deutlich. Diese Lernausgangslage findet Berücksichtigung bei der inhaltlichen und methodischen Gestaltung des Unterrichts. Basierend auf dieser Situation möchte ich das Thema Kohlenhydrate nutzen, um den Schülern ein geordnetes Vorgehen beim Experimentieren nahe zu bringen und zudem den Zusammenhang zwischen Experiment und Erkenntnisgewinn herausarbeiten. Die Einführung von festen Strukturen, wie zum Beispiel feste Experimentiergruppen, feste Arbeitsplätze und die schriftliche Fixierung der „takehome-message bzw. eine Frage zum Inhalt der Stunde auf einer Karteikarte am Ende jeder Stunde, unterstützen den Kompetenzzuwachs bei den Schülern. 8 4 Kompetenzen, Standards, Leitideen Rahmenlehrplan Prozessuale Kompetenzen Erkenntnisgewinnung: Im Rahmen der problemorientierten Methode beobachten und beschreiben die SuS Phänomene, formulieren Fragestellungen und stellen Hypothesen auf. Sie planen ihr Vorgehen und erschließen sachgerechte Informationen mit Hilfe entsprechender Untersuchungsmethoden. Sie wenden dabei fachspezifische und allgemeine naturwissenschaftliche Arbeitstechniken an. Die SuS werten gewonnene Daten bzw. Ergebnisse aus, überprüfen Hypothesen und beantworten Fragestellungen. (RLP Chemie, Sek I, S. 10) Stand der Lerngruppe Prozessuale Kompetenzen: Erkenntnisgewinnung: Die SuS haben typische Nachweisreaktionen für die Monosaccharide Glucose und Fructose durchgeführt (Fehlingprobe, Silberspiegelprobe, GOD-Test, Saliwanow-Reaktion) und deren Spezifität herausgearbeitet. Am Beispiel der Saccharose haben die SuS experimentell mittels der sauren Hydrolyse deren Zusammensetzung aus Glucose und Fructose nachgewiesen. Polysaccharide (Stärke und Cellulose) wurden im Unterricht bisher nicht behandelt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die SuS wissen, dass Brot größtenteils aus Mehl besteht. Einige SuS könnten auch wissen, dass Stärke der Hauptbestandteil des Mehles ist. Fachwissen: Die SuS kennen die Strukturformeln der Glucose in der offenkettigen Form (Fischer-Projektion) und der Ringform (Haworth-Projektion), wobei es einigen Schülern Schwierigkeiten bereitet, beide Formen als in der Natur vorkommend zu begreifen. Der Umgang mit einem vereinfachten Ringmodell ist den Schülern bekannt. Konkretisierung der Standards für die Unterrichtsstunde Die SuS wenden Schritte aus dem experimentellen Weg der Erkenntnisgewinnung an: Sie formulieren die Stundenfrage und führen meist selbstständig ein Schülerexperiment unter Berücksichtigung von Umwelt- und Sicherheitsaspekten durch. protokollieren ihre Beobachtungen. werten das Experiment aus, indem sie Rückschlüsse aus der Beobachtung zur Beantwortung der Stundenfrage ziehen können. (Minimalstandard) wenden Schritte aus dem experimentellen Weg der Erkenntnisgewinnung an: Sie formulieren die Stundenfrage und führen ein Schülerexperiment unter Berücksichtigung von Umwelt- und Sicherheitsaspekten selbständig durch. protokollieren ihre Beobachtungen in sachgerechter Form. werten das Experiment aus, indem sie eine Reaktionsgleichung inklusive der Strukturformel aufstellen und mithilfe dieser die Stundenfrage beantworten können. (Maximalstandard) 9 8 10 5 Die individuelle Kompetenzentwicklung der Lernenden Schüler/in A, zum Beispiel xy, gelingt es zum Teil die Stundenfrage selbständig zu erschließen. Er/sie führt den Schülerversuch gemäß der Versuchsanweisung meistens sachgerecht und nicht immer unter Einhaltung von Sicherheits- und Umweltbestimmungen durch. Die Versuchsbeobachtungen kann er/ sie nur manchmal auf die Teilchenebene übertragen. Schüler/in B, zum Beispiel xy, gelingt es, die Stundenfrage selbständig zu erschließen. Er/sie führt den Schülerversuch gemäß der Versuchsanweisung sachgerecht und unter Einhaltung von Sicherheits- und Umweltbestimmungen durch. Die Auswertung erfolgt zum Teil selbstständig. Schüler/in C, zum Beispiel xy, kann sich die Stundenfrage selbständig erschließen. Er/sie führt das Schülerexperiment gemäß der Versuchsanweisung unter Anleitung sachgerecht und unter Einhaltung von Sicherheits- und Umweltbestimmungen durch und protokolliert die Beobachtungen. Die Auswertung erfolgt größtenteils selbstständig. 6. Die Begründung der Lehr- und Lernstruktur Zur Erreichung des Kompetenzzieles der heutigen Stunde wurde von mir folgende methodische Anordnung ausgewählt: Der Einstieg erfolgt mittels einer Folie (siehe Anlage1), auf deren Grundlage sich die Schüler die Stundenfrage („Wieso schmeckt Brot süß, wenn man es lange kaut?) selbst erschließen können. Der gewählte lebensweltliche Bezug dient dazu, die von vielen Schülern gezeigte Distanz zum Fach Chemie abzubauen. Auf der Folie wird die lugolsche Lösung als Stärkenachweis vorgestellt, da die Schüler bisher diesen Nachweis nicht kennen, dieser Nachweis aber für den experimentellen Erkenntnisgewinn notwendig ist. Zur Veranschaulichung wird ein kurzes Lehrerexperiment den Stärkenachweis an einer Kartoffel und auf einer Brotscheibe demonstrieren. An dieser Stelle wird auch die aus Zeitgründen bereits vorbereitete Stärkelösung eingeführt, um die Verbindung zwischen dem Brot und der Stärke zu verdeutlichen. Nach Stellung der Stundenfrage benennen die Schüler in der Erarbeitungsphase mögliche Hypothesen zur Lösung der Frage, die an der Tafel dokumentiert werden, um so für die Auswertungsphase zur Verfügung zu stehen. Die Vorschläge zum experimentellen Vorgehen werden ebenfalls an der Tafel skizziert, um daraus den bereits vorgefertigten Arbeitsbogen ableiten zu können. Der Arbeitsbogen enthält bereits eine Vorgehensweise, um zum einen aus zeitlichen Gründen das Erreichen des Stundenzieles zu gewährleisten, außerdem sind die Schüler es bisher nicht gewohnt mit eigenen Versuchsdurchführungen zu arbeiten. Falls es zu vom geplanten Vorgehen abweichende Vorschläge zur Vorgehensweise kommen sollte, werde ich die Schüler durch von mir gesetzte Impulse zu den erwarteten Lösungsansätzen lenken. Beispielsweise könnte der Vorschlag kommen, die Stärke mittels Salzsäure zu hydrolisieren, da den Schülern diese Vorgehensweise von der Analyse der Saccharose her bekannt ist. In diesem Falle werde ich darauf hinweisen, dass im Mund keine Salzsäure vorhanden ist, sondern ein Enzym, welches auch für chemische Untersuchungen an Schulen zur Verfügung steht. Ein weiterer berechtigter Vorschlag wäre zudem eine Untersuchung auf das Vorhandensein von Fructose mittels der SeliwanowProbe, die die Schüler als Nachweisreaktion für die Ketogruppe kennengelernt haben. Diesen Vorschlag werde ich als gute Idee loben, jedoch um eine Zurückstellung bitten, mit dem Hinweis, dass dieser Möglichkeit nachgegangen werden muss, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Das Arbeitsblatt enthält neben der detaillierten Vorgehensweise bereits eine Beobachtungstabelle, die auch an der Tafel vorhanden ist. Dies dient einer einheitlichen Dokumentation der Beobachtungen, die die Grundlage für die anschließende Auswertung bilden. Die Schüler werden die Versuche in ihren festen Gruppen (Anlage 6) durchführen. Die Gruppengröße beträgt fünf (drei Gruppen), bzw. sechs (zwei Gruppen) Schüler pro Gruppe. Es wäre möglich, da noch 2 weitere Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, die Gruppengröße auf vier Schüler pro Gruppe zu reduzieren. Ich habe mich aus folgenden Gründen für die größere Gruppengröße entschieden: • Die Gruppenzusammensetzung ist heterogen vorgenommen worden, so dass jede Gruppe mindestens einen sehr guten/guten Schüler und mindestens einen schlechten Schüler enthält. Durch diese Aufteilung möchte ich bereits in der Erarbeitungsphase gewährleisten, dass die Schüler sich durch gegenseitige Hilfestellungen unterstützen. Dieses Arrangement ist bei einer kleineren Gruppengröße nicht durchführbar. • In vorangegangenen Experimentierphasen konnte ich feststellen, dass die einzelnen Gruppen meine Unterstützung häufig benötigen. Die kleinere Summe an Gruppen ermöglicht mir während der Erarbeitungsphase eine bessere Überprüfung und Unterstützung der einzelnen Gruppen. Die Erarbeitungsphase setzt den Focus auf der Klärung der Stundenfrage mittels experimenteller Vorgehensweise. Da der Kompetenzschwerpunkt der Stunde im Bereich „Erkenntnisgewinnung liegt, sollen die Schüler möglichst eigenständig den Versuch durchführen und auswerten. Ich werde während dieser Phase vornehmlich auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und der korrekten wissenschaftlichen Arbeitsweise achten. Nach Beendigung der Versuchsphase werden die Arbeitsplätze von den Schülern gesäubert und die Materialien wieder in die bereitgestellten Körbe gelegt. Diese Vorgehensweise gehört zum einen auch zum wissenschaftlichen Arbeiten und hat zum anderen den Vorteil eine deutliche Phasentrennung zwischen der Versuchsdurchführung und der 12 Sicherungsphase, die zudem noch durch die räumliche Trennung der Arbeitsplätze von den Sitzplätzen unterstützt wird. Die Stundensicherung beinhaltet zum einen die schriftliche Fixierung der Beobachtung in Form einer Tabelle auf dem Arbeitsblatt und an der Tafel. An dieser Stelle bietet sich ein möglicher Stundenausstieg an. Da der Kompetenzschwerpunkt nicht im Bereich „Fachwissen liegt, wäre diese Vorgehensweise legitim. Mittels der Beobachtung könnte an dieser Stelle auch auf die Eingangsfolie eingegangen werden und eine Klärung der Stundenfrage „Warum schmeckt Brot süß, wenn man es lange kaut? ist mittels dieser Erkenntnisse möglich. Die Klärung auf Teilchenebene würde dann Hausaufgabe sein und in der nächsten Stunde besprochen werden. Ist hingegen noch genügend Zeit vorhanden, so wird die Stundenfrage auch auf Teilchenebene geklärt werden. Während der Sicherungsphase werden die Fragen auf dem Arbeitsbogen zunächst in Partnerarbeit bearbeitet, bevor sie im Unterrichtsgespräch besprochen werden. Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, dass sich die Schüler bereits während der Partnerarbeit inhaltlich mit der Auswertung beschäftigen und kommunizieren müssen. Die Vorstellung der Überlegungen im anschließenden Unterrichtsgespräch soll so erleichtert werden und die Beteiligung während dieser Phase erhöhen. Anschließend schreibt jeder Schüler seine „take-home-message oder eine sinnvolle Frage zum Thema auf eine Karteikarte. Den Schülern ist bekannt, dass diese Äußerungen in einem benotungsfreien Raum stattfinden. Durch diese Methode gewährleiste ich zum einen eine erhöhte Aufmerksamkeit während der Stunde, ich habe außerdem nach jeder Stunde von jedem Schüler eine schriftliche Sicherung zur Stunde. 13 7 Die Konkretisierung der Lehr- und Lernprozesse Zeit Lehrerverhalten Impulse Antizipiertes Schülerverhalten Methode Medium Kompetenzbezug UG Erkenntnisgewinnung: Die SuS formulieren Fragestellungen, die einen naturwissenschaftlichen Zusammenhang aufweisen. Einstieg Motivation 12.45 – ca. 12.55 Uhr L. legt Folie 1 auf, wobei nur der obere Teil zu erkennen ist. L.: „Vervollständigt bitte den Satz auf der Folie und überlegt, woraus Brot gemacht wird. erklärt, dass Mehl aus Stärke besteht und führt Demonstrationsversuch zum Nachweis von Stärke durch. Geht mit der Brotscheibe/ Kartoffel durch die Reihen, damit alle gut sehen können. L.: „Formuliert Vermutungen/Hypothesen: Warum schmeckt Brot süß. Wenn man es lange kaut? L. schreibt Hypothesen an die Tafel SuS betrachten Folie und äußern sich zu dem Impuls. SuS: „Das Brot schmeckt dann süß SuS: „Brot besteht aus Mehl, Stärke, Hefe, etc. SuS beobachten Lehrerdemonstration. Folie (Anlage 1) Lehrerversuch Kartoffel, Brot Tafel Die SuS formulieren Hypothesen, die einen Zusammenhang zum Stoffgegenstand „Kohlenhydrate erkennen lassen. SuS nennen Hypothesen: „Brot enthält Stärke und Glucose. Brot enthält Stärke, die zu Glucose umgewandelt wird. Versuchsvorbereitung 12.55 – ca. 13.05 Uhr L.: „Entwickelt jetzt Vorgehensweisen, mit den euch bekannten Nachweiseverfahren, wie ihr untersuchen könnt, welche Hypothese richtig ist. L. schreibt Vorschläge an die Tafel L.: „Auf dem Arbeitsblatt ist dieses Vorgehen so beschrieben. Lest euch das AB durch und arbeitet dann in den Gruppen. L.: „Ihr habt für die Aufgabe 15 Minuten Zeit. Jeweils ein Gruppenmitglied ist für das Zeitmanagement verantwortlich. L. teilt AB aus und notiert Versuchsende an der Tafel. Versuchsdurchführung L. steht bei Fragen der SuS zur Verfügung und ermahnt 13.05 gegebenenfalls zur Einhaltung der ca. Sicherheitsbestimmungen. L. fordert die SuS 3 Minuten vor Ende der Phase auf, mit 13.20 dem Aufräumen zu beginnen. Wer fertig ist, setzt sich Uhr zurück an den Platz. SuS: „ Schritte zur Überprüfung: 1. Nachweis von Glucose in Stärke (mit GODTeststreifen). 2. Nachweis von Stärke mit Iod-Kaliumiodid-Lösung. 3. Stärkelösung mit -Amylase behandeln. 4. Nachweis von Glucose (mit Teststreifen) 5. Nachweis von Stärke (mit Iod-Kaliumiodid-Lösung). UG Tafel Erkenntnisgewinn: Die SuS entwickeln Untersuchungsmöglichkeiten, die eine Klärung der Fragestellung ermöglichen. AB (Anlage 2) SuS hören zu und lesen sich im Anschluss das AB durch. SuS stellen ggf. Verständnisfragen. Tafel SuS führen den Versuch unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen durch. GA Versuchsmaterialien Erkenntnisgewinn Die SuS wenden Schritte des experimentellen Weges der Erkenntnisgewinnung an. 14 Sicherung: Auswertung der Beobachtungen L.: „Nennt mir eure Beobachtungen des Versuches. L. notiert Beobachtungen an der Tafel. SuS nennen Beobachtungen. Tafel UG Erkenntnisgewinn Die SuS machen sachgerechte Material: Folie, Haftmodelle, Arbeitsblatt, Karteikarten, Thermoskannen, Wasserkocher, Kartoffel, Brot, Chemikalien und Geräte laut AB 12/13 15 13/14 8 Literatur • Bruice, Paula Y.: Organische Chemie; S. 1131 ff.; 5. Auflage, München, 2007. • Riedel, Erwin (2004), Anorganische Chemie; S. 406; 6. Auflage, Berlin, New York, 2004. • Roche Pack-insert Glucose Oxidase: Letzter Zugriff: 24.04.2010. 10:00 Uhr. • Streyer, Lubert: Biochemie, S. 355f; Heidelberg, 1988. 9 Unterschrift 16 10 Anlagen Folie Stundeneinstieg (Anlage 1) Arbeitsblatt mit Versuchsdurchführung (Anlage 2) Arbeitsblatt mit antizipierten Lösungen (Anlage 3) Antizipiertes Tafelbild (Anlage 4) Vorlage der Haftapplikationen (Anlage 5) Folie mit Gruppeneinteilung (Anlage 6) Sitzplan mit Diagnosematrix (Anlage 7) 17 Anlage 1: Folie Stundeneinstieg Martin kaut einige Zeit auf einem Stück Weißbrot herum. Plötzlich bemerkt er einen süßen Geschmack. Stärke ist in allen Lebensmitteln enthalten, die aus Getreide hergestellt werden. Aber auch andere Lebensmittel, wie eine Kartoffel, enthalten Stärke. Stärke lässt sich chemisch nachweisen. Bringt man eine Iod-Lösung (lugolsche Lösung) auf die Schnittstelle einer Kartoffel, so färbt sie sich blau. 16 18 Anlage 2: Arbeitsblatt Versuchsdurchführung CHE10 Warum schmeckt Brot süß? Nachweis von Stärke und Glucose Name: Datum: Aufgabe: Führe den Versuch laut Anweisung durch, beobachte und protokolliere Geräte Chemikalien Reagenzglas, RG-Ständer, Pinzette, Pipetten, Wasserbad (40C), Stärkelösung, Amylaselösung, Glucose-Teststäbchen Lugolsche Lösung (Iod-Kaliumiodid-Lösung) R: 20/21-50 S: keine S-Sätze Sicherheit: Schutzbrille tragen!, Entsorgung: Durch die Lehrkraft Durchführung: 1. Lies die Anweisung sorgfältig durch und überprüfe, ob alles vorhanden ist, was du benötigst. 2. Bereite das Reagenzglas für die Durchführung vor: Beschriften und protokollieren! 3. Fülle in ein Reagenzglas daumenhoch Stärkelösung. 4. Überprüfe auf das Vorhandensein von Glucose mit einem Glucose-Teststäbchen: Tauche ein Glucose-Teststäbchen ca. 1 sec. in die Lösungen und vergleiche nach einer Minute mit der Skala auf dem Röhrchen und notiere deine Beobachtung. 5. Füge nun einen Tropfen der lugolschen Lösung hinzu, so dass die blaue Farbe beständig ist. 6. Füge mit der Pasteurpipette einige Milliliter der Amylase-Lösung hinzu und stelle das Reagenzglas ca. 5. Minuten lang in ein Becherglas mit ca. 40 C warmen Wasser. 7. Beobachte und notiere deine Beobachtungen. 8. Prüfe die Lösung nun erneut mit einem Glucose-Teststäbchen: Beobachtung: Stärke-Nachweis (Lugolsche Lösung) Glucose-Nachweis (GlucoseTeststreifen) Stärkelösung Stärkelösung Amylase Auswertung: Beantworte die unten stehenden Fragen. 19 a) Nebenstehend ist der Ausschnitt aus einem Stärkemolekül abgebildet. Aus welchen Bausteinen ist das spiralförmige Molekül zusammengesetzt? b) Was macht die Amylase-Lösung mit der Stärke? c) Erstelle das Reaktionsschema. Verwende dabei Symbole. 20 Anlage 3: Arbeitsblatt Versuchsdurchführung (erwartetes Ergebnis) CHE10 Warum schmeckt Brot süß? Nachweis von Stärke und Glucose Name: Datum: Aufgabe: Führe den Versuch laut Anweisung durch, beobachte und protokolliere Geräte Chemikalien Reagenzglas, RG-Ständer, Spatel, Pipetten, Wasserbad (40C) Stärkelösung, Amylaselösung, Glucose-Teststäbchen Lugolsche Lösung (Iod-Kaliumiodid-Lösung) R: 20/21-50 S: keine S-Sätze Sicherheit: Schutzbrille tragen!, Entsorgung: Durch die Lehrkraft Durchführung: 1. Lies die Anweisung sorgfältig durch und überprüfe, ob alles vorhanden ist, was du benötigst. 2. Bereite das Reagenzglas für die Durchführung vor: Beschriften und protokollieren! 3. Fülle in ein Reagenzglas daumenhoch Stärkelösung. 4. Überprüfe auf das Vorhandensein von Glucose mit einem Glucose-Teststäbchen: Tauche ein Glucose-Teststäbchen ca. 1 sec. in die Lösungen und vergleiche nach einer Minute mit der Skala auf dem Röhrchen und notiere deine Beobachtung. 5. Füge nun einen Tropfen der lugolschen Lösung hinzu, so dass die blaue Farbe beständig ist. 6. Füge mit der Pasteurpipette einige Milliliter der Amylase-Lösung hinzu und stelle das Reagenzglas ca. 5. Minuten lang in ein Becherglas mit ca. 40 C warmen Wasser. 7. Beobachte und notiere deine Beobachtungen. 8. Prüfe die Lösung nun erneut mit einem Glucose-Teststäbchen: Beobachtung: Stärkelösung Stärkelösung Amylase Stärke-Nachweis (Lugolsche Lösung) Blaue Färbung Glucose-Nachweis (GlucoseTeststreifen) Keine Färbung Grüne Färbung Keine Färbung Auswertung: Beantworte die unten stehenden Fragen. 21 a) Nebenstehend ist der Ausschnitt aus einem Stärkemolekül abgebildet. Aus welchen Bausteinen ist das spiralförmige Molekül zusammengesetzt? Aus Glucose-Molekülen b) Was macht die Amylase-Lösung mit der Stärke? Die Amylase zerlegt die Stärke in Glucose. c) Erstelle das Reaktionsschema. Verwende dabei Symbole. 22 Anlage 4: Antizipiertes Tafelbild Wieso schmeckt Brot süß, wenn man es lange kaut? Hypothesen: Brot enthält Mehl (Stärke) und Glucose. (widerlegt) Brot enthält Stärke, die zu Glucose umgewandelt wird. (bestätigt) Schritte zur Überprüfung: 1. Nachweis von Glucose (mit Glucose-Teststreifen) und Stärke (lugolsche Lösung). 2. Stärkelösung mit -Amylase behandeln. 3. Nachweis von Glucose (mit Glucose-Teststreifen) und Stärke (lugolsche Lösung). Auswertung: Stärke-Nachweis (Lugolsche Glucose-Nachweis (GlucoseLösung) Teststreifen) Stärkelösung Blaue Färbung Keine Färbung Stärkelösung Amylase Keine Färbung Grüne Färbung Bausteine des spiralförmigen Moleküls: Was macht die Amylase-Lösung mit der Stärke? Glucose-Moleküle Die Amylase zerlegt die Stärke in Glucose. Reaktionsschema. Brot schmeckt süß, wenn man es lange kaut, da die im Mehl enthaltene Stärke, die aus Glucosebausteinen besteht, von Enzymen (-Amylase) in die Glucosebausteine gespalten wird. 23 Anlage 5: Vorlage der Haftapplikationen 24 Anlage 6: Gruppeneinteilung Anlage 7: Sitzplan mit Diagnosematrix Legende: kaum bis keine freiwillige Mitarbeit, auf Nachfrage selten brauchbare Beiträge -o seltene Teilnahme am Unterricht, auf Nachfrage mitunter brauchbare Beiträge weitgehend regelmäßige Teilnahme am Unterrichtsgespräch, manchmal wichtige Beiträge o regelmäßige Teilnahme am Unterrichtsgespräch, häufiger fundierte, für das Unterrichtsgespräch wichtige Beiträge intensive Teilnahme am Unterrichtsgespräch, sehr häufig Beiträge, die für das Unterrichtsgespräch wichtig sind Tobias () Jonas M. (o) Fabian (o) Thorren () Moritz (o) Tobi (o) Lehrer Lehrer Max (o) Sophie (o) Lukas (o) Christian (o) 25