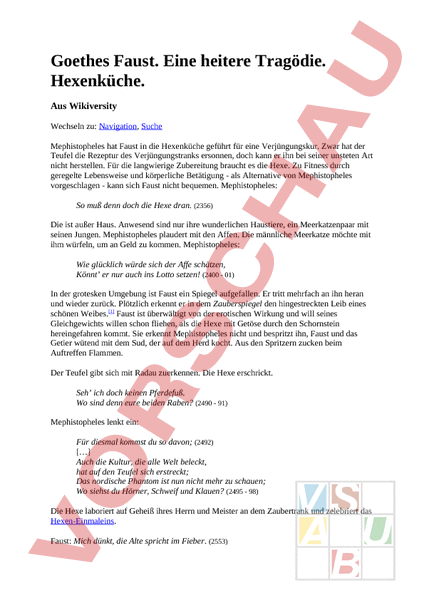Arbeitsblatt: Goethes Faust
Material-Details
Beschreibung und Informationen der Texststelle Hexenküche
Deutsch
Textverständnis
12. Schuljahr
6 Seiten
Statistik
62307
992
3
09.06.2010
Autor/in
Kathrin Eastline
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Goethes Faust. Eine heitere Tragödie. Hexenküche. Aus Wikiversity Wechseln zu: Navigation, Suche Mephistopheles hat Faust in die Hexenküche geführt für eine Verjüngungskur. Zwar hat der Teufel die Rezeptur des Verjüngungstranks ersonnen, doch kann er ihn bei seiner unsteten Art nicht herstellen. Für die langwierige Zubereitung braucht es die Hexe. Zu Fitness durch geregelte Lebensweise und körperliche Betätigung als Alternative von Mephistopheles vorgeschlagen kann sich Faust nicht bequemen. Mephistopheles: So muß denn doch die Hexe dran. (2356) Die ist außer Haus. Anwesend sind nur ihre wunderlichen Haustiere, ein Meerkatzenpaar mit seinen Jungen. Mephistopheles plaudert mit den Affen. Die männliche Meerkatze möchte mit ihm würfeln, um an Geld zu kommen. Mephistopheles: Wie glücklich würde sich der Affe schätzen, Könnt er nur auch ins Lotto setzen! (2400 01) In der grotesken Umgebung ist Faust ein Spiegel aufgefallen. Er tritt mehrfach an ihn heran und wieder zurück. Plötzlich erkennt er in dem Zauberspiegel den hingestreckten Leib eines schönen Weibes.[1] Faust ist überwältigt von der erotischen Wirkung und will seines Gleichgewichts willen schon fliehen, als die Hexe mit Getöse durch den Schornstein hereingefahren kommt. Sie erkennt Mephistopheles nicht und bespritzt ihn, Faust und das Getier wütend mit dem Sud, der auf dem Herd kocht. Aus den Spritzern zucken beim Auftreffen Flammen. Der Teufel gibt sich mit Radau zuerkennen. Die Hexe erschrickt. Seh ich doch keinen Pferdefuß. Wo sind denn eure beiden Raben? (2490 91) Mephistopheles lenkt ein: Für diesmal kommst du so davon; (2492) [] Auch die Kultur, die alle Welt beleckt, hat auf den Teufel sich erstreckt; Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen; Wo siehst du Hörner, Schweif und Klauen? (2495 98) Die Hexe laboriert auf Geheiß ihres Herrn und Meister an dem Zaubertrank und zelebriert das Hexen-Einmaleins. Faust: Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber. (2553) Die Hexe weiter: Die Hohe Kraft Der Wissenschaft, Der ganzen Welt verborgen! Und wer nicht denkt, Dem wird sie geschenkt, Er hat sie ohne Sorgen. (2567 72) Wissenschaft, d. h. Wissen schaffen, beruht auf Intuition und Entdeckung.[2] Nach obszöner Schäkerei mit der Hexe verlangt Mephistopheles nach dem Verjüngungstrank. Die Hexe warnt: Doch wenn es dieser Mann unvorbereitet trinkt, So kann er, wisst ihr wohl, nicht eine Stunde leben. (2526 27) Mephistopheles beruhigt die Hexe, auf die Affinität der Geisteswissenschaftler zu geistigen Getränken anspielend: Er ist ein Mann von vielen Graden, Der manchen guten Schluck getan. (2581 82) Mephistopheles führt Faust, nachdem er eine Schale des Zaubertranks geleert hat, hinaus. Faust will einen letzten Blick in den Zauberspiegel werfen. Mephistopheles: Nein! Nein! Du sollst das Muster aller Frauen Nun bald leibhaftig vor dir sehn. (Leise) Du siehst, mit diesem Trank im Leibe, Bald Helenen in jedem Weibe. (2601 04) Theater des Grotesken und Absurden [3] um eine Märchenfigur. Wie häufig, hat auch hier Mephistopheles das letzte Wort und schließt die Szene mit einer kaustischen Pointe ab. 1. Die Konfrontation des Geistesmenschen Faust mit der Verbindung von Schönheit und Eros bereitet 2. 3. das Helena-Motiv im zweiten Teil der „Tragödie vor. Das gilt für Naturwissenschaften. Ähnlich verhält es sich mit der Philosophie: Tiefe Wahrheiten nämlich lassen sich nur erschauen, nicht errechnen (Schopenhauer, Parerga und Paralipomena 1851, S. 459). Literaturwissenschaft dagegen läuft, sieht man genauer hin, auf Interpretation und Quellennachweis hinaus. Sie vermittelt lediglich zwischen dem berühmt gewordenen Autor und dem Leser. Der Literaturwissenschaftler profilert sich, wie übrigens auch der Kritiker, an fremder Leistung. Neues Wissen schafft er nicht. Schöne, Albrecht: Johann Wolfgang Goethe Faust Kommentare. Frankfurt am Main: Klassiker Verlag 1994, S.282 Hexenküche Nach dem Wirtshaus gehen Mephisto und Faust in die Hexenküche. Die Hexe selber ist noch nicht da, nur ihre Tiere empfangen die beiden. Faust ist anfangs wütend und sagt, dass es ihm überhaupt nicht gefalle, weder hier noch im Wirtshaus. Mephisto aber braucht von der Hexe einen Verjüngunstrank für Faust, da das natürliche Mittel jahrelange harte Feldarbeit und einfache Ernährung jetzt nicht sinnvoll ist. Mephisto gibt auch zu, dass er die Hexe braucht, die ihm zwar untergeordnet ist, die aber die nötige Zeit hat (Der Teufel hat sie zwar gelehrt; allein der Teufel kann nicht machen.). Es folgt ein Gespräch zwischen den Tieren und Mephisto, bei dem die Tiere immer wieder frech provozieren, was Mephisto aber nach eigenen Angaben gefällt. Dabei erblickt Faust in einem Spiegel ein schönes Mädchen, in das er sich prompt verliebt. Nun endlich kommt die Hexe und Mephisto verlangt nach dem Verjüngungstrank. Nach einigem Hokuspokus gibt die Hexe den Trank heraus und Faust trinkt ihn. Als er noch einmal die Frau im Spiegel anschauen will, zieht Mephisto ihn fort und verspricht ihm, er werde sie bald wirklich sehen. Er weiss, dass Faust durch den Trank praktisch jede Frau anbeten wird. Mephisto scheint ein recht lockerer Herrscher des Bösen und zu kleinen Spielchen aufgelegt zu sein. Die Tiere sowie die Hexe wissen, was sie sich erlauben können, sie wissen aber auch, wann Schluss ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott sich von seinen Engeln verarschen lässt. Hexenküche [Bearbeiten] Mephisto führt Faust in eine Hexenküche, in der ihm ein Zaubertrank verabreicht wird, der ihn verjüngt und ihm jede Frau begehrenswert erscheinen lässt. Faust wehrt sich zunächst, fügt sich dann aber doch, überrumpelt von Mephistos schmeichelnden Worten und der verwirrenden Umgebung in diesem Wust von Raserei. Er trinkt das Zaubergebräu. Nach der Jungbrunnen-Prozedur erblickt er in einem zerbrochenen Spiegel das Idealbild einer Frau und ist von deren Anblick vollkommen verzückt — Oh Liebe, leih mir den schnellsten deiner Flügel und führe mich in ihr Gefild!. Von diesem Bild will er nicht lassen, doch Mephisto führt ihn, unter Hinweis auf zukünftige Liebesfreuden, mit den Worten fort: Du siehst mit diesem Trank im Leibe bald Helenen in jedem Weibe. »Hexenküche« Fausts Verjüngung durch die Magie Hatte Faust in »Auerbachs Keller« schon kein Interesse an Mephistos Zaubereien, so ist er in der »Hexenküche« ein abstandhaltender, fremder Gast (396) und ruft sogar aus: Mir widersteht das tolle Zauberwesen. (397) Agnes Bartscherer sieht darin eine deutliche Wendung Fausts gegen schwarze Magie. Stattdessen vertraue er auf die natürliche Magie: Hat die Natur und hat ein edler Geist/Nicht irgend einen Balsam ausgefunden? (398) Da es jedoch nicht möglich ist, die Verjüngung auf natürlichem Wege zu erreichen, willigt Faust schließlich ein, einen Zauber zu gebrauchen. Noch vor der Verjüngung sieht Faust das Bild Helenas im Zauberspiegel der Hexe. Mephisto verspricht ihm: Du siehst, mit diesem Trank im Leibe,/Bald Helenen in jedem Weibe. (399) In der Forschung ist es umstritten, ob die magische Erscheinung in dem Spiegel als Vorgriff auf Faust II Helena darstellt, Eva oder ein Idealbild der Frau als solcher. (400) Daß es Gretchen ist, wird allgemein nicht angenommen. (401) Wilhelm Resenhöfft ist dagegen der Meinung, daß es sich um Gretchen handelt (401a). Sieht man in der Erscheinung Helena und berücksichtigt weiter den Ausspruch Mephistos, so ist es indirekt in jedem Fall Gretchen, der Faust in der folgenden Szene dann zum ersten Mal begegnen wird. Sie wird nicht direkt benannt, Faust wird sie auch nicht wiedererkennen, aber bei der Begegnung wird sie wegen des Zaubertrankes für Faust aussehen wie eine Helena. In jedem Fall aber wird Faust hier auf magische Weise seine Zukunft prophezeit. In der »Hexenküche« greift Goethe das Motiv des Teufelspaktes auf, wie es die kirchliche Hexenlehre beschreibt: Die Hexe hat sich dem Teufel als ihrem Herrn und Meister (402) verschrieben. Verjüngung und Hexen-Einmal-Eins Fausts Verjüngung in der Hexenküche stellt nach der Wette mit Mephisto einen zweiten Wende- wie auch Höhepunkt der Tragödie dar: Faust beginnt ein neues Leben, geführt von Mephisto, und versucht nun, das zu finden, was ihm bisher versagt geblieben ist. Nachdem er auf dem geistigen Weg, dem Weg der Erkenntnis, gescheitert zu sein scheint, zumindest aber an einem vorläufigen Endpunkt angekommen ist, beschreitet er nun den Weg des Weltlichen: In einem neuen Leben, mit einer zweiten Jugend ausgestattet, legt er mit dem Alter auch das Alte ab und beginnt noch einmal von vorn. Erich Schmidt schreibt in seiner Einleitung zur Jubiläumsausgabe: Die Erotik des ersten und des zweiten Teils wird durch die Hexenküche eingeleitet [.]. (403) Die »Hexenküche« stellt damit den Auftakt zur Gretchentragödie dar. Durch die magische Verjüngung wird es Faust möglich, Gretchens Liebe zu gewinnen. (404) Die Verjüngung ist notwendig, um dem sehr jungen Gretchen (405) in der Szene »Strasse« nicht einen greisen Faust gegenübertreten zu lassen. Erreicht werden kann sie aber nur durch Zauberei, durch Magie, wie Mephisto ironisch deutlich macht: Auf achtzig Jahr dich zu verjüngen! (406) ist natürlich keine Alternative für Faust, also muß denn doch die Hexe dran. (407) Die Verjüngung wird ermöglicht durch einen Trank, für dessen Zubereitung die Hexe viel Zeit und ganz bestimmte Zutaten braucht, so daß es Mephisto kaum möglich ist, den Trank selbst zu brauen. Der Trank darf allerdings nur im Rahmen einer bestimmten Zeremonie eingenommen werden. Zur Unterstützung der Prozedur spricht die Hexe das Hexen-Einmal-Eins (408). Es beschreibt ein unvollständiges magisches Zahlenquadrat. (409) Solchen Quadraten, deren Zeilen sowie Spalten immer denselben Wert ergeben, wird in der Magie eine besondere Wirkung zugeschrieben. Agrippa von Nettesheim gibt in De occulta philosophia für jeden Planeten ein Zahlenquadrat an, welches bei einer magischen Verrichtung Verwendung finden kann. (410) Entsprechend gibt es auch Buchstabenquadrate. (411) Agrippa führt entsprechend zu den Zahlenquadraten z.B. hebräische Buchstabenquadrate an. Albrecht Schöne allerdings sieht das Hexeneinmaleins im Faust zweifellos als Nonsens, als eine in sich sinnlose, verdeckten Sinn nur vortäuschende Karikatur (412) an. Mephistos Erklärung Sie muß als Arzt ein Hokuspokus machen (413) erinnert an eine durch Astronomie bzw. Mathematik, also himmlische Magie (414) verstärkte magia naturalis. Die Sator-Arepo-Formel von Thomas Arnt Dieser Artikel war zuvor Bestandteil des Faust-Lexikons und ist hier aktualisiert und erweitert. Im Mittelalter sehr weit verbreitet und schon aus der Antike bekannt war diese Formel, die, auf einem Zettel notiert, einem Amulett oder Talisman beigelegt wurde. Sie stellt ein magisches Quadrat dar: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS Die Formel kann in vier Richtungen gelesen werden: Zeilenweise oben beginnend von links nach rechts oder unten beginnend von rechts nach links gelesen ergibt sich der gleiche Text wie spaltenweise links beginnend von oben nach unten oder rechts beginnend von unten nach oben. Wörtlich bedeutet die Formel Der Sämann Arepo (Eigenname?) hält mit Mühe die Räder. Wegen der weiten Verbreitung erstmals bezeugt ist die Formel 79 n.Chr. wurde allerdings viel über eine verschlüsselte Bedeutung spekuliert: PETRO ET REO PATET ROSA SARONA (dem Petrus, obwohl er der Schuldige ist, steht die saronische Rose offen) SAT ORARE POTEN(TER) ET OPERA(RE) RA(TI)O T(U)A S(IT) (Lebensregel der Benediktiner, in Klammern die Buchstaben, die die Formel nicht enthält) Eine weitere Deutung besagt, dass die Formel eine Spielerei mit den Namen der drei hl. Könige sei: ATOR, SATOR, PERATORAS Ein weiteres bekanntes magisches Quadrat stellte im Mittelalter das folgende dar: SATAN ADAMA TABAT AMADA NATAS Weitere Verwendung fanden neben Buchstaben- auch Zahlenquadrate (Hexen-Einmaleins) sowie biblische Textstellen, die oft mit christlichen oder magischen Zeichen wie Pentagrammen ergänzt wurden. Bei Agrippa von Nettesheim (De occulta philosophia, s. KAP. 1.4.3) findet sich z.B. ein Zahlenquadrat, das alle Zahlen von 1 bis 9 genau ein Mal enthält. Die Zahlen sind so angeordnet, dass die Zeilen, Spalten und Diagonalen immer die Summe 15 ergeben: 4 9 2 3 5 7 8 1 6 Man kann in der Deutung des Zahlenquadrates sogar noch weiter gehen und feststellen, dass die Quersumme von 15 (1 5) 6 ergibt. Amulette und Talismane dienten dem Schutz vor Krankheiten, zumeist in Gestalt von bösen Geistern, oder sie sollten die Geschicke günstig stimmen und die Zukunft positiv beeinflussen, z.B. bei einer Eheschließung.