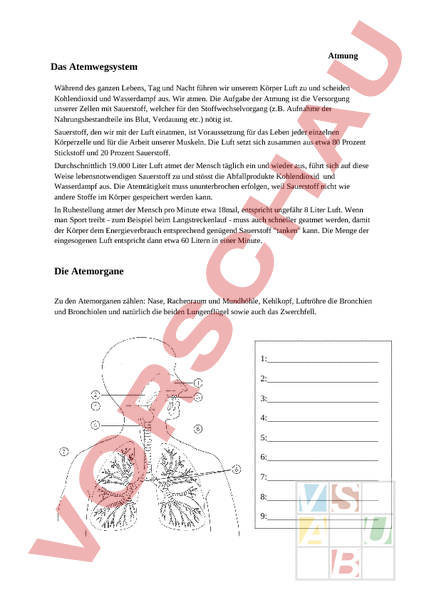Arbeitsblatt: Atmung Mensch
Material-Details
Atmung Mensch, Beschrieb der einzelnen Organe und deren Funktion
Biologie
Anatomie / Physiologie
7. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
64330
1869
90
26.07.2010
Autor/in
dinu (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Atmung Das Atemwegsystem Während des ganzen Lebens, Tag und Nacht führen wir unserem Körper Luft zu und scheiden Kohlendioxid und Wasserdampf aus. Wir atmen. Die Aufgabe der Atmung ist die Versorgung unserer Zellen mit Sauerstoff, welcher für den Stoffwechselvorgang (z.B. Aufnahme der Nahrungsbestandteile ins Blut, Verdauung etc.) nötig ist. Sauerstoff, den wir mit der Luft einatmen, ist Voraussetzung für das Leben jeder einzelnen Körperzelle und für die Arbeit unserer Muskeln. Die Luft setzt sich zusammen aus etwa 80 Prozent Stickstoff und 20 Prozent Sauerstoff. Durchschnittlich 19.000 Liter Luft atmet der Mensch täglich ein und wieder aus, führt sich auf diese Weise lebensnotwendigen Sauerstoff zu und stösst die Abfallprodukte Kohlendioxid und Wasserdampf aus. Die Atemtätigkeit muss ununterbrochen erfolgen, weil Sauerstoff nicht wie andere Stoffe im Körper gespeichert werden kann. In Ruhestellung atmet der Mensch pro Minute etwa 18mal, entspricht ungefähr 8 Liter Luft. Wenn man Sport treibt zum Beispiel beim Langstreckenlauf muss auch schneller geatmet werden, damit der Körper dem Energieverbrauch entsprechend genügend Sauerstoff tanken kann. Die Menge der eingesogenen Luft entspricht dann etwa 60 Litern in einer Minute. Die Atemorgane Zu den Atemorganen zählen: Nase, Rachenraum und Mundhöhle, Kehlkopf, Luftröhre die Bronchien und Bronchiolen und natürlich die beiden Lungenflügel sowie auch das Zwerchfell. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: Kehlkopf Der Kehlkopf trennt die Atemwege von den Speisewegen. Er setzt sich aus vier Knorpeln zusammen, die durch Muskeln und Bänder zusammengehalten werden. Der größte von ihnen ist der Adamsapfel, vorn am Hals deutlich ertastbar. An ihm und an einem Paar kleinerer Knorpel sind die Stimmbänder befestigt, die durch Luftströme in Schwingungen geraten und uns auf diese Weise die Stimmbildung ermöglichen. Wenn du schluckst, ist der Kehldeckel geschlossen (deckt er die Luftröhre zu). Was passiert, wenn du bei geschlossenem Kehldeckel trotzdem zu atmen versuchst Luftröhre Die etwa zwölf Zentimeter lange Luftröhre schließt an den Kehlkopf an und verzweigt sich in Höhe des vierten Brustwirbels zu den beiden Hauptbronchien. Das elastische und muskulöse Gewebe der Röhre wird von 16-20 hufeisenförmigen Knorpelspangen gestützt und ist innen von einer Schleimhaut mit Flimmerhärchen überzogen. Die Flimmerhäärchen transportieren Staubteilchen, die mit der Atemluft eindringen, zurück in den Halsrachen. Dort können sie dann ausgehustet werden. Bronchien Beide Hauptbronchien zweigen wie die Äste eines Baumes von der Luftröhre ab. Sie verästeln sich weiter in Lappenbronchien, in Segmentbronchien und schließlich in kleinere Bronchiolen, die in den Luftsäckchen (Alveolen) münden. Manchmal werden sie auch Lungenbläschen genannt. Da der Körper den Sauerstoff aus der Luft ins Blut aufnimmt, hat es in der Lunge entsprechend viele kleinste Blutgefässe, die Lungenarterien (welche den Sauerstoff „bringen) und Lungenvenen (welche das Kohlendioxid „entsorgen). Weil sie so klein und dünn sind, werden sie Haargefässe oder auch Kapillaren genannt. Sie reichen bis zu den Lungenbläschen, dort findet der Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid statt. Lunge Das weit verzweigte Röhrennetzwerk der beiden Lungen nimmt den größten Teil des Brustraumes ein. Die linke Lunge, die aus dem Ober- und dem Unterlappen besteht, ist kleiner als die rechte Lunge, bei der noch ein dritter Lungenlappen hinzukommt. Die innere Oberfläche der Lunge beträgt insgesamt ungefähr 70 Quadratmeter also etwa die Größe eines Squashplatzes! In jedem Lungenflügel befinden sich an die 300 Millionen Alveolen (Lungenbläschen), die sich um die Bronchiolen herum gruppieren. Sie werden von Kapillaren (Haargefässen) versorgt und bilden zusammen die riesige Fläche, die nötig ist, damit die Lunge ihre Aufgabe erfüllen kann: das beim Verbrennen von Sauerstoff (Stoffwechsel z.B. Nährstoffe) entstehende Kohlendioxid nach außen zu transportieren. Der Sauerstoff gelangt über die oberen Atemwege (Nase, Mundhöhle, Kehlkopf) durch die Luftröhre zu den Bronchien und weiter über die Bronchiolen bis in die Alveolen (Lungenbläschen). Luft wird durch die Atemorgane bis in die Lunge eingeatmet. Diesen Vorgang bezeichnet man auch als äussere Atmung. In den Alveolen nun findet der Gasaustausch mit dem umliegenden Netz aus kleinsten Blutgefässen statt, dem Kapillarnetz. Der Sauerstoff aus der Luft gelangt durch die sehr dünne Haut der Alveolen ins Blut, das Kohlendioxid (welches beim vorherigen Atemzug entstanden ist) wird durch diese dünne Haut in die Alveolen zurückgegeben und durch die Atemwege (Bronchiolen, Bronchien, Luftröhre.) wieder ausgeatmet. Dieser Vorgang, bei dem nur der Sauerstoff aus der Luft verbraucht wird nennt man innere Atmung. Übrigens: Wenn wir Sport treiben, gelangen bis zu 30 Prozent mehr Sauerstoff in unser Gehirn – was auch eine Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit bedeutet. Insgesamt bestimmen zwei Teilprozesse den Vorgang, den wir Atmung nennen: die Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft in die Lunge (Einatmen) und die Abgabe von Kohlendioxid aus der Lunge an die Umwelt (Ausatmen) äussere Atmung der Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid in den Alveolen sowie der Transport der Gase im Blut von den Alveolen zu den Körperzellen und umgekehrt. innere Atmung Die innere Atmung kann auch geschehen, wenn wir z.B. beim Gehen oder Laufen oder Tauchen für einige Zeit die Luft anhalten. Die äussere Atmung hingegen wird mit dem Luft anhalten unterbrochen. Das Zwerchfell Zwerchfell Am Atemvorgang ist in erster Linie das Zwerchfell beteiligt der wichtigste Atemmuskel. Beim Zwerchfell handelt es sich um eine dünne, gewölbte Muskelplatte, die den Brustraum vom Bauchraum trennt. Oberhalb des Zwerchfells befinden sich Herz und Lunge, unterhalb davon Leber Magen und Milz. Beim Einatmen ziehen sich die Zwerchfellmuskeln zusammen, wodurch das Zwerchfell tiefer in den Bauchraum tritt und damit den Brustraum vergrössert. Man könnte sagen, es wird eine Art Vakuum im Brustraum gebildet. Jetzt können sich die Lungenflügel ausdehnen und Luft einsaugen. In den Alveolen erfolgt durch die dünne Haut der Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid. Beim Ausatmen erschlafft das Zwerchfell und tritt wieder höher in den Brustraum hinauf – man könnte sagen, der Zwerchfellmuskel presst die Lungen zusammen und die Atemluft strömt wieder aus. Dieses Phänomen kann mit folgendem Versuch veranschaulicht werden: