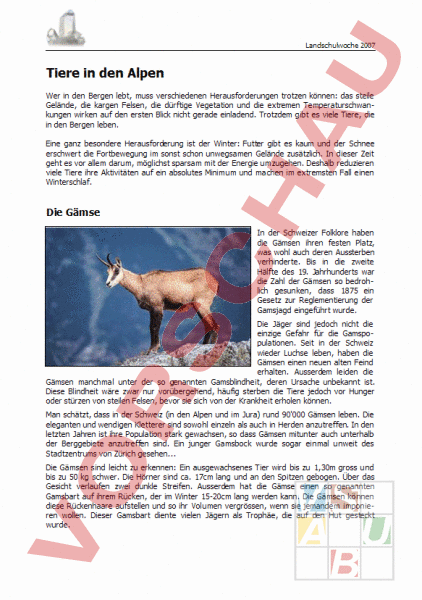Arbeitsblatt: Tiere in den Alpen
Material-Details
Info-Text und Bilder zu den bekanntesten Tieren in den Alpen.
Biologie
Tiere
5. Schuljahr
7 Seiten
Statistik
6719
1837
48
05.05.2007
Autor/in
Thomas Christinat
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Landschulwoche 2007 Tiere in den Alpen Wer in den Bergen lebt, muss verschiedenen Herausforderungen trotzen können: das steile Gelände, die kargen Felsen, die dürftige Vegetation und die extremen Temperaturschwankungen wirken auf den ersten Blick nicht gerade einladend. Trotzdem gibt es viele Tiere, die in den Bergen leben. Eine ganz besondere Herausforderung ist der Winter: Futter gibt es kaum und der Schnee erschwert die Fortbewegung im sonst schon unwegsamen Gelände zusätzlich. In dieser Zeit geht es vor allem darum, möglichst sparsam mit der Energie umzugehen. Deshalb reduzieren viele Tiere ihre Aktivitäten auf ein absolutes Minimum und machen im extremsten Fall einen Winterschlaf. Die Gämse In der Schweizer Folklore haben die Gämsen ihren festen Platz, was wohl auch deren Aussterben verhinderte. Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Zahl der Gämsen so bedrohlich gesunken, dass 1875 ein Gesetz zur Reglementierung der Gamsjagd eingeführt wurde. Die Jäger sind jedoch nicht die einzige Gefahr für die Gamspopulationen. Seit in der Schweiz wieder Luchse leben, haben die Gämsen einen neuen alten Feind erhalten. Ausserdem leiden die Gämsen manchmal unter der so genannten Gamsblindheit, deren Ursache unbekannt ist. Diese Blindheit wäre zwar nur vorübergehend, häufig sterben die Tiere jedoch vor Hunger oder stürzen von steilen Felsen, bevor sie sich von der Krankheit erholen können. Man schätzt, dass in der Schweiz (in den Alpen und im Jura) rund 90�00 Gämsen leben. Die eleganten und wendigen Kletterer sind sowohl einzeln als auch in Herden anzutreffen. In den letzten Jahren ist ihre Population stark gewachsen, so dass Gämsen mitunter auch unterhalb der Berggebiete anzutreffen sind. Ein junger Gamsbock wurde sogar einmal unweit des Stadtzentrums von Zürich gesehen. Die Gämsen sind leicht zu erkennen: Ein ausgewachsenes Tier wird bis zu 1,30m gross und bis zu 50 kg schwer. Die Hörner sind ca. 17cm lang und an den Spitzen gebogen. Über das Gesicht verlaufen zwei dunkle Streifen. Ausserdem hat die Gämse einen so genannten Gamsbart auf ihrem Rücken, der im Winter 15-20cm lang werden kann. Die Gämsen können diese Rückenhaare aufstellen und so ihr Volumen vergrössen, wenn sie jemandem imponieren wollen. Dieser Gamsbart diente vielen Jägern als Trophäe, die auf den Hut gesteckt wurde. Landschulwoche 2007 Der Steinbock In der Schweiz leben noch rund 15�00 Steinböcke. Dies ist nicht selbstverständlich, denn in der ersten Hälfte des Jahrhunderts waren sie bis zur Ausrottung gejagt worden. Der Hauptgrund lag darin, dass der ganze Körper des Steinbocks zur Herstellung von allen möglichen (Wunder-) Mitteln gegen alle möglichen Leiden verwendet wurde. Im Kanton Graubünden, also dem Kanton, dessen Wappen (seit1457) ein Steinbock ziert, gab es bereits im 17. Jahrhundert keine Steinböcke mehr. Wieder angesiedelt wurde der Steinbock zwischen 1920-1934 im Schweizer Nationalpark im Kanton Graubünden. Heute sind abgesehen vom Nationalpark auch in den Kantonen Wallis und Bern Steinböcke anzutreffen. Alle Steinböcke, die heute in der Schweiz leben, sind Nachfahren der zwischen 1920-1934 angesiedelten Tiere. Steinböcke können bis zu 100kg schwer und einen Meter gross werden. Sie haben zwei grosse, gebogene und gerippte Hörner. Das Alter der Tiere kann an der Anzahl Rippen abgelesen werden: normalerweise wachsen die Hörner pro Jahr um zwei Rippen. Die Hörner können bis zu einem Meter lang und bis zu 10kg schwer werden. Die Hufe der Steinböcke sind dem Gelände perfekt angepasst: sie haben aussen einen harten Rand und innen weiche, haftende Ballen, die auch in steilstem Gelände einen guten Halt ermöglichen. Ein Steinbock kann aus dem Stand mehrere Meter hoch und weit springen. Förster lieben die Steinböcke nicht besonders: diese fressen nicht nur die Jungtriebe ab, sondern fegen gerne an vorwiegend kleineren, verletzlichen Bäumen den Bast von den Hörnern. Dadurch wird die Rinde oft erheblich verletzt, was den Flüssigkeitstransport unterbrechen und zum Absterben der Bäume führen kann. So können Steinböcke ganze Projekte zur Aufforstung als Schutz vor Lawinen gefährden. Landschulwoche 2007 Das Murmeltier Im Sommer sieht man Murmeltiere ziemlich oft. Noch häufiger sind sie jedoch zu hören: wenn Gefahr droht, pfeifen sie nämlich unüberhörbar, um ihre Artgenossen zu warnen, worauf sich diese augenblicklich in ihre Bauten zurückziehen. Murmeltiere leben in Familien von bis zu 15 Mitgliedern. Ihre Höhlen bauen sie auf offenem Feld. Die Murmeltier-Bauten sind in einem ausgeklügelten System miteinander verbunden. Wenn die Murmeltiere an die Oberfläche kommen, um zu fressen, steht immer eines Wache. Die gefährlichsten Feinde sind Raubvögel und Füchse. Die Murmeltiere sind sehr anpassungsfähig: in Gebieten, die von vielen Wanderern besucht werden, betrachten ältere Murmeltiere die Menschen nicht mehr als Bedrohung. Murmeltiere leben vorwiegend in den Alpen. Ihre Hauptbeschäftigung ist die Suche nach Futter. Im Sommer und Herbst müssen sie sich buchstäblich einen Fettvorrat für den Winterschlaf anfressen. Sie können ihr Gewicht in dieser Zeit verdoppeln (auf ca. 8kg). Während des Winterschlafs, der etwa sechs Monate dauert, sinkt ihre Körpertemperatur auf fünf Grad. Die Murmeltiere wachen erst wieder auf, wenn der Schnee taut. Die Alpendohle Die schwarz gefiederten Alpendohlen mit ihren gelben Schnäbeln kann man in der Schweiz fast auf jeder Bergwanderung bewundern. Von den Amseln unterscheiden sie sich durch ihre Grösse und die orangen Beine. Alpendohlen leben im Gebirge bis in Höhen von über 4000 m.ü.M. Sie sind akrobatische Segelflieger und treiben oft in grösseren Trupps in den Aufwinden an Bergspitzen und Abstürzen. Dabei können sie beim abwärts Sausen mit angelegten Flügeln ohne weiteres Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h erreichen. Landschulwoche 2007 Obwohl Alpendohlen Bergwanderern und Skifahrern wohl bekannt sind, weiss man wenig über ihr Leben. Während der Brutzeit ab März dulden sie keine anderen Nester im Umkreis von 50 Metern, schliessen sich jedoch ausserhalb des Nestbereiches sofort zu grösseren Schwärmen zusammen. Die Nester werden in Felshöhlen und –spalten gebaut. Altvögel bleiben dem einmal gewählten Brutplatz ganzjährig treu, während Jungvögel in einem grösseren Raum von Kolonie zu Kolonie umherstreichen. Alpendohlen ernähren sich im Sommerhalbjahr hauptsächlich von Insekten, im Winter von Beeren, Samen und Abfällen. Oft können sie auf der Suche nach Essensresten in der Nähe von Bergrestaurants beobachtet werden, da sie keinesfalls scheu sind und manchmal sogar aus der Hand fressen. Der Tannenhäher Der Tannenhäher spielt eine wichtige Rolle im Lebenskreislauf der Arve (Zirbelkiefer), einem Nadelbaum, der in den Zentralalpen oberhalb von 1100m wächst. Der Tannenhäher ist ca. 30cm lang und wiegt zwischen 150 und 210g. Im Winter ernährt er sich hauptsächlich von Kiefernsamen. Diese Samen vergräbt er im ganzen Wald, wobei er beim Verstecken auf ideale Wachstumsbedingungen schaut: aus den Samen, die der Tannenhäher im Winter nicht frisst, wachsen dann neue Arven. So sichert der Tannenhäher den Fortbestand der Arvenpopulation und damit auch die Nahrungsgrundlage für seine Spezies. Der Tannenhäher hat einen ganz speziellen Schnabel: Dank seiner Unterschnabelleiste kann er im Schnabel Samen festhalten, mittels Schütteln auf ihre Güte prüfen und schliesslich aufknacken. Gute Samen werden für den Transport in einem Kehlsack deponiert. Bis zu 80 Kiefernsamen oder 20 Haselnüsse kann der Häher so transportieren, ohne dass seine Flugtauglichkeit beeinträchtigt wird. Im Winter gräbt der Tannenhäher bis zu 130 cm tiefe Löcher durch den Schnee, um zu den angelegten Vorräten zu gelangen. Landschulwoche 2007 Der Steinadler Der Steinadler ist einer der grössten Raubvögel in der Schweiz. Die Spannweite seiner Flügel kann bis zu 2,2m betragen. Der Steinadler ernährt sich hauptsächlich von Säugetieren wie Hasen, Murmeltieren und Füchsen sowie von Aas. Die Sehkraft der Steinadler (Adlerauge) ist aussergewöhnlich gut entwickelt: so können sie einen Hasen aus einem Kilometer Entfernung sehen. Die Adler leben bevorzugt in offenem oder halboffenem Gelände auf einer Höhe von etwa 1500 3000m. Ihre Nester (Horste) bauen sie unterhalb der Baumgrenze auf Felsvorsprüngen oder etwas seltener auf hohen Bäumen. Jedes Adlerpaar baut mehrere Horste. Die Adlerpaare sind ein Leben lang zusammen und beherrschen ein Territorium von 50 100 km2. In der Schweiz gibt es schätzungsweise 300 Brutpaare, die in den Alpen und Voralpen leben. Man erwartet, dass sie sich auch im Jura ansiedeln werden. Im französischen Jura wurden bereits erste Adler gesichtet. Der Steinadler gehört in der Schweiz seit 1953 zu den geschützten Tieren. Landschulwoche 2007 Der Bartgeier Der Bartgeier ist ein beeindruckend grosser Vogel. Die Spannweite seiner Flügel ist mit bis zu drei Metern noch grösser als diejenige des Steinadlers. Seinen Namen hat der Bartgeier von den schwarzen Borsten, die an seinem Schnabel hängen. Sein Federkleid ist aussergewöhnlich: in Freiheit lebende Bartgeier ändern die ursprüngliche Farbe ihrer Federn, indem sie in eisenhaltigem Wasser baden. So werden die weissen Partien rostbraun, was für die Tarnung wichtig ist. Auch die Nahrung ist speziell: sie besteht vorwiegend aus blanken Knochen. Dank des elastischen Schlunds können Bartgeier auch grosse Knochen (bis zur Grösse einer Rinder-Wirbelsäule) ganz schlucken. Sind die Knochen zu gross, werden sie 50 80m in die Höhe getragen und fallen gelassen, damit sie in schlundgerechte Stücke zerbrechen und verschluckt werden können. Eine weitere Besonderheit ist das Brutverhalten. Es wird nicht nur paarweise sondern auch zu dritt (zwei Männchen, ein Weibchen) gebrütet. Diese Gruppen (ob nun Paar oder Dreierbeziehung) bleiben während der gesamten Brutzeit zusammen und betreuen ihr Nest. Der Grund für die Dreierbetreuung ist unklar. Eine Theorie besagt jedoch, dass es für zwei Männchen einfacher ist, das Nest zu verteidigen. Es gibt häufig Kämpfe um die besten Plätze, und häufig übernehmen Bartgeier Horste, die von Adlern gebaut worden sind. Das Weibchen legt normalerweise zwei Eier. Das zweite Junge schlüpft etwa eine Woche nach dem ersten und ist viel kleiner als sein Geschwister. Es dient eigentlich nur als Reserve für den Fall, dass dem Grösseren etwas zustösst. Wenn das Futter knapp wird, kommt es vor, dass es vom Erstgeborenen getötet wird. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschwand der Bartgeier aus den Alpen. Erstens wurde das Futter (Wild und Ziegen) seltener und zweitens wurde er von den Bauern verfolgt, die der Ansicht waren, dass Bartgeier Schafe und sogar Säuglinge ässen. Die Wiederansiedlung des Bartgeiers erfolgte gegen Ende des 20. Jahrhunderts im Rahmen eines sorgfältig ausgearbeiteten Programms, das neben der Schweiz auch Österreich, Frankreich, Italien und Deutschland einbezog. Die ersten Bartgeier wurden 1987 in Österreich ausgesetzt. In der Schweiz wählte man den Nationalpark im Kanton Graubünden für die Wiederansiedlung der Bartgeier, die riesige Distanzen überwinden können: einer der Bartgeier, die 1987 in Österreich ausgesetzt worden waren, lebte ein Jahr später rund 600 km entfernt in Frankreich. Landschulwoche 2007 Das Birkhuhn Der Birkhahn ist eine eindrückliche Erscheinung mit seinem blauschwarzen Gefieder und dem gegabelten Schwanz. Die Henne ist weniger auffällig: sie ist viel kleiner und hat ein braungraues bis gelbbraunes Tarngefieder. Das Birkhuhn lebt bevorzugt in den Voralpen und Alpen auf 1200 bis 2200 Metern über Meer. Die Birkhühner sind für die Kälte bestens ausgerüstet. Im Winter beschränken sie ihre Aktivität auf ein absolutes Minimum. Die langen Ruhephasen verbringen sie in Schneehöhlen, deren Eingänge sie mit dem aufgescharrten Schnee verschliessen. Die gute Isolationswirkung der im Schnee eingeschlossenen Luft und die Körperwärme des Vogels sorgen dafür, dass es in der Höhle relativ warm bleibt. Ihre Höhlen verlassen sie nur, um Nahrung zu suchen. Ebenfalls eine gute Isolation bietet das Gefieder, in dem Luft eingelagert ist. Ausserden schützen die Federn an den Nüstern (wärmen die Atemluft) und an den Füssen (verhindern ein zu tiefes Einsinken in den Schnee) vor Kälte und Schnee. Der Bergsalamander Die faszinierenden Anpassungsstrategien des Bergsalamanders sind rekordverdächtig: er ist nicht nur die einzige europäische Amphibie, die lebende Junge zur Welt bringt (also keine Eier legt), sondern die Jungen können bis zu drei Jahre im Mutterleib heranwachsen. Bei den schwierigen Lebensbedingungen in den Bergen ist es wichtig, dass die Jungen gut entwickelt geboren werden. Der Bergsalamander lebt bevorzugt an feuchten Orten (Gebirgswälder) auf bis zu 3�00 Metern über Meer. Er ist schwarz und wird bis zu 16cm lang. Seine Nahrung besteht vorwiegend aus Käfern, Spinnen und Tausendfüsslern.