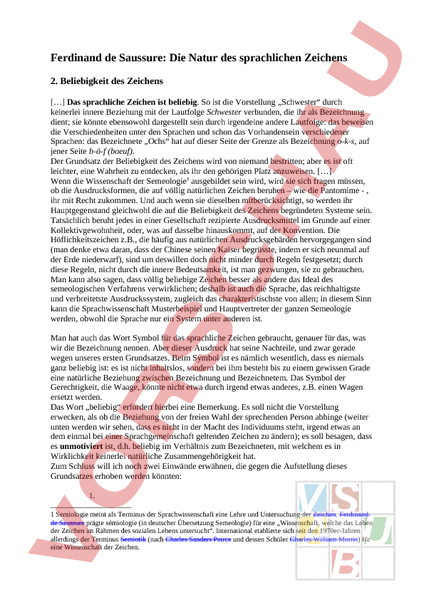Arbeitsblatt: Semiotik-Saussure
Material-Details
Das sprachliche Zeichen. Originaltext mit Aufgabenstellung.
Deutsch
Gemischte Themen
10. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
68999
1224
4
08.10.2010
Autor/in
Ljubica Markic
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Ferdinand de Saussure: Die Natur des sprachlichen Zeichens 2. Beliebigkeit des Zeichens [] Das sprachliche Zeichen ist beliebig. So ist die Vorstellung „Schwester durch keinerlei innere Beziehung mit der Lautfolge Schwester verbunden, die ihr als Bezeichnung dient; sie könnte ebensowohl dargestellt sein durch irgendeine andere Lautfolge: das beweisen die Verschiedenheiten unter den Sprachen und schon das Vorhandensein verschiedener Sprachen: das Bezeichnete „Ochs hat auf dieser Seite der Grenze als Bezeichnung o-k-s, auf jener Seite b-ö-f (boeuf). Der Grundsatz der Beliebigkeit des Zeichens wird von niemand bestritten; aber es ist oft leichter, eine Wahrheit zu entdecken, als ihr den gehörigen Platz anzuweisen. [] Wenn die Wissenschaft der Semeologie1 ausgebildet sein wird, wird sie sich fragen müssen, ob die Ausdrucksformen, die auf völlig natürlichen Zeichen beruhen – wie die Pantomime , ihr mit Recht zukommen. Und auch wenn sie dieselben mitberücksichtigt, so werden ihr Hauptgegenstand gleichwohl die auf die Beliebigkeit des Zeichens begründeten Systeme sein. Tatsächlich beruht jedes in einer Gesellschaft rezipierte Ausdrucksmittel im Grunde auf einer Kollektivgewohnheit, oder, was auf dasselbe hinauskommt, auf der Konvention. Die Höflichkeitszeichen z.B., die häufig aus natürlichen Ausdrucksgebärden hervorgegangen sind (man denke etwa daran, dass der Chinese seinen Kaiser begrüsste, indem er sich neunmal auf der Erde niederwarf), sind um deswillen doch nicht minder durch Regeln festgesetzt; durch diese Regeln, nicht durch die innere Bedeutsamkeit, ist man gezwungen, sie zu gebrauchen. Man kann also sagen, dass völlig beliebige Zeichen besser als andere das Ideal des semeologischen Verfahrens verwirklichen; deshalb ist auch die Sprache, das reichhaltigste und verbreitetste Ausdruckssystem, zugleich das charakteristischste von allen; in diesem Sinn kann die Sprachwissenschaft Musterbeispiel und Hauptvertreter der ganzen Semeologie werden, obwohl die Sprache nur ein System unter anderen ist. Man hat auch das Wort Symbol für das sprachliche Zeichen gebraucht, genauer für das, was wir die Bezeichnung nennen. Aber dieser Ausdruck hat seine Nachteile, und zwar gerade wegen unseres ersten Grundsatzes. Beim Symbol ist es nämlich wesentlich, dass es niemals ganz beliebig ist: es ist nicht inhaltslos, sondern bei ihm besteht bis zu einem gewissen Grade eine natürliche Beziehung zwischen Bezeichnung und Bezeichnetem. Das Symbol der Gerechtigkeit, die Waage, könnte nicht etwa durch irgend etwas anderes, z.B. einen Wagen ersetzt werden. Das Wort „beliebig erfordert hierbei eine Bemerkung. Es soll nicht die Vorstellung erwecken, als ob die Beziehung von der freien Wahl der sprechenden Person abhinge (weiter unten werden wir sehen, dass es nicht in der Macht des Individuums steht, irgend etwas an dem einmal bei einer Sprachgemeinschaft geltenden Zeichen zu ändern); es soll besagen, dass es unmotiviert ist, d.h. beliebig im Verhältnis zum Bezeichneten, mit welchem es in Wirklichkeit keinerlei natürliche Zusammengehörigkeit hat. Zum Schluss will ich noch zwei Einwände erwähnen, die gegen die Aufstellung dieses Grundsatzes erhoben werden könnten: 1. 1 Semiologie meint als Terminus der Sprachwissenschaft eine Lehre und Untersuchung der Zeichen. Ferdinand de Saussure prägte sémiologie (in deutscher Übersetzung Semeologie) für eine „Wissenschaft, welche das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens untersucht. International etablierte sich seit den 1970er-Jahren allerdings der Terminus Semiotik (nach Charles Sanders Peirce und dessen Schüler Charles William Morris) für eine Wissenschaft der Zeichen. 2. Man könnte unter Berufung auf die Onomatopoetika2 sagen, dass die Wahl der Bezeichnung nicht immer beliebig ist. Aber diese sind niemals organische Elemente eines sprachlichen Systems. Ausserdem ist ihre Anzahl viel geringer, als man glaubt. Wörter wie fuet (Peitsche) und glas (Totenglocke) können für manches Ohr einen Klang haben, der an sich schon etwas vom Eindruck der Wortbedeutung erweckt. Dass dies aber jenen Wörtern nicht von Anfang an eigen ist, kann man aus ihren lateinischen Ursprungsformen ersehen (fuet von lat. fagus „Buche, glas classium); der Klang ihrer gegenwärtigen Lautgestalt, in dem man diese Ausdruckskraft zu finden glaubt, ist ein zufälliges Ergebnis ihrer lautgeschichtlichen Entwicklung. Was die eigentlichen Onomatopoetika betrifft (von der Art gou-glou „Gluckgluck, Geräusch beim Einschenken, Tick-tack), so sind diese nicht nur gering an Zahl, sondern es ist auch bei ihnen die Prägung schon in einem gewissen Grad beliebig, da sie nur die annähernde und bereits halb konventionelle Nachahmung gewisser Laute sind (vgl. franz. ouaoua und deutsch wau wau). [] 3. Die Ausrufe, die den Onomatopoetiken sehr nahe stehen, geben Anlass zu entsprechenden Bemerkungen und gefährden unsere These ebensowenig. Man ist versucht, in ihnen einen spontanen Ausdruck des Sachverhalts zu sehen, der sozusagen von der Natur diktiert ist. Aber bei der Mehrzahl von ihnen besteht ebenfalls kein natürliches Band zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem. Es genügt, unter diesem Gesichtspunkt zwei Sprachen zu vergleichen, um zu erkennen, wie sehr diese Ausdrücke von einer zur anderen wechseln (z.B. entspricht deutschem au! Französisches aïe!). Zusammenfassend kann man sagen, die Onomatopoetika und die Ausrufungen sind von sekundärer Wichtigkeit, und ihr symbolischer Ursprung ist z.T. anfechtbar. Aufgabe: Lesen Sie den Text zur Natur des sprachlichen Zeichens und arbeiten Sie anschliessend in Ihrer Gruppe die Kernaussagen heraus. Überlegen Sie sich anschliessend, wie Sie Ihre neuen Erkenntnisse möglichst anschaulich den anderen Gruppen mitteilen könnten. 2 Onomatopoesie (auch Onomatopöie, Onomatopoiie) deutsch Lautmalerei, Tonmalerei, Schallwort, ist die Nachahmung eines Naturlautes oder eines sonstigen aussersprachlichen akustischen Phänomens durch die klanglich als ähnlich empfundene Lautgestalt eines sprachlichen Ausdrucks. Beispiele: „knallen, rumpeln, rauschen, klirren oder Interjektionen: „Huhu, Au.