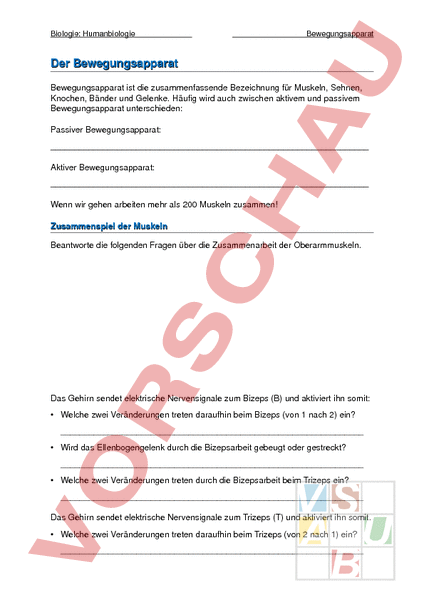Arbeitsblatt: Menschenkunde 9
Material-Details
Bewegungsapparat / Agonist & Antagonist / Gleitfilamentmodell / Muskelfasertypen / Seite 27-32
Biologie
Anatomie / Physiologie
8. Schuljahr
6 Seiten
Statistik
72354
1072
9
04.12.2010
Autor/in
curie (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Biologie: Humanbiologie Bewegungsapparat Der Bewegungsapparat Bewegungsapparat ist die zusammenfassende Bezeichnung für Muskeln, Sehnen, Knochen, Bänder und Gelenke. Häufig wird auch zwischen aktivem und passivem Bewegungsapparat unterschieden: Passiver Bewegungsapparat: Aktiver Bewegungsapparat: Wenn wir gehen arbeiten mehr als 200 Muskeln zusammen! Zusammenspiel der Muskeln Beantworte die folgenden Fragen über die Zusammenarbeit der Oberarmmuskeln. Das Gehirn sendet elektrische Nervensignale zum Bizeps (B) und aktiviert ihn somit: Welche zwei Veränderungen treten daraufhin beim Bizeps (von 1 nach 2) ein? Wird das Ellenbogengelenk durch die Bizepsarbeit gebeugt oder gestreckt? Welche zwei Veränderungen treten durch die Bizepsarbeit beim Trizeps ein? Das Gehirn sendet elektrische Nervensignale zum Trizeps (T) und aktiviert ihn somit. Welche zwei Veränderungen treten daraufhin beim Trizeps (von 2 nach 1) ein? Biologie: Humanbiologie Bewegungsapparat Biologie: Humanbiologie Bewegungsapparat Wird das Ellenbogengelenk durch die Trizepsarbeit gebeugt oder gestreckt? Welche zwei Veränderungen treten durch die Trizepsarbeit beim Bizeps ein? Bizeps und Trizeps werden Gegenspieler genannt. Welche Konsequenz hätte es für den Arm, wenn der Bizeps fehlen würde? Welche Konsequenz hätte es für den Arm, wenn der Trizeps fehlen würde? Also: Agonist, Antagonist Synergist Um eine Bewegung ausführen zu können, ist immer das Zusammenspiel gegensätzlich wirkender Muskeln notwendig. Ein Muskel arbeitet bei einer Bewegung niemals allein. Der Agonist (Spieler), führt eine Bewegung aus, während der Gegenspieler oder Antagonist dafür sorgt, dass die Bewegung in Gegenrichtung erfolgen kann. Beugt z.B. der Bizeps den Unterarm im Ellenbogen, so muss gleichzeitig der Gegenspieler Trizeps gedehnt werden. Soll der Unterarm wieder in eine gerade Position gebracht werden, geht es umgekehrt. Jetzt ist der Trizeps der Agonist, er streckt den Unterarm, während der Bizeps als Antagonist gedehnt wird. Häufig sind an der Ausführung einer Bewegung mehrere Muskeln beteiligt, die in die gleiche Richtung arbeiten. Diese Muskeln werden dann als Synergisten bezeichnet. Sie können ganze Muskelgruppen bilden, z.B. die Gruppe der Bauchmuskeln. Die Gruppe der Rückenmuskeln können als Gegenspieler zur Gruppe der Bauchmuskeln angesehen werden. Gegensätzlichen Muskelgruppen sollten immer ungefähr gleich stark ausgebildet sein. Ungleichgewichte, die sich auch muskuläre Dysbalancen nennen, führen zu Fehlhaltungen. Fehlhaltungen können heftige Schmerzen hervorrufen und sogar dauerhafte Schädigungen herbeiführen. Deshalb werden bei einem ausgewogenen Training und bei rehabilitativen und krankengymnastischen Übungen immer Agonisten und Antagonisten gleichermassen trainiert. Biologie: Humanbiologie Bewegungsapparat Das Gleitfilamentmodell Wie wir bereits gelernt haben, erinnert ein Muskel von innen an ein Kabel, das zusammengesetzt ist aus vielen Tausend einzelnen Leitungsbahnen, den Muskelfasern. Sie sind zu Bündeln zusammengefasst, die auch von einer Bindegewebshülle mit Blutgefässen und Nerven umgeben sind, und können bis zu 40 cm lang werden (im Schneidermuskel des Oberschenkels). Eine Muskelfaser besteht je nach Muskel aus hundert bis mehreren tausend kleineren Funktionseinheiten, den so genannten Muskelfibrillen oder Myofibrillen. Diese wiederum setzen sich aus Hunderten hintereinander geschalteten Baueinheiten zusammen, in denen die Kraft entwickelt wird. Solch ein Kraftwerk des Muskels heisst Sarkomer. Ein Sarkomer ist nur zweieinhalb Mikrometer lang und besteht aus den fadenförmigen Eiweissen (Filamenten) Aktin und Myosin. Da die dünneren Aktinfäden in allen Sarkomeren über die Myosinmoleküle hinausragen, entsteht das quer gestreifte Aussehen, das den Muskeln ihren Namen gab. Ausgelöst durch einen Nervenimpuls, hakt sich das Köpfchen des Myosins an das Aktin, bildet eine Brücke zwischen beiden und macht eine Ruderbewegung – die Muskelfaser zieht sich zusammen. Wenn Aktin und Myosin ihre Verbindung wieder lösen, entspannt sich der Muskel. Die Verkürzung des Muskels kommt also dadurch zustande, dass die Myosin und ActinFilamente in Längsrichtung aneinander vorbei gleiten, sich selber aber in ihrer Länge nicht verändern. Man spricht daher auch vom „Gleitfilamentmodell. Das Zusammenspiel von Aktin und Myosin führt nur zu einer Verkürzung des Sarkomers um einen Mikrometer, also ein tausendstel Millimeter. Diese winzige Veränderung ist mit dem Auge natürlich nicht sichtbar. Doch weil in einer Muskelfaser Hunderttausende Sarkomere blitzschnell aktiviert werden, entsteht eine sichtbare Bewegung. Biologie: Humanbiologie Bewegungsapparat Aufgabe: Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen den Mechanismus einer Muskelkontraktion, allerdings in der falschen Reihenfolge. Sortiere die Abbildungen in der richtigen Reihenfolge. Aufgabe: Die folgenden Abbildungen zeigen die Muskelfasern im entspannten (gedehnten) und angespannten (zusammengezogenen) Zustand. Trage unter die Abbildungen 1 und 2 ein, ob der Muskel angespannt oder entspannt ist und begründe deine Antwort. Biologie: Humanbiologie Bewegungsapparat Aufgabe: In dieser Abbildung ist der Arm eines Sportlers zu sehen. Ordne dem Beuger und Strecker die Abbildungen 1 bzw. 2 zu: Der Beuger zeigt den Zustand aus Abbildung Der Strecker zeigt den Zustand aus Abbildung Muskelfasertypen Bei der quer gestreiften Skelettmuskulatur gibt es zähe und ausdauernde Muskeln, die uns einen langen Spaziergang oder einen Marathonlauf ermöglichen. Andere befähigen uns, grosse und schwere Lasten zu heben, und wieder andere lassen uns kurzfristig schnell laufen und hoch springen. All das geht nicht nur, weil die Muskeln aus sehr vielen Muskelfasern bestehen, sondern auch weil sie aus verschiedenen Arten von Muskelfasern bestehen. Zwar gibt es je nach Betrachtungsweise sehr viele Zwischenstufen, meist wird aber zwischen den nachfolgenden Typen von Muskelfasern unterschieden: So gibt es kleine, rote Muskelfasern (Typ I), die den ganzen Tag über arbeiten können, ohne zu ermüden. Sie sind ausdauernd und mit ihrer Hilfe sind filigrane Tätigkeiten wie das Schreiben möglich. Grosse Kraft können diese Muskelfasern dabei nicht entfalten. Dafür gibt es die grossen, weissen Fasern (Typ II). Sie entwickeln beim Tragen schwerer Lasten kurzzeitig viel Kraft und lassen uns schnell laufen. Ausserdem stehen sie uns blitzschnell zur Verfügung, wenn wir beispielsweise stolpern oder springen. Diese Fasertypen ermüden dafür schneller, weil sie viel schlechter durchblutet sind, wenn sie arbeiten. Beide Fasertypen kommen gemeinsam in den Skelettmuskeln vor und ihr Anteil ist nicht über den gesamten Körper gleich. Beispielsweise besteht die Bauchmuskulatur zum grössten Teil aus roten Muskelfasern, während der Bizeps einen grösseren Anteil an weissen Muskelfasern enthält. Allgemein ist der Anteil an roten, langsam ermüdenden Muskelfasern bei der Stützmuskulatur höher als bei Muskeln, die für schnelle, kraftvolle Bewegungen ausgelegt sind. Biologie: Humanbiologie Bewegungsapparat Im Weiteren bestehen grosse Unterschiede von Mensch zu Mensch bezüglich der Zusammensetzung der Muskelzellen. Diese ist genetisch vorbestimmt und kann nur zu einem begrenzten Teil durch sportartspezifisches Training verändert werden. Muskelwachstum Bei Kindern geht das ruck zuck, denn der Körper stellt jede Menge Wachstumshormone her. Bis zum Alter von ungefähr 20 Jahren wächst der Körper, und mit ihm die Muskeln, wie von selbst. Als Erwachsener ist damit Schluss. Dann muss jeder Muskel trainiert werden, wenn er weiter wachsen soll. Der Körper stellt nicht mehr so viele Wachstumshormone her. Wie gross die Muskeln eines Menschen sind, hängt nicht nur davon ab, wie viel Sport dieser Mensch treibt. Die Grösse seiner Muskeln richtet sich vor allem danach, wie dieser Mensch von Natur aus gebaut ist. Es gibt schmächtige und kräftige, sehnige und dicke, sportliche und weniger sportliche Typen. Alle Spitzensportler zum Beispiel, egal welcher Sportart, haben den richtigen Körperbau von Natur aus mitbekommen, sonst hätten sie es in ihrem Sport nie bis zur Spitze geschafft. Der beste Marathonläufer der Welt kann soviel Hanteltraining machen, wie er will, er wird nie 200 Kilo stemmen. Und umgekehrt: ein Bodybuilder macht das problemlos, aber einen fünfstündigen Waldlauf würde er nicht durchhalten.