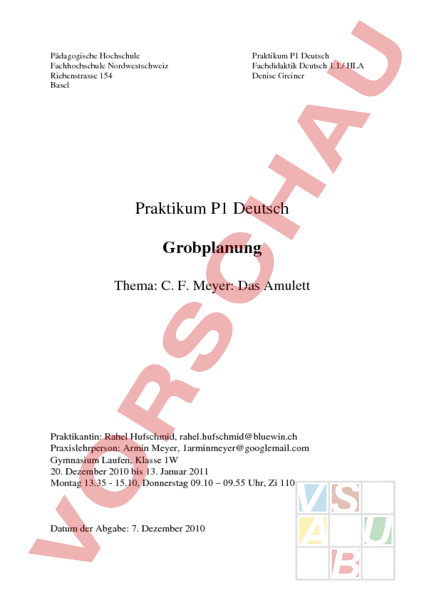Arbeitsblatt: Meyer Amulett Grobplanung UE 8 Lekt
Material-Details
komplette Grobplanung für eine achtstündige Unterrichtseinheit, Material folgt sogleich...
Deutsch
Leseförderung / Literatur
10. Schuljahr
8 Seiten
Statistik
73979
719
3
07.01.2011
Autor/in
Rahel Hufschmid
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz Riehenstrasse 154 Basel Praktikum P1 Deutsch Fachdidaktik Deutsch 1.1./ HLA Denise Greiner Praktikum P1 Deutsch Grobplanung Thema: C. F. Meyer: Das Amulett Praktikantin: Rahel Hufschmid, Praxislehrperson: Armin Meyer, Gymnasium Laufen, Klasse 1W 20. Dezember 2010 bis 13. Januar 2011 Montag 13.35 15.10, Donnerstag 09.10 – 09.55 Uhr, Zi 110 Datum der Abgabe: 7. Dezember 2010 1. Bedingungsanalyse Die Klasse 1W ist laut Angaben der Praxislehrperson eine leistungsstarke, gute Klasse. Dies zeigte sich mir unter anderem beim Besuch der Klasse, als die SuS bei einem Schreibauftrag einfach losgelegt und in kurzer Zeit viel Text angefertigt hatten. Die Klasse besteht aus 23 SuS. Zwei davon sind Gastschüler aus Ungarn und Indien, die noch wenig deutsch verstehen, aber durch ihre guten Englischkenntnisse trotzdem Anschluss an die MitschülerInnen gefunden haben und von ihnen mitgetragen werden. Im Deutschunterricht laufen sie einfach mit, sie verstehen einiges und erledigen die Aufgaben auf ihre Art: Der ungarische Gastschüler beispielsweise hat in der Hospitationslektion die Schreibaufgabe auf Ungarisch gelöst. Das Schulzimmer ist gut ausgerüstet, aber sehr eng für 23 SuS. Es bietet viele technische Hilfsmittel (PC und Beamer, OHP und Wandtafel) und genügend Platz an den Wänden für Bilder oder ähnliches. Ausserdem stehen viele Nachschlagewerke (z.B. Kindler Literaturlexikon) im Zimmer bereit. 2. Sachanalyse Das Thema der acht Lektionen ist die Novelle Das Amulett von Conrad Ferdinand Meyer. Die 1872/73 entstandene Novelle lässt sich dem poetischen Realismus zuordnen, dessen Wirklichkeitsnachbildung sich vom französischen Realismus und von journalistischen Berichten der Zeit dadurch unterscheidet, „dass sie die Realität verklärt, sich durch die Subjektivität der Erzählperspektive auszeichnet und weithin auf den Einbezug extremer Wirklichkeit (z.B. des abstossend Hässlichen) verzichtet. 1 Die subjektive Sichtweise des IchErzählers Hans Schadau im Amulett ist prägend, v.a. bei dessen Beschreibung der Figur Wilhelm Boccard ist eine Diskrepanz zwischen der Schilderung durch Schadau (eher naiv, lästig) und der möglichen Einschätzung des Lesers aufgrund der Taten Boccards (hilfsbereit, treu, aufopfernd) auffällig. Formal lässt sich das Werk als historische Novelle bezeichnen. Die in der Novelle erzählten Ereignisse geschehen zur Zeit der französischen Glaubenskriege im 16. Jahrhundert, der sog. Hugenottenkriege. Der Leser/die Leserin wird aufgrund des Aufbaus mit einer doppelten Rahmenhandlung Schritt für Schritt in die vergangene Zeit hineingeführt. Kann der erste Teil der Rahmung (Vorrede) als in der Zeit des Autors geschrieben, und damit als eine bewusste Distanznahme des Autors von seinem Text durch die Erfindung eines fiktiven Erzählers, der historisch belegte Tatsachen niederschreibt, gesehen werden, so führt die zweite 1 Metzler Literaturlexikon, Begriffe und Definitionen, hrsg. von Günther und Irmgard Schweikle, 2., überarb. Aufl., Stuttgart: Metzler 1990, S. 377. 1 Rahmenhandlung (1. Kapitel) den Leser ins frühe 17. Jahrhundert. Hans Schadau wird als Verfasser der „vergilbten Blätter (des Manuskripts) vorgestellt, und dieser wiederum führt als Erzähler den Leser/die Leserin in seine persönliche Vergangenheit im 16. Jahrhundert zurück. Im Verlauf der Geschichte erlebt der Protagonist die religiösen Konflikte des 16. Jahrhunderts zwischen Calvinisten und Katholiken mit dem Höhepunkt der Bartholomäusnacht vom 23. zum 24. August 1572 in Paris. Die Religionskonflikte der Zeit und die ihnen speziell in Paris zugrunde liegenden historischen Hintergründe bilden demnach einen wichtigen Themenkreis der Novelle und werden dadurch, dass die beiden Protagonisten Schadau und Boccard der jeweils anderen Religionsgemeinschaft angehören, auf engstem Raum als Abbild der historischen Wirklichkeit oder als Verdoppelung dargestellt. Hervorzuheben ist hier dennoch die Verbundenheit der beiden Hauptakteure, einerseits durch ihre gleiche Nationalität als Schweizer (in Paris) und andererseits durch die Verstrickung ihres jeweiligen Schicksals mit und durch das Amulett, das Medaillon mit dem Abbild der Jungfrau Maria von Einsiedeln. Die Rolle dieses Amuletts bildet ein diskussionswürdiges Element dieser Novelle. Ist es der Prüfstein für die Frage innerhalb der religiösen Debatte über Wunderwerke Gottes vs. Prädestination, so gibt der Text keine eindeutige Antwort. Es rettet zwar Schadau (und zwar auf ganz unmystische Art), nicht aber Boccard. Welche Rolle spielt es überhaupt und warum ist die ganze Erzählung nach ihm benannt? Diesen Fragen gilt es nachzugehen, will man ein tieferes Verständnis für das Werk Meyers finden. Eine Szene, die irgendwie so gar nicht in die Novelle passen will, ist die Traumsequenz (S. 59f). Sie gilt es dennoch sinnvoll in die Geschichte einzuordnen und mögliche Interpretationen dafür zu diskutieren. Ein möglicher Ansatz ist, dass sich in der Traumszene der Autor trotz seiner Distanznahme durch die Herausgeberfiktion hier dennoch äussert – und zwar mit Unverständnis für die Grausamkeit der religiösen Konflikte. Diese Deutung lässt sich auch dadurch belegen, dass der Text keine Aussage über die Befürwortung des einen oder des anderen Glaubens zulässt, und nur der Nationalgedanke als zusammenhaltendes und den Religionskonflikt überwindendes Element als positiv bewertetes Phänomen fassbar wird. Bezieht man die allgemeinen Nationalstaatenbildungen des 19. Jahrhunderts (also der Entstehungszeit der Novelle) als Beleg bei, kann hier eine Deutung in Richtung Autorintention angebracht werden. 2 3. Didaktische Analyse und Reduktion Die Wahl des Themas folgte in Absprache bzw. auf Vorschlag der Praxislehrperson. Die Einbettung in den Unterricht ergibt sich dadurch, dass die SuS nach Angabe der Praxislehrperson im Verlauf des letzten halben Jahres die Grundlagen zur Analyse und Interpretation literarischer Texte erarbeitet haben. In der von mir gestalteten Unterrichtseinheit soll es nun um eine erste vollständige Lektüre eines (kurzen) Werkes gehen, wofür sich die Novelle von C. F. Meyer gut eignet. Den SuS sollen grundsätzlich verschiedene Zugangsmöglichkeiten zu einem literarischen Werk aufgezeigt werden, es geht um Lese- und Textverständnis. Das Lesen soll im Zentrum stehen, weshalb die vorgestellten Zugänge zur behandelten Literatur möglichst textnah gestaltet werden. Das Amulett steht also exemplarisch für ein literarisches Werk, an dem verschiedene Zugänge zu Literatur aufgezeigt werden. Es werden deshalb nach Absprache eine literaturhistorische Einordnung des Werkes in die Epoche des Realismus (Literaturepochen sind nach Lehrplan erst Thema im zweiten gymnasialen Schuljahr) sowie eine literaturtheoretische Analyse der Gattung Novelle weitgehend ausgeklammert. Der spezifische Inhalt der Novelle, die Religionskriege des 16. Jahrhunderts und die Bedeutung und Symbolik des Amuletts lassen einen Gegenwartsbezug zu heutigen Religionskonflikten, unter anderem exemplarisch realisiert in Symbol-Auseinandersetzungen (Mohammed-Karikaturen, Kruzifix-Streit) herstellen. Dass dieser Religionskonflikt auf der Ebene der beiden Hauptfiguren Schadau und Boccard auf dem kleinen Raum einer durch Nationalgefühle verbundenen Freundschaft als Verdoppelung des gesellschaftlichen Geschehens dargestellt wird, ermöglicht durch Charakteranalysen und Personenbeziehungen ein für die SuS leichter zugängliches Verständnis für die religiösen Streitfragen dieser Zeit. Aufgrund der Tatsache, dass der Text weder für die eine noch für die andere christliche Auffassung von Glauben Partei nimmt, lässt nach der Autorintention fragen bzw. eröffnet eine Diskussion, welche mit der Distanznahme des Autors durch die Herausgeberfiktion (als Teil der Rahmenhandlung) zusammenhängt. Dadurch wird eine Thematik angesprochen, welche die SuS auch in ihrem zukünftigen Lesen beeinflussen wird, nämlich die Frage nach der Autorintention, welche bei literaturhistorischen Einordnungen und Fragen nach Wirksamkeit und Absichten von Literatur oft in Erscheinung tritt. Im Zentrum der Unterrichtseinheit stehen dadurch der Aufbau der Novelle mit ihrer Rahmenhandlung, die historische Einordnung des Geschehens in die beschriebene Zeit (Religionskonflikte, Hugenottenkriege, dagegen Nationalismus als bestimmende Strömung der Zeit C. F. Meyers) und der Umgang des Textes mit diesem Geschehen: Nimmt der Text 3 Stellung? Lässt er eine Autorintention durchblicken? Welches Element des eben Beschriebenen wird durch den Text in den Fokus gerückt? Hier ist eine Diskussion des von C. F. Meyer gewählten Titels und damit der Rolle des Amuletts für die ganze Geschichte unumgänglich. Methodische Überlegungen Die SuS werden nach Absprache mit der Praxislehrperson das Werk vollständig gelesen haben zu Beginn der Unterrichtseinheit. Dies ermöglicht einen zügigen Einstieg und die geleitete Verarbeitung der ersten Leseerfahrung eines längeren Textes. Die Bestellung der Textausgabe (Reclam, sinnvoll aufgrund der vielen hilfreichen Erläuterungen historischer Begriffe) erfolgt demnach durch die Praxislehrperson. Durch das übergreifende Ziel der Leseerfahrung und das Erleben verschiedener Zugänge zu einem (älteren) literarischen Text werden textnahe Methoden im Vordergrund stehen, die Textverständnis und Verständnis für Widersprüchlichkeiten und Leerstellen und die damit verbundenen unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten von Literatur ermöglichen. 4. Groblernziele Kognitive Lernziele: Die SuS kennen den Inhalt und den Aufbau der Novelle Das Amulett von C. F. Meyer. Die SuS können den Inhalt eines Kapitels auf die wichtigste Szene reduzieren. Die SuS wissen, was die Funktion einer Rahmenhandlung sein kann und können diese im Werk und über das Werk hinaus interpretieren. Die SuS kennen die in der Novelle thematisierten historischen Umstände und können Zusammenhänge zur erzählten Geschichte des Werks und zu zeitgenössischen Begebenheiten der Entstehungszeit des Werks herstellen. Sie erkennen auch mögliche Zusammenhänge zu aktuellen Diskussionen der heutigen Gesellschaft. Die SuS wissen, was der Calvinismus in historischem Sinne ist und was für eine Rolle er für die erzählte Geschichte und deren Protagonisten spielt. Die SuS kennen unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu einem literarischen Text und nehmen sie als mögliche Varianten im Umgang mit zukünftiger Lektüre wahr. Die SuS verstehen die Bedeutung eines Titels bzw. der Beziehung zwischen Titel und Werk. 4 Pragmatische Lernziele: Die SuS sind in der Lage, einen Text genau zu lesen und eine Szene zeichnerisch darzustellen. Die SuS sind fähig, literarische Figuren mit wenigen Stichworten zu charakterisieren. Die SuS können Beziehungsstrukturen in einem Personenschaubild graphisch darstellen. Die SuS sind in der Lage, Informationen aus Zeitungsartikeln herauszufiltern und sie einer Gruppe zu erklären bzw. sie für andere SuS zugänglich zu machen. Die SuS erinnern sich an den schon erarbeiteten Unterschied zwischen Analysieren und Interpretieren im Umgang mit Literatur und können beide Verfahren adäquat anwenden. Die SuS sind in der Lage, eine selbstgewählte und dadurch als wichtig, interessant oder spannend bewertete Szene schauspielerisch darzustellen. Die SuS sind in der Lage, eine aus dem Text erstellte Graphik vor dem Hintergrund des Textes zu interpretieren und Bezüge zum Inhalt zu finden. Die SuS erfinden einen eigenen, neuen Titel für das Werk. Die SuS können in Gruppen selbständig arbeiten und sich gegenseitig das Gelernte weitergeben. Affektive Lernziele: Die SuS sind in der Lage, einzelne Szenen innerhalb eines Kapitels zu gewichten und sich auf die wichtigste zu einigen. Die SuS nehmen die Perspektivität eines literarischen Textes wahr und können unterschiedliche Wertungen und Urteile einerseits fällen, andererseits respektieren. Die SuS können unterschiedliche Motive und Gefühle der Figuren erkennen und beurteilen. Die SuS wissen um die wichtige Bedeutung des Respekts vor gegenteiligen Meinungen und (religiösen) Vorstellungen. Die SuS erkennen die Aktualität des älteren literarischen Textes bis in die heutige Zeit und empfinden ihn demnach als wertvolle Ergänzung des eigenen Denk-Horizonts. 5 5. Verteilung des Stoffes auf die acht Lektionen Die Verteilung des Stoffes auf die acht Lektionen wird für jede Lektion einzeln dargestellt, obwohl es sich teilweise um Doppellektionen handelt. Zwischen der sechsten und siebten Lektion wird in der Klasse eine Prüfung über das bisher erarbeitete geschrieben, die von der Praxislehrperson konzipiert und durchgeführt wird. Eine zusätzliche Herausforderung bildet diese durch die Terminsetzung der Notenabgabe dazwischengeschobene Prüfung in dem Sinne, als dass das Interesse der SuS an dem Werk auch nach der Prüfung erhalten bzw. nochmals neu entfacht werden muss. Erste Lektion: In der ersten Lektion soll der Plot des von den SuS in Vorarbeit gelesenen ganzen Novellentextes rekapituliert werden. Dies geschieht dadurch, dass die SuS in Partnerarbeit sich für die zentrale Szene jeweils eines Kapitels entscheiden und diese zeichnerisch darstellen. Es entsteht so eine Bildergeschichte, die im Schulzimmer aufgehängt wird und den Inhalt der Geschichte damit beim Betreten des Zimmers in den nachfolgenden Lektionen immer wieder präsent werden lässt. Zweite Lektion: Die zweite Lektion widmet sich den Charakteristiken der Figuren und dem Beziehungsgefüge. In einem Schaubild und mit Charakteristik-Stichworten werden die Ergebnisse festgehalten. Die Widersprüchlichkeit zwischen der Perspektive des Ich-Erzählers auf die Figuren und die objektive Perspektive des Lesers/der Leserin werden diskutiert, ebenso die Frage nach der Freundschaft der beiden Hauptpersonen, die Liebesbeziehung und die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den Figuren allgemein. Auch unterschiedliche Religionsgemeinschaftszugehörigkeit kann hier schon zum Thema werden. Dritte Lektion: In der dritten Lektion geht es einerseits um die Form der Rahmenhandlung in ihrer Funktion der Distanznahme des Autors zu seinem Text, andererseits um die durch die Rahmenerzählung erzeugte Historizität. Die historischen Hintergründe der Novellenhandlung und deren Verbindungen mit ihr, die Rolle der einzelnen vorkommenden historischen Persönlichkeiten in der historischen Realität und in der Novelle werden geklärt. 6 Vierte Lektion: Die vierte Lektion widmet sich der Thematik des Religionskonflikts im engeren Sinn und der Klärung des Begriffs Calvinismus. Als Ausgangspunkt für die Klärung des historischen Religionskonflikts dient – aus dem Prinzip der möglichst hochgradigen Textnähe – der Textabschnitt der „Religionsgespräche (S. 18 22). Im Rückbezug auf das Personenschaubild wird die Aufteilung der Figuren in die beiden Religionen festgehalten. Es wird erkannt, dass die beiden Protagonisten sozusagen in einer Welt im Kleinen den Religionskonflikt verdeutlichen. Zusätzlich wird hier erstmals die Bedeutung des Amuletts für die einzelnen Figuren thematisiert. Fünfte Lektion: In der fünften Lektion wird ein Gegenwartsbezug hergestellt. Die SuS untersuchen in Gruppen die Aktualität der in der Novelle geschilderten Religionskonflikte aufgrund der Lektüre aktueller Zeitungsartikel. Religiöser Fundamentalismus, Verknüpfung von Fundamentalismus und biographischer Erfahrung und Manipulation der Strömungen durch Leute an der Macht werden in Bezugnahme auf die Bedeutung des Amuletts für Boccard, in Rückbezug auf die vorher diskutierten Religionsgespräche und auf den in der Novelle geschilderten katastrophalen Höhepunkt der Ermordung Andersgläubiger thematisiert. Sechste Lektion: Zum Abschluss vor der Prüfung wird hier die Frage nach der Perspektivität des Textes, der Figuren und nach der Autorintention gestellt. Selbständig machen sich die SuS sich Gedanken über die Aussage des Textes. Angeknüpft wird damit zusätzlich an die Frage nach der Rahmenhandlung und der darin enthaltenen Distanznahme des Autors zu seinem Text, indem die Traumsequenz als mögliche hereingeschmuggelte Autorintention gedeutet wird. Siebte Lektion (im Anschluss an die Prüfung): In der Lektion im direkten Anschluss an die Prüfung (Prüfung erster Teil der Doppelstunde) muss eine Methode gefunden werden, die einerseits auflockernd ist und andererseits das Interesse an dem Werk, das eventuell dadurch, dass die Prüfung vorbei ist, etwas abflaut, nochmals anstachelt. Die Form einer Inszenierung selbstgewählter Szenen durch die SuS als kurze Theaterszenen scheint geeignet. Sie dient nicht nur dem lockeren Umgang mit dem Text, sondern verlangt neben exaktem Lesen der gewählten Textstelle auch eine Gewichtung der 7 einzelnen Szenen für die Geschichte bzw. ein Reflektieren darüber, welche beschriebenen Ereignisse für die SuS die interessantesten, lustigsten, grausamsten oder wichtigsten waren. Achte Lektion: Zum Abschluss der Unterrichtseinheit wird nochmals ein ganz anderer Zugang zu einem literarischen Werk aufgezeigt, nämlich über eine Visualisierung der Wortnennungen im Amulett. Die Graphik 2 bringt interessante Diskussionspunkte zutage, z.B. dass Boccard und Gasparde die meistgenannten Wörter im Text sind, während Schadau nicht so oft vorkommt (durch die Erzählperspektive des Ich-Erzählers zu erklären), dass das Amulett gar nicht erscheint auf der Graphik (da es – als Medaillon – nur fünfmal im Text auftaucht und deshalb nicht in die Graphik aufgenommen wurde), oder dass das Wort Auge ein sehr wichtiger Begriff zu sein scheint. Die SuS formulieren beim Interpretieren der Graphik selbständig Erklärungen für die verschiedenen Phänomene. Das Fehlen des Wortes Amulett oder Medaillon auf der Graphik, welche die Wörter zählt, muss dazu führen, dass die Wahl des Titels Thema der Lektion wird. Die SuS geben dem Werk einen neuen Titel, dessen Wahl sie begründen müssen. Gleichzeitig reflektieren die SuS die Titelversionen Ihrer MitschülerInnen und mögliche Veränderungen der Wirksamkeit des ganzen Buches. 2 Erstellt von ein Programm, dass Wörter in Texten zählt und die Menge der Nennungen proportional zueinander visualisiert. Nur Wörter ab sieben Nennungen werden in die Graphik aufgenommen. 8