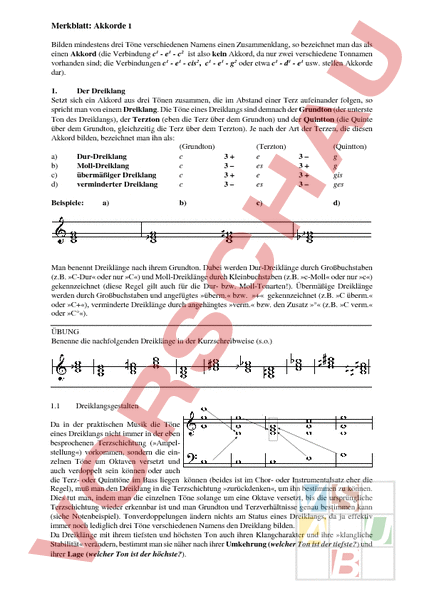Arbeitsblatt: Eine Übersicht zur Akkordlehre 1
Material-Details
wichtige Grundlagen zur Akkordlehre, Bildung der Dreiklänge, erste Grundlagen der funktionalen Harmonielehre
Musik
Musiktheorie / Noten
klassenübergreifend
2 Seiten
Statistik
77960
982
1
04.03.2011
Autor/in
Frank Segner
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Merkblatt: Akkorde 1 Bilden mindestens drei Töne verschiedenen Namens einen Zusammenklang, so bezeichnet man das als einen Akkord (die Verbindung c1 e1 c2 ist also kein Akkord, da nur zwei verschiedene Tonnamen vorhanden sind; die Verbindungen c1 e1 cis2, c1 e1 g2 oder etwa c1 d1 e1 usw. stellen Akkorde dar). 1. Der Dreiklang Setzt sich ein Akkord aus drei Tönen zusammen, die im Abstand einer Terz aufeinander folgen, so spricht man von einem Dreiklang. Die Töne eines Dreiklangs sind demnach der Grundton (der unterste Ton des Dreiklangs), der Terzton (eben die Terz über dem Grundton) und der Quintton (die Quinte über dem Grundton, gleichzeitig die Terz über dem Terzton). Je nach der Art der Terzen, die diesen Akkord bilden, bezeichnet man ihn als: (Grundton) (Terzton) (Quintton) a) Dur-Dreiklang 3 3– b) Moll-Dreiklang 3– es 3 c) übermäßiger Dreiklang 3 3 gis d) verminderter Dreiklang 3– es 3– ges Beispiele: a) b) c) d) Man benennt Dreiklänge nach ihrem Grundton. Dabei werden Dur-Dreiklänge durch Großbuchstaben (z.B. »C-Dur« oder nur »C«) und Moll-Dreiklänge durch Kleinbuchstaben (z.B. »c-Moll« oder nur »c«) gekennzeichnet (diese Regel gilt auch für die Dur- bzw. Moll-Tonarten!). Übermäßige Dreiklänge werden durch Großbuchstaben und angefügtes »überm.« bzw. »« gekennzeichnet (z.B. »C überm.« oder »C«), verminderte Dreiklänge durch angehängtes »verm.« bzw. den Zusatz »« (z.B. »C verm.« oder »C«). ÜBUNG Benenne die nachfolgenden Dreiklänge in der Kurzschreibweise (s.o.) 1.1 Dreiklangsgestalten Da in der praktischen Musik die Töne eines Dreiklangs nicht immer in der eben besprochenen Terzschichtung (»Ampelstellung«) vorkommen, sondern die einzelnen Töne um Oktaven versetzt und auch verdoppelt sein können oder auch die Terz- oder Quinttöne im Bass liegen können (beides ist im Chor- oder Instrumentalsatz eher die Regel), muß man den Dreiklang in die Terzschichtung »zurückdenken«, um ihn bestimmen zu können. Dies tut man, indem man die einzelnen Töne solange um eine Oktave versetzt, bis die ursprüngliche Terzschichtung wieder erkennbar ist und man Grundton und Terzverhältnisse genau bestimmen kann (siehe Notenbeispiel). Tonverdoppelungen ändern nichts am Status eines Dreiklangs, da ja effektiv immer noch lediglich drei Töne verschiedenen Namens den Dreiklang bilden. Da Dreiklänge mit ihrem tiefsten und höchsten Ton auch ihren Klangcharakter und ihre »klangliche Stabilität« verändern, bestimmt man sie näher nach ihrer Umkehrung (welcher Ton ist der tiefste?) und ihrer Lage (welcher Ton ist der höchste?). 1.1.2 Umkehrungen Ist bei einem Dreiklang der tiefste Ton der Grundton, so handelt es sich um den Grunddreiklang/Grundakkord (man merke sich „Ampelstellung; grün Grundton, gelb Terzton, rot Quintton) des Dreiklanges. Ist der Terzton der tiefste (1. Umkehrung), so nennt man ihn (Terz-)Sextakkord; wenn der tiefste Ton der Quintton ist (2. Umk.), so nennt man den Akkord Quartsextakkord. Die Bezeichnungen kommen aus der Generalbassbezifferung des Barock und lassen sich leicht verstehen, wenn man die Intervallverhältnisse der betreffenden Akkorde bezogen auf den jeweils tiefsten Ton betrachtet. Hier ein Beispiel anhand des C-Dur-Dreiklangs: Grundakkord: Sextakkord: Quartsextakkord: - [Terz von „c]g [Quinte v. „c] g [Terz v. „e] c1 [Sexte von „e] c1 [Quarte v. „g] e1 [Sexte v. „g] 1.1.3 Lagen Die Lage eines Akkordes wird durch seinen höchsten Ton bestimmt. Liegt der Grundton oben, so nennt man die Lage Oktavlage, liegt der Terzton oben, so ist es die Terzlage, ist der Quintton der höchste, so handelt es sich um die Quintlage. Die Lagenbezeichnung geht immer auf die Beziehung zum Grundton zurück. Die Töne - - c1 e1 z.B. bilden einen Akkord, der als C-Dur-Sextakkord in Terzlage zu bezeichnen wäre.) Der Begriff der Lage erscheint in der Akkordlehre noch in einem anderen Zusammenhang: Folgen in einem Dreiklang in den oberen Tönen (gilt nicht zwischen den beiden tiefsten Tönen) immer die nächstgelegenen Akkordtöne aufeinander, so spricht man von enger Lage; läßt sich aber zwischen zwei Dreiklangstöne noch ein weiterer Ton des Dreiklangs einfügen, so nennt man dies weite Lage. Bsp.: - - - c1 C - - - c1 C-Dur-Grundakkord in enger Oktavlage - g - e1 - c2 C-Dur-Grundakkord in weiter Oktavlage ÜBUNG Bestimme die nachfolgenden Dreiklänge (auf die enge Grundstellung zurückdenken, dann bestimmen) a) b) c) d) e) f) a) d) b) e) c) f) 1.2 Dreiklänge einer Dur-Skala Jeder Ton einer Tonleiter (Skala) kann der Grundton eines Dreiklanges sein. Dabei sind in Dur die Dreiklänge auf den Stufen (Grundton), IV (Quarte) und (Quinte) Durdreiklänge. Diese Dreiklänge nennt man auch Hauptdreiklänge. In diesen Dreiklängen kommen alle Töne der Skala vor, so dass man mit ihnen einfache Melodien begleiten kann. Die Grunddreiklänge stehen in einem dominantischen Verhältnis, d.h. sie sind quintverwandt: Man kann vom Dreiklang der Stufe zu dem der Stufe IV auch dadurch gelangen, dass man ihn eine Quinte weiter unten aufbaut. Daher nennt man die IV. Stufe auch Unter- oder Subdominante (abgekürzt S), die V. Stufe ist die Dominante (abgekürzt D). Die I. Stufe, welche diese Bezüge ermöglicht und die Ausgangstonart darstellt, heißt Tonika (abgekürzt T). Durdreiklang: Funktion: Unterquinte S (Dominante) Oberquinte D Dominante Merkblatt: Akkorde 1, Seite 2