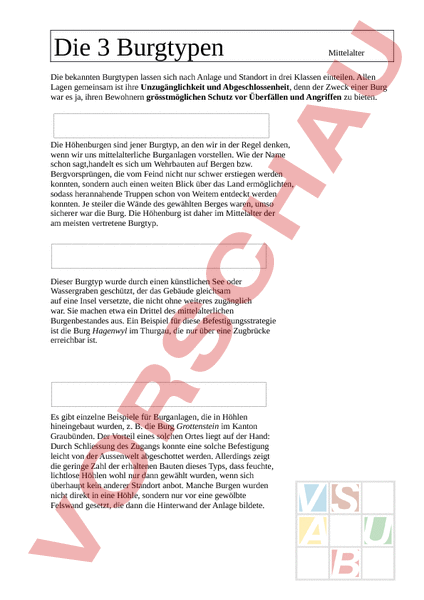Arbeitsblatt: Burgtypen
Material-Details
Beschreibung der drei wichtigsten Burgtypen
Geschichte
Mittelalter
4. Schuljahr
1 Seiten
Statistik
84340
1514
5
28.07.2011
Autor/in
Eliane Blumer
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Die 3 Burgtypen Mittelalter Die bekannten Burgtypen lassen sich nach Anlage und Standort in drei Klassen einteilen. Allen Lagen gemeinsam ist ihre Unzugänglichkeit und Abgeschlossenheit, denn der Zweck einer Burg war es ja, ihren Bewohnern grösstmöglichen Schutz vor Überfällen und Angriffen zu bieten. Die Höhenburgen sind jener Burgtyp, an den wir in der Regel denken, wenn wir uns mittelalterliche Burganlagen vorstellen. Wie der Name schon sagt,handelt es sich um Wehrbauten auf Bergen bzw. Bergvorsprüngen, die vom Feind nicht nur schwer erstiegen werden konnten, sondern auch einen weiten Blick über das Land ermöglichten, sodass herannahende Truppen schon von Weitem entdeckt werden konnten. Je steiler die Wände des gewählten Berges waren, umso sicherer war die Burg. Die Höhenburg ist daher im Mittelalter der am meisten vertretene Burgtyp. Dieser Burgtyp wurde durch einen künstlichen See oder Wassergraben geschützt, der das Gebäude gleichsam auf eine Insel versetzte, die nicht ohne weiteres zugänglich war. Sie machen etwa ein Drittel des mittelalterlichen Burgenbestandes aus. Ein Beispiel für diese Befestigungsstrategie ist die Burg Hagenwyl im Thurgau, die nur über eine Zugbrücke erreichbar ist. Es gibt einzelne Beispiele für Burganlagen, die in Höhlen hineingebaut wurden, z. B. die Burg Grottenstein im Kanton Graubünden. Der Vorteil eines solchen Ortes liegt auf der Hand: Durch Schliessung des Zugangs konnte eine solche Befestigung leicht von der Aussenwelt abgeschottet werden. Allerdings zeigt die geringe Zahl der erhaltenen Bauten dieses Typs, dass feuchte, lichtlose Höhlen wohl nur dann gewählt wurden, wenn sich überhaupt kein anderer Standort anbot. Manche Burgen wurden nicht direkt in eine Höhle, sondern nur vor eine gewölbte Felswand gesetzt, die dann die Hinterwand der Anlage bildete.