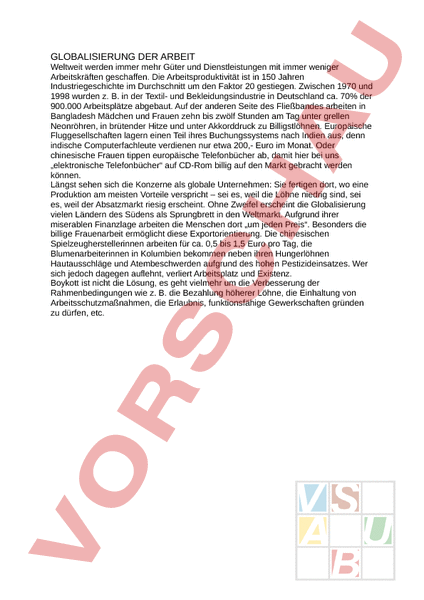Arbeitsblatt: Globalisierung der Arbeit
Material-Details
Die Weltreise der Jeans
Geographie
Anderes Thema
8. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
85267
561
5
18.08.2011
Autor/in
Benjamin Betschart
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
GLOBALISIERUNG DER ARBEIT Weltweit werden immer mehr Güter und Dienstleistungen mit immer weniger Arbeitskräften geschaffen. Die Arbeitsproduktivität ist in 150 Jahren Industriegeschichte im Durchschnitt um den Faktor 20 gestiegen. Zwischen 1970 und 1998 wurden z. B. in der Textil- und Bekleidungsindustrie in Deutschland ca. 70% der 900.000 Arbeitsplätze abgebaut. Auf der anderen Seite des Fließbandes arbeiten in Bangladesh Mädchen und Frauen zehn bis zwölf Stunden am Tag unter grellen Neonröhren, in brütender Hitze und unter Akkorddruck zu Billigstlöhnen. Europäische Fluggesellschaften lagern einen Teil ihres Buchungssystems nach Indien aus, denn indische Computerfachleute verdienen nur etwa 200,- Euro im Monat. Oder chinesische Frauen tippen europäische Telefonbücher ab, damit hier bei uns „elektronische Telefonbücher auf CD-Rom billig auf den Markt gebracht werden können. Längst sehen sich die Konzerne als globale Unternehmen: Sie fertigen dort, wo eine Produktion am meisten Vorteile verspricht – sei es, weil die Löhne niedrig sind, sei es, weil der Absatzmarkt riesig erscheint. Ohne Zweifel erscheint die Globalisierung vielen Ländern des Südens als Sprungbrett in den Weltmarkt. Aufgrund ihrer miserablen Finanzlage arbeiten die Menschen dort „um jeden Preis. Besonders die billige Frauenarbeit ermöglicht diese Exportorientierung. Die chinesischen Spielzeugherstellerinnen arbeiten für ca. 0,5 bis 1,5 Euro pro Tag, die Blumenarbeiterinnen in Kolumbien bekommen neben ihren Hungerlöhnen Hautausschläge und Atembeschwerden aufgrund des hohen Pestizideinsatzes. Wer sich jedoch dagegen auflehnt, verliert Arbeitsplatz und Existenz. Boykott ist nicht die Lösung, es geht vielmehr um die Verbesserung der Rahmenbedingungen wie z. B. die Bezahlung höherer Löhne, die Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen, die Erlaubnis, funktionsfähige Gewerkschaften gründen zu dürfen, etc. Die unglaubliche Weltreise der Jeans Etwa die Hälfte unserer Bekleidung ist aus Baumwolle. In etwa 70 Ländern werden jedes Jahr 20 Millionen Tonnen Rohbaumwolle angebaut. Oft handelt es sich um Monokulturen, die intensiv mit Pestiziden besprüht werden. Zwar sind diese kaum nachweisbar, doch sie belasten Wasser und Böden. Die Hälfte der Baumwolle stammt aus China, den USA, und den zentralasiatischen Republiken wie Usbekistan. Zusammen mit Indien, Pakistan, Australien, Brasilien, der Türkei, Ägypten und den afrikanischen Ländern Mali, Elfenbeinküste, Burkina Faso, Benin, Togo, dem Tschad, Sudan und Kamerun stellen diese Länder 90 Prozent der Welternte. Die Weltmarktpreise sind wie bei anderen Rohstoffen kurzfristig stark schwankend, langfristig aber rückläufig. Gemäss Weltbank kostete ein Kilogramm Rohbaumwolle 1960 3,14 Dollar, 1999 noch 1,13 Dollar. Heimliche Hauptstadt des weissen Goldes ist Winterthur. Die Paul Reinhart AG und die Volcot AG zählen zu den grössten Baumwollhändlerinnen der Welt. Ein weltweites Netz internationaler Arbeitsteilung prägt den Textil- und Bekleidungsmarkt. Der Grossteil unserer Kleider wird im Ausland, vor allem in Asien, gefertigt. Die Entwicklungsländer liefern sich als Standorte der Bekleidungsindustrie einen scharfen Konkurrenzkampf. Denn häufig war die Textilindustrie der erste Schritt der Industrialisierung. Weit überwiegend sind es junge Frauen zwischen 14 und 25 Jahren, welche zu Hungerlöhnen an den Nähmaschinen arbeiten. Farida Akhter aus Bangladesh erklärt: In Bangladesh arbeiten 1,5 Millionen Frauen unter miserablen Bedingungen im Bekleidungssektor. Weniger als ein Dollar Lohn pro Tag, keine Ferien, kein Mutterschaftsurlaub, keine Gewerkschaftsfreiheit. Ohne diese Arbeitsplätze wäre jedoch die Lage der Frauen noch schlechter. Deshalb gilt: keine Boykotte, sondern Solidarität bezeugen. So haben Hilfswerke eine internationale Kampagne für saubere Kleidung lanciert, damit die Konsumentinnen und Konsumenten gemeinsam faire Arbeits- bedingungen einfordern können. Der Konsum an Kleidern in der Schweiz zählt mit durchschnittlich 15 kg pro Jahr und Kopf zur Weltspitze. Das entspricht ungefähr einem Wintermantel, einer Jacke, fünf Hosen oder Röcken, vier Pullovern oder Sweat-Shirts, acht Blusen oder Hemden, sechs 6-Shirts, zehn UnterwäscheGarnituren, zehn Paar Socken und zwei Abendkleidern oder Anzügen. Obschon der Verbrauch gestiegen ist, um mit der Mode zu gehen, ist der Anteil der Ausgaben für Textilien am Einkommen rückläufig. Dafür sind steigende Schweizer Löhne einerseits und fallende Preise für Bekleidung anderseits verantwortlich. Pro Handel werden jährlich 1940 Franken, bzw. drei Prozent der Ausgaben, für Bekleidung verwendet. Jeans-Geografie Die Globalisierung zeigt sich darin, dass die Produktion in einzelne Elemente zerlegt wird und an völlig verschiedenen Orten stattfindet. So wie die Angabe Swiss made bis zu 50 Prozent Zulieferungen aus dem Ausland zulässt, so verbirgt sich auch hinter Importen aus dem Ausland ein internationales Zusammenspiel. Der Weg von der Baumwolle bis zu den fertigen Jeans am Verbrauchsort wird auf bis zu 19�00 Kilometer geschätzt. Hier kann man den Weg einer Jeans verfolgen, die in Europa verkauft wird: Jeans 501, Denim, Waschung Hit, Levi 129.90 Franken. Aus: NZZ Folio 04/05 Patrick Rohner • Schnittmuster und Design werden aus der Schweiz, per Fax oder Internet in die Konfek tionsfabrik auf den Philippinen geschickt. • Die Baumwolle wird in Kasachstan oder Indien geerntet und nach China versandt. • In China wird die Baumwolle mit Schweizer Spinnmaschinen versponnen. • Auf den Philippinen wird die versponnene Baumwolle mit Indigofarbe aus Deutschland oder der Schweiz eingefärbt. Das Färben der Jeans ist stark umweltbelastend. Meist gelangen in den Verarbeitungsländern unkontrolliert che mische Stoffe in Luft, Wasser oder Erde. Das Färben der Jeans belastet auch stark die Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter, häufig Kinder. • Innenfutter und aschLabel stammen aus Frankreich, Knöpfe und Nieten aus Italien. • Alle Zutaten werden auf die Philippinen geflo gen und dort zusammengenäht. • In Griechenland erfolgt die Endverarbeitung der Jeans. • In der Schweiz werden die Jeans verkauft und getragen. • Nach Gebrauch wandern sie in die Altkleider sammlung. Von dort gelangen sie in das Sor tierwerk. Dann werden sie nach Afrika gebracht und in Ghana nochmals getragen.