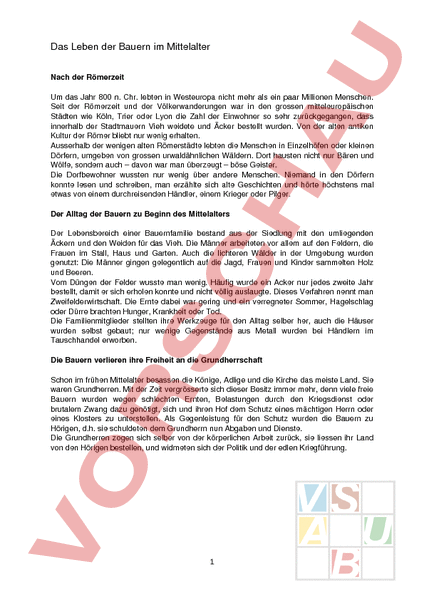Arbeitsblatt: Das Leben der Bauern im Mittelalter
Material-Details
Hintergrundtext, Fragen dazu
Geschichte
Mittelalter
8. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
86995
1165
4
21.09.2011
Autor/in
Irene Antener
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Das Leben der Bauern im Mittelalter Nach der Römerzeit Um das Jahr 800 n. Chr. lebten in Westeuropa nicht mehr als ein paar Millionen Menschen. Seit der Römerzeit und der Völkerwanderungen war in den grossen mitteleuropäischen Städten wie Köln, Trier oder Lyon die Zahl der Einwohner so sehr zurückgegangen, dass innerhalb der Stadtmauern Vieh weidete und Äcker bestellt wurden. Von der alten antiken Kultur der Römer bliebt nur wenig erhalten. Ausserhalb der wenigen alten Römerstädte lebten die Menschen in Einzelhöfen oder kleinen Dörfern, umgeben von grossen urwaldähnlichen Wäldern. Dort hausten nicht nur Bären und Wölfe, sondern auch – davon war man überzeugt – böse Geister. Die Dorfbewohner wussten nur wenig über andere Menschen. Niemand in den Dörfern konnte lesen und schreiben, man erzählte sich alte Geschichten und hörte höchstens mal etwas von einem durchreisenden Händler, einem Krieger oder Pilger. Der Alltag der Bauern zu Beginn des Mittelalters Der Lebensbereich einer Bauernfamilie bestand aus der Siedlung mit den umliegenden Äckern und den Weiden für das Vieh. Die Männer arbeiteten vor allem auf den Feldern, die Frauen im Stall, Haus und Garten. Auch die lichteren Wälder in der Umgebung wurden genutzt: Die Männer gingen gelegentlich auf die Jagd, Frauen und Kinder sammelten Holz und Beeren. Vom Düngen der Felder wusste man wenig. Häufig wurde ein Acker nur jedes zweite Jahr bestellt, damit er sich erholen konnte und nicht völlig auslaugte. Dieses Verfahren nennt man Zweifelderwirtschaft. Die Ernte dabei war gering und ein verregneter Sommer, Hagelschlag oder Dürre brachten Hunger, Krankheit oder Tod. Die Familienmitglieder stellten ihre Werkzeuge für den Alltag selber her, auch die Häuser wurden selbst gebaut; nur wenige Gegenstände aus Metall wurden bei Händlern im Tauschhandel erworben. Die Bauern verlieren ihre Freiheit an die Grundherrschaft Schon im frühen Mittelalter besassen die Könige, Adlige und die Kirche das meiste Land. Sie waren Grundherren. Mit der Zeit vergrösserte sich dieser Besitz immer mehr, denn viele freie Bauern wurden wegen schlechten Ernten, Belastungen durch den Kriegsdienst oder brutalem Zwang dazu genötigt, sich und ihren Hof dem Schutz eines mächtigen Herrn oder eines Klosters zu unterstellen. Als Gegenleistung für den Schutz wurden die Bauern zu Hörigen, d.h. sie schuldeten dem Grundherrn nun Abgaben und Dienste. Die Grundherren zogen sich selber von der körperlichen Arbeit zurück, sie liessen ihr Land von den Hörigen bestellen, und widmeten sich der Politik und der edlen Kriegführung. 1 Das Aussehen der Grundherrschaft Ein Grossgrundbesitz bestand aus zwei unterschiedlich bewirtschafteten Teilen: Dem Herrenland (Salland) und den sogenannten Hufen. Zum Salland gehörten der Herrenhof, wo der Grundherr wohnte, daneben auch Wirtschaftsgebäude (Fronhöfe) für Vieh und Geräte, Gesindehäuser, wo Mägde und Knechte lebten, sowie oft ein Stück Acker und Wald. Das Salland wurde von den Verwaltern des Grundherrn, den sogenannten Meiern, geführt. Der andere Teil des Grossgrundbesitzes war in selbständige Hufen aufgeteilt. Die Hufen umfassten Häuser, Vieh, Äcker und Weiden. Jede Bauernfamilie, die eine solche Hufe bewirtschaftete, musste einen Teil der Ernte an den Grundherrn abliefern und ausserdem von Zeit zu Zeit Frondienste, d.h. festgelegte Arbeiten, auf dem Herrenhof leisten. Der Grundherr übernahm für seine abhängigen Bauern im Gegenzug manche Aufgaben, die heute der Staat wahrnimmt, denn die damalige Staatsgewalt, der König, war fern und kaum zu erreichen. Sicherung der Ordnung, militärische Verteidigung, Gericht, Hilfe bei Hungersnöten und Seelsorge durch Pfarreien – dies alles wurde vom Grundherrn organisiert. Fortschritte in der Landwirtschaft Seit dem 11. Jahrhundert gab es einige allgemeine Veränderungen, die auch das Leben der Bauern beeinflussten. Das Klima wurde wärmer und die Ernteerträge stiegen. Daneben wurden neue Techniken des Ackerbaus angewandt, z.B. der Räderpflug oder die Dreifelderwirtschaft. Bei der Dreifelderwirtschaft teilte man das Land in drei Felder: Auf dem einen Feld wurde Wintergetreide angepflanzt, auf dem zweiten Sommergetreide und das dritte Feld lag brach. In den nächsten Jahren änderte man die Reihenfolge, so dass jedes Feld alle drei Stadien durchlief und damit nicht zu stark und einseitig belastet wurde. Durch diese Methode liessen sich die Ernteerträge erhöhen. Durch den Temperaturanstieg und die Neuerungen in der Landwirtschaft wuchs die Bevölkerung sehr rasch. Das Leben in der Grundherrschaft und die neuen Anbaumethoden wie die Dreifelderwirtschaft drängten die Bauern zur Zusammenarbeit. In manchen Regionen Europas schlossen sich die Bauern im Laufe des Mittelalters deshalb zu Dorfgemeinschaften zusammen. Dort regelten sie das Bestellen und Ernten der Felder, die Abgaben an die Grundherren oder die Nutzung der Allmende, einer Wiese die alle für ihr Vieh nutzen durften. In manchen Dörfern hatten die Bauern sogar das Recht, ein Dorfoberhaupt oder einen Dorfrat zu wählen. Aufgaben: 1. Wie veränderte sich die Stellung der Bauern während dem Mittelalter? 2. Mach in deinem Heft eine kleine Skizze von der mittelalterlichen Grundherrschaft 2