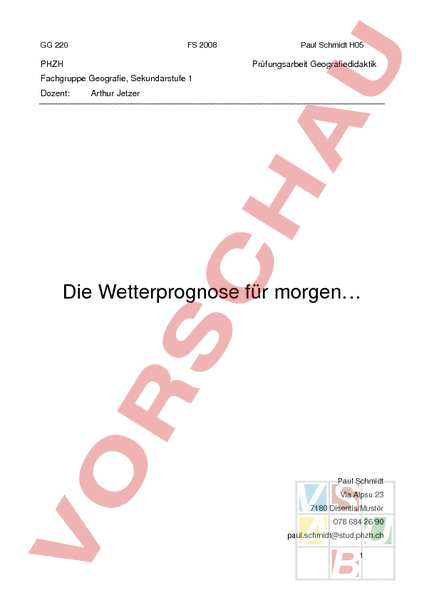Arbeitsblatt: Wetterlagen der Schweiz
Material-Details
Prüfungsarbeit Geografiedidaktik
Geographie
Schweiz
8. Schuljahr
15 Seiten
Statistik
87234
1348
40
25.09.2011
Autor/in
Paul Schmidt
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
GG 220 FS 2008 PHZH Paul Schmidt H05 Prüfungsarbeit Geografiedidaktik Fachgruppe Geografie, Sekundarstufe 1 Dozent: Arthur Jetzer Die Wetterprognose für morgen Paul Schmidt Via Alpsu 23 7180 Disentis/Mustér 078 684 26 90 1 GG 220 FS 2008 Paul Schmidt H05 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 2 1. Einleitung .3 2. Sachanalyse 4 3. Didaktische Analyse.6 3.1 Objekttheoretische Betrachtung .6 3.2 Metatheoretische Betrachtung7 4. Unterrichtsplanung.8 4.1 Grobplanung 8 4.2 Feinplanung .12 4.3 Lernziele im Überblick 14 5. Reflexion15 6. Literatur- und Medienverzeichnis .16 2 GG 220 FS 2008 Paul Schmidt H05 1. Einleitung Fast täglich berichten die Medien von Umweltkatastrophen und den daraus resultierenden menschlichen Tragödien. Wir stehen einer sich verändernden Umwelt gegenüber. Teil davon ist die globale Klimaänderung, welche uns vor neuen Herausforderungen stellt. Als Folge davon ereignen sich extreme Klimaereignisse mit zunehmender Häufigkeit. Veränderungen zeigen sich auch in der Schweiz. Die Sommer werden zunehmend wärmer und die Winter fallen stetig milder aus. Als begeisterter Schneesportler bin ich direkt von den sich verändernden Wetterumständen betroffen. Der extrem schneearme Winter 06/07 hat mein Interesse an verschiedenen Wetterlagen der Schweiz geweckt. In Erwartung heftiger Schneefälle habe ich begonnen die Wetterberichte genauer zu beobachten und mit dem aktuellen Wetter zu vergleichen. Mit der Zeit entdeckte ich gewisse Regelmässigkeiten. So habe ich beobachtet, dass der Föhn kaum und der Nordwind meistens Schnee bringt. In der fachwissenschaftlichen Vorlesung zum Thema der physischen Geographie wurde das Thema der typischen Wetterlagen im Alpenraum genauer untersucht. So wurden Vermutungen teils bestätigt, teils nicht. Es entstanden neue Mutmassungen und Theorien, die ich umgehend anhand des aktuellen Wetters untersuchen konnte. Der Winter wurde mit dem neu erworbenen Wissen nicht schneereicher, doch kann ich die Wetterabläufe heute besser verstehen und meine eigene lokalen Wettervorhersagen mit steigender Wahrscheinlichkeit treffend voraussagen. Meine Begeisterung für dieses Thema möchte ich an die Schülerinnen und Schüler vermitteln. Ich möchte, dass auch sie Bezüge zu ihrer eigenen Lebenswelt herstellen können und sich bewusst werden, wie das lokale Klima die menschliche Lebensweise prägt. Denn das Wetter betrifft uns alle. Wir können es nicht auswählen und ihm auch kaum ausweichen. Die Schüler und Schülerinnen sollen die lokalen Wetterveränderungen aufmerksam beobachten und über längere Zeit verfolgen können. Das Wetter ist unser stetiger Begleiter. Umso wichtiger ist es, es zu verstehen und richtig zu interpretieren. 3 GG 220 FS 2008 Paul Schmidt H05 2. Sachanalyse1 Über das Wetter wird so häufig und so viel gesprochen, wie wohl über kein anderes geographisches Thema. Dennoch leben heute viele Kinder und Erwachsene weniger naturnah und weniger wetterbewusst als noch vor 50 Jahren. Die aktuellen Wetterdaten werden gefiltert und möglichst unterhaltsam im Fernsehen, Radio oder in der Zeitung präsentiert. Gleichwohl sind Informationen zum Wetter oft lückenhaft und das Gespür für Wetterentwicklungen ist bei vielen am Verkümmern. In dieser Lektionsreihe geht es im Kern darum, den Jugendlichen einen direkteren Zugang zu alltäglichen Wettererscheinungen zu verschaffen. Es geht darum, ihre Umwelt bewusster wahrnehmen zu lassen und ihnen Hilfen zum Beobachten, Beschreiben und Deuten von Wetterphänomenen zu geben. Die Jugendlichen sollen auch lernen, wie man sich dem Wetter entsprechend verhält. Ausgehend vom Wetterverlauf in der Schweiz, können Bezüge auf andere Landschaftszonen der Erde hergestellt werden. Vergleiche lassen die Bedeutung von Klima und Wetter für Mensch und Natur immer differenzierter erkennen. Die Frage nach möglichen Zusammenhängen zwischen Klimaänderungen und Umweltbelastung kann in einem weiteren späteren Schritt angegangen werden.2 Das Thema bietet sich auch für den fächerübergreifenden Unterricht an: Natur und Technik Temperatur, Temperaturschwankungen Schmelzen, Erstarren, Sieden, Verdunsten, Kondensieren Luft und Wasser, warm, kalt, Druck Deutsch Bauernregeln Aufsätze zum Thema Wetter (z.B. Wetter und Freizeit) Werken Bau einer Wetterstation, Windräder 1 Nach Klafki. Didaktische Analyse von geografischen Unterrichtsthemen. In: Skript PHZH Fachgruppe Geografie. Sekundarstufe 1. S. 3. 2 Staatlicher Lehrmittelverlag. Geographie in der Schweiz (Lehrerausgabe). Kap. 4 S. 1-5. 4 GG 220 FS 2008 Paul Schmidt H05 5 GG 220 FS 2008 Paul Schmidt H05 3. Didaktische Analyse 3.1 Objekttheoretische Betrachtung Im Mittelpunkt der fachwissenschaftlichen Betrachtung steht die Atmosphäre. Sie umfasst die gesamte Gasschicht, welche die Erde umschliesst. Alle meteorologischen Vorgänge finden in diesem Raum statt. In Geographie unterrichten Lernen3 finden wir folgendes zur Meteorologie: „Die Ursachen, Auswirkungen, Folgen, aber auch die regionale Differenzierung klimatischer Phänomene bilden im Verbund mit der Klimatologie und der Meteorologie den Gegenstand klimageographischer Betrachtung.4 Das Thema fördert die Einsicht, dass der Mensch einerseits von seiner Umgebung geprägt wird und von ihr abhängig ist, andererseits mit seiner Lebensweise auch seine Umwelt beeinflusst. Die Thematik beinhaltet die Auseinandersetzung mit der klimatischen Umwelt und gibt den Schülerinnen und Schülern Orientierungswissen, welches ihnen hilft, Wetterereignisse einer Quelle zuzuordnen.5 Das Thema beschäftigt sich in erster Linie mit der lokalen und regionalen Betrachtungsebene. In zweiter Linie werden auch die nationalen und kontinentalen Wettervorgänge behandelt und untersucht. Voraussetzung dafür ist ein topographisches Basiswissen auf nationaler Ebene. Im Weiteren ist auch die klimatische Diversität Kontinentaleuropas für das Verständnis der Entstehung der typischen Wetterlagen der Schweiz von zentraler Bedeutung. Da das Wetter uns alle betrifft, haben die Schülerinnen und Schüler Erfahrungen mit verschiedensten Wettersituationen gemacht. Viele Begriffe sind durch Medien und Alltagssprache bereits bekannt. Die Thematik wird die Schülerinnen und Schüler im Alltag und in der Berufswelt weiterhin begleiten. Um einen intrinsisch motivierten Unterricht zu fördern, muss dieses Vorwissen aktiviert und mit der Theorie in Verbindung gebracht werden. Ziel der Lektionsreihe ist, dass einzelne Wetterbeobachtungen mit grossräumigen Wettervorgängen in Beziehung gebracht werden können. Individuelle Beobachtungen werden gesammelt und dokumentiert. Die Frage nach der Gewichtung und Filterung der zahlreichen Informationen steht dabei im Zentrum. Der Prozess der Datenerhebung und deren Verknüpfung werden beim Besuch des nationalen Wetterdienstes in einer authentischen Umgebung beobachtet. Dort findet auch eine Auseinandersetzung mit den Autoren professioneller Wetterprognosen statt. Durch genaues Beobachten sollen die Schülerinnen und Schüler für ihre Umwelt sensibilisiert werden. Die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler soll einerseits auf die Wechselwirkung zwischen menschlichem Verhalten und seiner Umwelt gelenkt werden, andererseits auf die 3 Haubrich. Geographie unterrichten lernen. 4 Haubrich. Geographie unterrichten lernen. S. 34. 5 Bildungsdirektion Zürich. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich. S. 27. 6 GG 220 FS 2008 Paul Schmidt H05 Einsicht, dass dem menschlichen Handlungsvermögen Grenzen gesetzt sind.6 3.2 Metatheoretische Betrachtung Strukturansatz Aus dem Zusammenwirken von Wärme, Niederschlägen und Winden entstehen die verschiedensten Wetterlagen. Das Wetter in der Schweiz wird grundsätzlich durch die Winde aus den verschiedenen Himmelsrichtungen bestimmt. Aus ihrem Zusammenspiel ergeben sich die verschiedensten Wettersituationen, von denen einige für unser Land typisch sind: Bisenlage, Staulage, Föhnlage, Westwindlage, Hoch und flache Druckverteilung. Durch die starke Kammerung und die grossen Höhenunterschiede unseres Landes entstehen jedoch recht grosse Unterschiede im lokalen Klima. Aufgrund der Beobachtungen einiger hundert Wetterstationen, werden in der Schweiz täglich Wetterprognosen in Zeitungen abgedruckt, in Radiosendern ausgestrahlt und im Fernsehen gezeigt. Ganz besondere Bedeutung für die Beurteilung des Wetters haben die verschiedenen Wolkenarten, welche Hinweise auf die Vorgänge in den Luftschichten geben. Prozessansatz Wetterprozesse sind stets dynamische und andauernde Entwicklungen. Veränderungen, wie der Anflug einer Gewitterfront, sind direkt von Auge zu beobachten. Die Prozesse, die beim Entstehen dieser Wetterphänomene zum Tragen kommen, dürfen nicht als isolierte, sondern vielmehr als miteinander verknüpfte Reaktionen erlebt werden. Systemansatz Alle Teile der Natur werden vom Wetter direkt mitbestimmt, egal ob Mensch oder Pflanze, denn ohne Niederschlag gibt es keine Vegetation. Die Witterungsprozesse haben eine solche Kraft, dass unterschiedliche Klimaräume entstanden sind und die Biodiversität dieser Landschaften mitbestimmt wurde. Der menschliche Tagesablauf wird durch das Wetter wesentlich mitbestimmt, das Wetter betrifft uns nämlich alle. So ist das Freizeitverhalten direkt von der Witterung abhängig und gewisse Wirtschaftszweige profitieren mehr oder weniger von spezifischen Wetterlagen (z.B. bei viel Schnee: Bergbahnen – Gärtner). 6 Bildungsdirektion Zürich. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich. S. 27. 7 GG 220 FS 2008 Paul Schmidt H05 4. Unterrichtsplanung 4.1 Grobplanung Schuljahr 2. Sek. (evtl. auch für A) Voraussetzungen Das Thema „Wetter, Klima begegnet uns im Geographieunterricht über alle Schuljahre. In dieser Lektionsreihe wird der thematische Schwerpunkt auf die Wetterprognose gelegt. Grundsätzliche Wettervorgänge sind daher im Wesentlichen bereits bekannt. Ausgeprägte Gesprächskultur und offener Umgang miteinander in der Klassengemeinschaft. Gruppenarbeit ist bekannt und wird öfters angewandt. Schulzimmer ist medial modern ausgestattet (Beamer, PC.). Lektion EL 1.Lekt. DL Inhalte Themen Ist das ein Wetter! Die Schülerinnen und Schüler (SuS) sehen eine Bildersammlung verschiedener Wettersituationen. Die einzelnen Situationen werden erfasst und beschrieben. Wo stimmt das Wetter mit dem Wetterwunsch überein? In 4er Gruppen berichten die SuS über eigene Wettererlebnisse. An welche besonderen Situationen und Momente erinnern sie sich? Warum wohl? Einige Erlebnisse werden im Plenum gesammelt. Ratespiel: SuS denken sich in eine Person und eine Situation ein (z.B. Bergbahndirektor im November). Durch individuelle Aussagen versuchen die anderen SuS herauszufinden, wer einen solchen Wetterwunsch haben könnte und warum. 7 SuS lesen Geschichte „das Wettermachen individuell. Die Wettermacher Medien/ Materialien Ziel Bildersammlung Wettersituationen Sensibilisierung für das Thema Bezug zur Lebenswelt der SuS herstellen. Motivieren In einer Gruppe Erlebnisse darstellen. Mitschülern konzentriert zuhören. Sich in andere Menschen hinein versetzen. Merken, dass das gleiche Wetter für die einen gut, für die anderen schlecht sein kann. SF Meteo Sendung Vorwissen aktivieren. 7 Siehe Anhang. 8 GG 220 2./3. Lekt. EL 4. Lekt. EL 5. Lekt. FS 2008 Paul Schmidt H05 SF Meteo Sendung des Vortages wird gemeinsam angeschaut. SuS machen sich Notizen zu folgenden Fragen: Worauf müssen wir achten? Welche Angaben gelten für uns? In welchen Berufen spielt das Wetter eine grosse Rolle? Austausch im Plenum. Frage an SuS. Gibt es „wettergspürige Menschen? Was heisst das eigentlich? Aussagen vergleichen (Wetterbeobachtung ist noch keine Prognose). SuS werden selbst zu Wetterbeobachtern, indem sie das Wettertagebuch mit dem Auftrag erhalten, jeden Tag kurz den Wetterverlauf, besondere Beobachtungen und persönliches Empfinden zu notieren. Zusätzlich erhalten sie das 8 Wettermessblatt Lehrperson zeigt, wie die gewünschten Daten gemessen werden (Messstation im Klassenzimmer). Die verschiedenen messbaren Wetterelemente werden erklärt. Plakate Wetterprognosen In 4er Gruppen werden die Wettertagebucheinträge kurz besprochen. Für wen war das Wetter schön, für wen war es schlecht? Warum war es schön/schlecht? Klasse wird in mind. 4 Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe untersucht eine Wetterprognose (TV (SF Meteo), Internet (www.meteoschweiz.ch), Zeitung (NZZ.), eigenes Wettergespür (Bauernregel.)). Jede Gruppe stellt ein Plakat mit einer Karte der Schweiz mit einer möglichst präzisen Wetterprognose des nächsten Tages her. Vergleich Prognose – Realität Wettertagebucheinträge werden kurz in 4er Gruppe besprochen. Gruppen vergleichen ihre Voraussage mit dem aktuellen Wetter. Unterschiede werden in der Gruppe besprochen und notiert. Plakat evtl. ergänzt. Gruppen präsentieren ihre Plakate. Die genaueste Voraussage wird ausgezeichnet. Beobachtungen werden festgehalten. Was hat gut geklappt? Auf welche Probleme sind die SuS bei der Plakatarbeit und beim Wettertagebuch gestossen? Offene Fragen notieren und für den Besuch des Nationalen Wetterdienstes aufarbeiten. Wettertagebuch Präsentation Wetterelemente Wettertagebuch TV, Internet, Zeitung Plakate Wettertagebuch Plakate 8 Siehe Anhang. 9 Bezug zur Lebenswelt der SuS herstellen (Berufswahlvorbereitung). Sensibilisierung für das Thema Eigene Beobachtungen mit anderen vergleichen. Wettertagebuch als roten Faden verankern. Begriffe wie Temperatur, Luftdruck, Regenmenge, Wind und Luftfeuchtigkeit werden geklärt. Eigene Beobachtungen mit anderen vergleichen. Teamwork und Gruppenarbeit fördern. Bewusster Medienumgang fördern. Präzise Arbeit üben. Kreativität fördern. Meteorologische Sprache wird verwendet. Eigene Beobachtungen werten und vergleichen. Wettertagebuch bewusst weiterführen. Plakate überarbeiten. Gedanken und Wissen wird reaktiviert. Eigene Arbeit reflektieren und vergleichen. Unklarheiten äussern und Fragen formulieren. GG 220 DL 6./7. Lekt. DL 8./9. Lekt. EL 10. Lekt. FS 2008 9 Paul Schmidt H05 Besuch Nationaler Wetterdienst SuS erfahren während der 2-stündigen Führung wie eine Prognose entsteht, was Bodenkarten und Ballonsonden mit Wetterprognosen zu tun haben und vieles mehr. Vorbereitete Fragen können gestellt werden. Von Beobachtungen zur Theorie Rückmeldungen zur Exkursion sammeln und besprechen. Eindrücke werden im Wettertagebuch festgehalten. In 3er Gruppen Wettertagebuch besprechen. Welcher Wind herrschte bei welchem Wetter? Wie war der Luftdruck bei schönem/schlechtem Wetter? Wann war die Temperatur am höchsten/tiefsten? Beobachtungen werden auf einer Folie gesammelt und präsentiert. Lehrperson erklärt anhand einer Karte Europas die vier verschiedenen grundsätzlichen Windeinflüsse auf das Klima der 10 Schweiz (Westwind, Nordwind, Bise, Föhn) und ihre Folgen. Zusätzlich wird die flache Druckverteilung und das Hoch erklärt. SuS erhalten ein Theorieblatt (wird in Wettertagebuch geklebt). SuS versuchen anschliessend ihre Wettertagebucheinträge gemäss den verschiedenen Wetterlagen der Schweiz zu verorten. Lehrperson stellt eine Musterlösung des Wetterverlaufs der letzten Wochen vor. Animierte Satellitenbilder veranschaulichen die beobachteten Wetterveränderungen. Offene Fragen sind willkommen und werden beantwortet. Wolken und Regen SuS erhalten die Aufgabe, aus der Erinnerung möglichst viele unterschiedliche Wolkenformen zu zeichnen. Lehrperson zeigt eine Bildersammlung verschiedener Wolkentypen. Gibt es Übereinstimmungen mit Schülerskizzen? Wie entstehen Wolken überhaupt? Wann gibt es Wolken (warm/kalt)? Welche Wolken bringen Regen? Diese und ähnliche Fragen werden gemeinsam untersucht. SuS erhalten ein Theorieblatt Wettertagebuch) Fragenkatallog Wettertagebuch Präsentation „Wetterlagen der Schweiz Theorieblatt „Wetterlagen der Schweiz Bildersammlung Wolken Theorieblatt „Wolken und Regen 9 Führung gemäss (27.4.2008) 10 Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. Schweiz Suisse Svizzera Svizra. S. 46. 10 Bezug zur Lebenswelt der SuS herstellen. Lernen im ausserschulischen Bereich. Lebensnahe Auseinandersetzung mit dem Thema. Berufswahlvorbereitung. Eigene Wetterbeobachtungen in der Gruppe vergleichen. Schlussfolgerungen formulieren und präsentieren. Die typischen Wetterlagen der Schweiz kennen und geographisch verorten können. Theorie auf eigene Beobachtungen anwenden. Vorwissen aktivieren. Bezug zur Lebenswelt schaffen. Erkennen welche Wolken Regen bringen und welche nicht. Wolkenentstehung verstehen. GG 220 EL 11. Lekt. FS 2008 Paul Schmidt H05 Faustregeln SuS erhalten den Auftrag, in 2er Gruppen Beobachtungen für Wetterbesserung und für Wetterverschlechterung zu sammeln (Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Winde, Anzeichen am Himmel, Tiere, Bauernregel .). Ihnen stehen alle Mittel im Schulzimmer zur Verfügung (inkl. Wettertagebuch). Anschliessend wird gemeinsam eine Tabelle mit Faustregeln zum 11 Witterungsverlauf erarbeitet. Die Faustregeln werden anhand des Wettertagebuchs auf Korrektheit überprüft (Morgenrot, Tau, Luftdruck .) Diese Tabelle übertragen die SuS schön gestaltet in ihr Wettertagebuch (Abschluss des Wettertagebuchs im Unterricht). Für eine evtl. Bewertung dient das Wettertagebuch (Gestaltung, Korrektheit, Beobachtungsprozess, Veränderungen etc.) Wettertagebuch 11 Siehe Anhang. 11 Erarbeitetes neu aufarbeiten. Aus einzelnen Beobachtungen Hypothesen ableiten. Informationen gewichten. Faustregelsammlung sauber ins Heft übertragen. Genaues Arbeiten. Möglichkeit zur weiteren Themenbehandlung bieten. SuS können die Regeln jederzeit anwenden und zu Hause zeigen (Selbstwertgefühl). Abschluss des Themas. GG 220 FS 2008 Paul Schmidt H05 4.2 Feinplanung 1. Lektion (EL) Thema/Inhalt(e): Ist das ein Wetter! Einführung Ziel(e): SuS können unterschiedliche Wettersituationen differenziert betrachten. Sie merken, dass das gleiche Wetter für die einen gut, für die andern schlecht sein kann. SuS sind in der Lage, eigene Erfahrungen zum Wetter vorzutragen und mit anderen zu vergleichen. SuS kennen die Bedürfnisse und Wünsche einiger Berufsfelder bezüglich der Wetterentwicklung. Zeit Ablauf SozialMittel/ formen Medien Inhalte, Lernschritte, Begriffe Thematisieren 10 Frontal Bildersammlung Die Schülerinnen und Schüler (SuS) sehen eine Bildersammlung verschiedener Wettersituationen. Die „Wettersituationen 12 einzelnen Situationen werden erfasst und beschrieben. Wo stimmt das Wetter mit dem Wetterwunsch überein? Die Bilder sollen das Interesse am Thema wecken und den SuS die Möglichkeit bieten, sich in andere Menschen mit ihren Sorgen und Bedürfnissen hineinzuversetzen. 10 20 5 Mobilisieren In 4er Gruppen berichten die SuS über eigene Wettererlebnisse. An welche besonderen Situationen und Momente erinnern sie sich? Warum wohl? Die SuS haben Erfahrungen mit verschiedensten Wettersituationen gemacht. Diese bringen sie in den Unterricht mit ein. Ratespiel SuS denken sich in eine Person und eine Situation ein (z.B. Bergbahndirektor im November). Durch Aussagen wie „Hoffentlich schneit es bald versuchen die anderen SuS herauszufinden, wer einen solchen Wetterwunsch haben könnte und warum. Das Spiel zeigt den SuS wie wichtig das Wetter für uns alle ist. Verschiedene Wünsche und Bedürfnisse treffen auf das gleiche Wetter. Frage an SuS: wie wäre es denn, wenn jeder das Wetter selber machen könnte? Reaktionen sammeln und besprechen. Ausklang Geschichte „Das Wettermachen wird gemeinsam gelesen. SuS erkennen die Komplexität des Themenfelds Wetter. Gruppe Individuell Plenum Plenum 12 Siehe Anhang. 13 Siehe Anhang. 12 AB 1 13 GG 220 FS 2008 Paul Schmidt H05 4. Lektion (EL) Thema/Inhalt(e): Plakate verschiedener Wettervorhersagen herstellen Ziel(e): SuS vergleichen ihre Wetterbeobachtungen und Wetterempfindungen. SuS können aus Medien die wesentlichen Informationen herausfiltern und auf ein Plakat übertragen. SuS verwenden meteorologische Begriffe. SuS wissen wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickeln wird. Zeit Ablauf Inhalte, Lernschritte, Begriffe Ergebnisse besprechen 10 In 4er Gruppen werden die Wettertagebucheinträge besprochen. Für wen war das Wetter schön, für wen war es schlecht? Stimmen die Beobachtungen überein? Wem gefällt welches Wetter? Gruppen verfassen ein kurzes Fazit und tragen es vor. Mithilfe der Wettertagebucheinträge beobachten die SuS das Wettergeschehen bewusster. Der Ergebnisaustausch dient der gegenseitigen Kontrolle und motiviert die SuS. 15 15 5 Informieren und aktivieren Klasse wird in 4 Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe untersucht eine Wetterprognose basierend auf unterschiedlichen Informationsquellen (TV (SF Meteo), Internet (www.meteoschweiz.ch), Zeitung (NZZ oder ähnliches), eigenes Wettergespür (Bauernregeln, eigene Erfahrungen.)). Ergebnisse werden in der Gruppe besprochen. In der Gruppe vertreten die SuS ihre eigene Meinung und vergleichen sie mit den Mitschülern. Durchsetzungsvermögen und Argumentationsfähigkeit werden geübt und gefördert. Produzieren Jede Gruppe stellt ein Plakat mit einer Karte der Schweiz mit einer möglichst präzisen Wetterprognose des nächsten Tages her. Zur Hilfe erhalten die SuS ein Arbeitsblatt. Das Plakat soll auch für das Auge ansprechend gestaltet sein. Informationen werden gesammelt und gemeinsam ausgearbeitet. Die SuS sollen ihre Ergebnisse kreativ aufarbeiten. Alle Plakate werden eingesammelt und für die nächste Stunde aufbewahrt. Auftrag und Ausblick Den Wetterverlauf der nächsten Tag genau beobachten und mit dem Plakat vergleichen. 14 Siehe Anhang. 15 Siehe Anhang. 13 Sozialformen Gruppe Mittel/ Medien 14 Wettertagebuch Plenum TV/ Internet/ Zeitung/ Bauernregelbuch Gruppe Gruppe Frontal Plakate 15 AB 2 GG 220 FS 2008 Paul Schmidt H05 4.3 Lernziele im Überblick AFFEKTIV INFORMATIONEN REPRODUZIEREN INFORMATIONEN VERARBEITEN INFROMATIONEN ERZEUGEN Beachten – emotional ansprechen Eigenständig werten – Stellung nehmen SuS vergleichen ihre Eindrücke zum Wetter mit ihren Mitschülern. SuS nehmen Stellung zu ihren eigenen Wetterpräferenzen. Handeln – sich engagieren INSTRUMENTELL Methoden wählen und anwenden SuS beobachten das Wetter und messen die Wetterelemente. Ergebnisse werden im Wettertagebuch eingetragen. Methoden übernehmen KOGNITIV SuS entdecken welches Wetter ihnen gefällt. SuS erfahren, dass das gleiche Wetter für die einen schön und für die andern schlecht sein kann. SuS entnehmen aus verschiedenen Medien die wesentlichen Informationen zum Wettergeschehen und vergleichen sie mit ihren eigenen Beobachtungen. SuS formulieren Fragen zu ihren Schwierigkeiten zur Wetterbeobachtung. Diese stellen sie auf der Exkursion Professionellen Meteorologen. SuS machen unbewusst eigene Wettervorhersagen in ihrer Freizeit (Für Schulausflug auch geeignet). Unterschiedliche Methoden kombinieren und einsetzen SuS entnehmen aus Medien die wesentlichen Informationen zum Wetterverlauf der nächsten Tage. Auf einem Plakat stellen sie diese frei dar. Die Gestaltung obliegt den SuS selbst. Erinnern Verstehen und anwenden Problem bearbeiten SuS kennen die grundlegenden Wetterelemente und die typischen Wetterlagen der Schweiz. Die Wolkenentstehung ist den SuS bekannt. SuS lernen verschiedene Wolkentypen kennen. SuS wenden ihr Wissen zu den Wetterelementen und den typischen Wetterlagen auf ihr eigenes Wettertagebuch an. SuS verstehen vereinfacht die Auswirkungen von Veränderungen einzelner Wetterelementen. 14 SuS stellen das erworbene Wissen zu einer Faustregelsammlung zusammen. Diese wird anhand der Wettertagebucheinträge auf Korrektheit überprüft. GG 220 FS 2008 Paul Schmidt H05 5. Reflexion Beim Erarbeiten dieser Lektionsreihe wurde mir bewusst, wie schwierig es ist, in 10-12 Lektionen à 45 Minuten ein Thema vertieft zu erarbeiten. Immer wieder müssen Ideen aufgrund mangelnder Zeit vernachlässigt und neue Schwerpunkte gesetzt werden. So hat sich auch mein Thema von „die typischen Wetterlagen der Schweiz zu „Wetterprognosen verlagert, da mir dieser Zugang zum Phänomen Wetter geeigneter scheint. Der Mensch steht mehr im Zentrum und gewinnt somit an Lebensnähe für die Schüler. Insgesamt bin ich zufrieden mit der Lektionsreihe und bereits gespannt auf die spätere Umsetzung. Gelungen scheint mir in erster Linie die aktiv entdeckende Herangehensweise an die Thematik, in dessen Zentrum der Mensch als handelndes Individuum steht. Die Selbstverantwortung und Kreativität der Lernenden wird gefordert. Des Weiteren habe ich den Fokus auf eine lebensnahe thematische Auseinandersetzung gelegt, da mir dies für einen intrinsisch motivierten Unterricht geeignet scheint. Idealerweise wird das Thema dann aufgegriffen, wenn es von der Situation und der persönlichen Betroffenheit her aktuell wird. So zum Beispiel vor einer Schulreise oder einem Skilager. Methodisch-didaktisch und von der Sache her besteht ein Konflikt: Einerseits ist Wetter etwas Ganzheitliches, andererseits lassen sich doch einzelne Elemente isolieren. Die Lektionsreihe geht vom ganzheitlichen Phänomen aus, daher kommen die Vorgänge einzelner Wetterelemente ein bisschen zu kurz. Aus diesem Grund sollte das Thema Wetter später wieder aufgegriffen werden und weiter auf Europa (Nord/Süd, Meer/Kontinent ) oder auf verschiedene Landschaftszonen der Erde ausgeweitet werden. Abschliessend kann ich festhalten, dass mir die Arbeit Freude bereitet hat und ich vieles dazulernen konnte. Ich bin überzeugt, dass auch die Schülerinnen und Schüler an diesem Thema Freude haben werden. 15 GG 220 FS 2008 Paul Schmidt H05 6. Literatur- und Medienverzeichnis Adamina, Marco, Frey, Beat u.a.: Geographie in der Schweiz. Stattlicher Lehrmittelverlag Bern. Bern 1989. Burri, Klaus: Schweiz Suisse Svizzera Svizra. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich. Zürich. 1995. Haubrich, Hartwig: Geographie unterrichten lernen. Die neue Didaktik der Geographie konkret. München/Düsseldorf/Stuttgart 2006. Vettiger, Barbara, Jetzer, Arthur u.a.: Basismodule Geographie. Lehrmittelverlage des Kantons Zürich 2006. Internetadressen Meteoschweiz: File.tmp/broschuerea4.pdf. (29.4.2008) (27.4.2008) 16