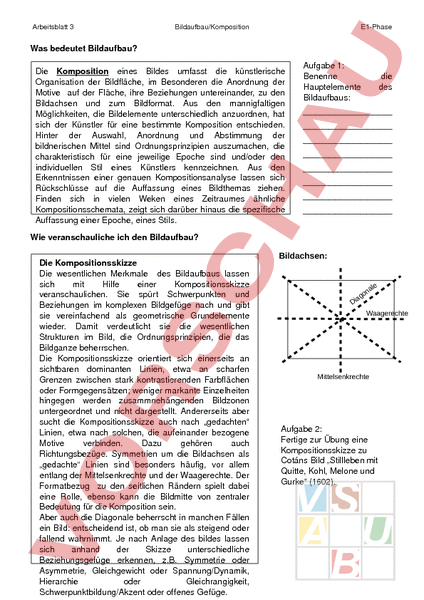Arbeitsblatt: Komposition und Bildordnungsprinzipien
Material-Details
Definition; Arbeitsauftrag
Bildnerisches Gestalten
Kunstgeschichte
10. Schuljahr
4 Seiten
Statistik
87398
2033
23
29.09.2011
Autor/in
Diane Pianka
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Arbeitsblatt 3 Bildaufbau/Komposition E1Phase Was bedeutet Bildaufbau? Die Komposition eines Bildes umfasst die künstlerische Organisation der Bildfläche, im Besonderen die Anordnung der Motive auf der Fläche, ihre Beziehungen untereinander, zu den Bildachsen und zum Bildformat. Aus den mannigfaltigen Möglichkeiten, die Bildelemente unterschiedlich anzuordnen, hat sich der Künstler für eine bestimmte Komposition entschieden. Hinter der Auswahl, Anordnung und Abstimmung der bildnerischen Mittel sind Ordnungsprinzipien auszumachen, die charakteristisch für eine jeweilige Epoche sind und/oder den individuellen Stil eines Künstlers kennzeichnen. Aus den Erkenntnissen einer genauen Kompositionsanalyse lassen sich Rückschlüsse auf die Auffassung eines Bildthemas ziehen. Finden sich in vielen Weken eines Zeitraumes ähnliche Kompositionsschemata, zeigt sich darüber hinaus die spezifische Auffassung einer Epoche, eines Stils. Aufgabe 1: Benenne Hauptelemente Bildaufbaus: die des Wie veranschauliche ich den Bildaufbau? Die Kompositionsskizze Die wesentlichen Merkmale des Bildaufbaus lassen sich mit Hilfe einer Kompositionsskizze veranschaulichen. Sie spürt Schwerpunkten und Beziehungen im komplexen Bildgefüge nach und gibt sie vereinfachend als geometrische Grundelemente wieder. Damit verdeutlicht sie die wesentlichen Strukturen im Bild, die Ordnungsprinzipien, die das Bildganze beherrschen. Die Kompositionsskizze orientiert sich einerseits an sichtbaren dominanten Linien, etwa an scharfen Grenzen zwischen stark kontrastierenden Farbflächen oder Formgegensätzen; weniger markante Einzelheiten hingegen werden zusammnehängenden Bildzonen untergeordnet und nicht dargestellt. Andererseits aber sucht die Kompositionsskizze auch nach „gedachten Linien, etwa nach solchen, die aufeinander bezogene Motive verbinden. Dazu gehören auch Richtungsbezüge. Symmetrien um die Bildachsen als „gedachte Linien sind besonders häufig, vor allem entlang der Mittelsenkrechte und der Waagerechte. Der Formatbezug zu den seitlichen Rändern spielt dabei eine Rolle, ebenso kann die Bildmitte von zentraler Bedeutung für die Komposition sein. Aber auch die Diagonale beherrscht in manchen Fällen ein Bild: entscheidend ist, ob man sie als steigend oder fallend wahrnimmt. Je nach Anlage des bildes lassen sich anhand der Skizze unterschiedliche Beziehungsgefüge erkennen, z.B. Symmetrie oder Asymmetrie, Gleichgewicht oder Spannung/Dynamik, Hierarchie oder Gleichrangigkeit, Schwerpunktbildung/Akzent oder offenes Gefüge. Bildachsen: ale on a Di Waagerechte Mittelsenkrechte Aufgabe 2: Fertige zur Übung eine Kompositionsskizze zu Cotáns Bild „Stillleben mit Quitte, Kohl, Melone und Gurke (1602). Arbeitsblatt 4 Ordnungsprinzipien Ordnungsprinzipien des Bildaufbaus Reihung: Gleiche oder sehr ähnliche Bildelemente werden wiederholt, wobei der Abstand gleichmäßig und ihre Gerichtetheit erhalten bleiben. Rhythmus: Sich ähnelnde oder verschiedene Bildelemente wiederholen sich als Sequenz mindestens einmal oder sind in rhythmisch unterschiedlicher Weise angeordnet. Gruppierung: Eine Anzahl gleicher oder ähnlicher Elemente sind zentral oder dezentral, symmetrisch oder asymmetrisch, geordnet oder ungeordnet in einem relativ ausgewogenen Verhältnis an bestimmten Teilen der Bildfläche verteilt angeordnet. Ballung: Eine Anzahl gleicher oder ähnlicher Bildelemente mit geringem Abstand und teilweiser Überdeckung ist in einem Teil der Bildfläche konzentriert dargestellt. Streuung: Die Fläche ist mit verschiedenen Bildelementen in regelmäßigen und ausgerichteten (unlebendige, statische Wirkung) oder unregelmäßigen, „zufälligen (lebendigere, dynamische Wirkung) Abständen gegliedert. E1Phase Symmetrie: Die Bildelemente sind meist achsensymmetrisch angeordnet und liegen sich somit an einer Symmetrieachse, die waagerecht, senkrecht oder schräg verlaufen kann, spiegelbildlich gegenüber, wobei eine ausgewogene, geordnete Wirkung entsteht. Asymmetrie: Bildelemente werden betont unregelmäßig angeordnet, Symmetrie wird vermieden, sodass eine lebendige, spannungsvolle Wirkung erzielt wird Struktur: Eine Bildfläche ist mit einer Folge gleicher oder ähnlicher Bildelemente (Punkt, Linie, Zeichen, Muster o. Ä.) gefüllt (nicht identisch mit Oberflächenstruktur oder Struktur als Werkzusammenhang), wobei eine strenge bis unruhige Wirkung erreicht wird. Raster: Es gilt als Sonderform der Struktur und ist eine normgebundene Flächengliederung, bei der Punkte und Linien streng geometrisch gereiht oder rhythmisch auf der Fläche angeordnet sind. Durch die Vielzahl der Bildelemente entsteht eine unruhige Wirkung. Schwerpunkt: Wenige oder nur ein Bildelement bilden durch Verdichtung oder farbliche Hervorhebung auf der Bildfläche einen Schwerpunkt, der lagebedingt unterschiedliche Wirkungen erzielen kann. Bei Zentralposition entsteht ein spannungsärmerer, bei einer etwas aus der Mitte zum Bildrand verlagerten Position ein etwas unausgewogenerer, aber optisch interessanter Eindruck. Kontraste: Durch gegensätzliche Formen von Bildelementen wird Spannung erzeugt. Anwendung finden: FormansichKontrast, Quantitätskontrast, Qualitätskontrast und Richtungskontrast (vgl. Bildspannung). Dynamik: Ein Eindruck von Bewegtheit und Unruhe wird durch sich verdichtende und anschwellende Formen und Linien, die betont diagonal oder geschwungen im Format verlaufen, bzw. kontrastreich und asymmetrisch angeordnet sind, vermittelt Statik: Vorwiegend geschlossene Bildelemente sind klar im Format angeordnet, horizontale und vertikale Linien dominieren, sodass Ruhe, Bewegungslosigkeit zum Ausdruck kommen. Praxisaufgabe: Dinge im Stillleben anordnen und die Wirkung unterschiedlicher Kompositionen untersuchen. 1.) Geht in Gruppen von 34 Personen zusammen und wählt euch ca. 35 Gegenstände aus, einen „Star und 34 weitere „Nebendarsteller. Nehmt euch ein großes Papier/eine Pappe für den Hintergrund. 2.) Probiert verschiedene Anordnungen aus und vergleicht die unterschiedliche Wirkung eurer Arrangements. 3.) Haltet vier Kompositionen mit der Digitalkamera fest und charakterisiert in Stichworten die Zusammenstellungen.