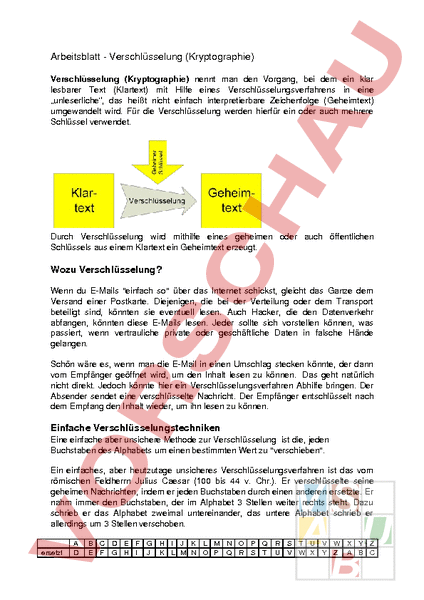Arbeitsblatt: Verschlüsselung / Caesar-Chiffren
Material-Details
Informationen zur Verschlüsselung
Caesar-Chiffren - 2 Aufgaben
Informatik
Anderes Thema
7. Schuljahr
2 Seiten
Statistik
88280
1263
3
21.10.2011
Autor/in
Holger Schmidt
Land: Deutschland
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Arbeitsblatt Verschlüsselung (Kryptographie) Verschlüsselung (Kryptographie) nennt man den Vorgang, bei dem ein klar lesbarer Text (Klartext) mit Hilfe eines Verschlüsselungsverfahrens in eine „unleserliche, das heißt nicht einfach interpretierbare Zeichenfolge (Geheimtext) umgewandelt wird. Für die Verschlüsselung werden hierfür ein oder auch mehrere Schlüssel verwendet. Durch Verschlüsselung wird mithilfe eines geheimen oder auch öffentlichen Schlüssels aus einem Klartext ein Geheimtext erzeugt. Wozu Verschlüsselung? Wenn du EMails einfach so über das Internet schickst, gleicht das Ganze dem Versand einer Postkarte. Diejenigen, die bei der Verteilung oder dem Transport beteiligt sind, könnten sie eventuell lesen. Auch Hacker, die den Datenverkehr abfangen, könnten diese EMails lesen. Jeder sollte sich vorstellen können, was passiert, wenn vertrauliche private oder geschäftliche Daten in falsche Hände gelangen. Schön wäre es, wenn man die EMail in einen Umschlag stecken könnte, der dann vom Empfänger geöffnet wird, um den Inhalt lesen zu können. Das geht natürlich nicht direkt. Jedoch könnte hier ein Verschlüsselungsverfahren Abhilfe bringen. Der Absender sendet eine verschlüsselte Nachricht. Der Empfänger entschlüsselt nach dem Empfang den Inhalt wieder, um ihn lesen zu können. Einfache Verschlüsselungstechniken Eine einfache aber unsichere Methode zur Verschlüsselung ist die, jeden Buchstaben des Alphabets um einen bestimmten Wert zu verschieben. Ein einfaches, aber heutzutage unsicheres Verschlüsselungsverfahren ist das vom römischen Feldherrn Julius Caesar (100 bis 44 v. Chr.). Er verschlüsselte seine geheimen Nachrichten, indem er jeden Buchstaben durch einen anderen ersetzte. Er nahm immer den Buchstaben, der im Alphabet 3 Stellen weiter rechts steht. Dazu schrieb er das Alphabet zweimal untereinander, das untere Alphabet schrieb er allerdings um 3 Stellen verschoben. ersetzt D C E G I K M O Q S U W Y E G I K M O Q S U W Y A C durch Caesar ersetzte in seinem Text jedes durch ein D, jedes durch ein und so weiter. Aufgabe 1) Was meint Caesar mit YHQL YLGL YLFL Man kann das Alphabet natürlich auch um andere Zahlen als 3 verschieben. Statt sich jedes Mal ein verschobenes Alphabet aufzuschreiben, kann man eine Chriffrierscheibe herstellen und benutzen. • Dreht man von der Ausgangsstelle die innere Scheibe um zum Beispiel 3 Stellen nach links, so steht dann unter jedem (äußeren) Buchstaben der im Alphabet 3 Stellen weiter rechts stehende Buchstabe. Aufgabe 2) • Entschlüsselt mit der Chriffrierscheibe die folgende Nachricht. Mögliche Schlüssel sind: 2, 7, 10, 13. Einer ist jeweils der richtige Schlüssel, das heißt bei Verschiebung um diese Zahl (Schlüssel) kann man die Nachricht richtig entschlüsseln. Den umgekehrten Vorgang, also die Verwandlung des Geheimtextes zurück in den Klartext, nennt man Entschlüsselung. Die Algorithmen zur Verschlüsselung und Entschlüsselung müssen nicht identisch sein. Ebenso können verschiedene Schlüssel für die Verschlüsselung und die Entschlüsselung zum Einsatz kommen. Bei symmetrischen, insbesondere bei den klassischen Verschlüsselungsmethoden, werden jedoch stets identische geheime Schlüssel zur Verschlüsselung und Entschlüsselung benutzt. Kryptographische Methoden mit unterschiedlichen Schlüsseln zur Ver und Entschlüsselung werden als asymmetrische Verfahren (engl.: Public key methods) bezeichnet. Hierbei verwendet der Sender den öffentlichen Schlüssel des Empfängers zur Verschlüsselung und der Empfänger seinen geheim gehaltenen, öffentlich nicht bekannten, sogenannten privaten Schlüssel zur Entschlüsselung.