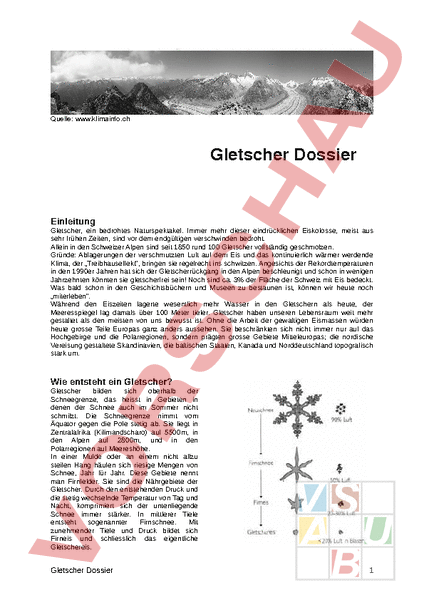Arbeitsblatt: Gletscher Dossier
Material-Details
Dossier über Gletscher; aus verschiedenen Internetquellen zusammengestellt.
Geographie
Gemischte Themen
8. Schuljahr
8 Seiten
Statistik
92801
1335
69
19.01.2012
Autor/in
Matthias Zumkehr
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Quelle: www.klimainfo.ch Gletscher Dossier Einleitung Gletscher, ein bedrohtes Naturspektakel. Immer mehr dieser eindrücklichen Eiskolosse, meist aus sehr frühen Zeiten, sind vor dem endgültigen verschwinden bedroht. Allein in den Schweizer Alpen sind seit 1850 rund 100 Gletscher vollständig geschmolzen. Gründe: Ablagerungen der verschmutzten Luft auf dem Eis und das kontinuierlich wärmer werdende Klima, der „Treibhauseffekt, bringen sie regelrecht ins schwitzen. Angesichts der Rekordtemperaturen in den 1990er Jahren hat sich der Gletscherrückgang in den Alpen beschleunigt und schon in wenigen Jahrzehnten könnten sie gletscherfrei sein! Noch sind ca. 3% der Fläche der Schweiz mit Eis bedeckt. Was bald schon in den Geschichtsbüchern und Museen zu bestaunen ist, können wir heute noch „miterleben. Während den Eiszeiten lagerte wesentlich mehr Wasser in den Gletschern als heute, der Meeresspiegel lag damals über 100 Meter tiefer. Gletscher haben unseren Lebensraum weit mehr gestaltet als den meisten von uns bewusst ist. Ohne die Arbeit der gewaltigen Eismassen würden heute grosse Teile Europas ganz anders aussehen. Sie beschränkten sich nicht immer nur auf das Hochgebirge und die Polarregionen, sondern prägten grosse Gebiete Mitteleuropas; die nordische Vereisung gestaltete Skandinavien, die baltischen Staaten, Kanada und Norddeutschland topografisch stark um. Wie entsteht ein Gletscher? Gletscher bilden sich oberhalb der Schneegrenze, das heisst in Gebieten in denen der Schnee auch im Sommer nicht schmilzt. Die Schneegrenze nimmt vom Äquator gegen die Pole stetig ab. Sie liegt in Zentralafrika (Kilimandscharo) auf 5500m, in den Alpen auf 2800m, und in den Polarregionen auf Meereshöhe. In einer Mulde oder an einem nicht allzu steilen Hang häufen sich riesige Mengen von Schnee, Jahr für Jahr. Diese Gebiete nennt man Firnfelder. Sie sind die Nährgebiete der Gletscher. Durch den entstehenden Druck und die stetig wechselnde Temperatur von Tag und Nacht, komprimiert sich der untenliegende Schnee immer stärker. In mittlerer Tiefe entsteht sogenannter Firnschnee. Mit zunehmender Tiefe und Druck bildet sich Firneis und schliesslich das eigentliche Gletschereis. Gletscher Dossier 1 Wie der Gletscher zu fliessen beginnt Das unter enormen Druck stehende Gletschereis im Nährgebiet beginnt sich sehr zähflüssig zu bewegen und erstreckt sich wie eine Zunge in das Abschmelzgebiet herunter. Das Gletschermaterial bewegt sich fortwährend aus dem Nährgebiet ins Abschmelzgebiet/Zehrgebiet. Wenn im Zehrgebiet mehr Eis abschmilzt, als im Nährgebiet aufgebaut wird (z.B. bei Klimaerwärmung ), zieht sich die Zunge zurück. Und wenn der Nachschub aus dem Nährgebiet das abschmelzen überwiegt, dann stösst der Gletscher vor. Wenn genügend Eis aus dem Nährgebiet nachfliesst und der Druck genug gross ist, kann ein Gletscher auch aufwärts fliessen. Einige Pässe, so beispielsweise der St. Gotthard, wurden einst von Gletschern überflossen und von diesen abgeschliffen. Die Fliessgeschwindigkeit hängt vom Nachschub aus dem Nährgebiet, von der Temperatur (Wasser als Schmiermittel) und vom Gefälle ab. Sie ist auch nicht im ganzen Gletscher gleich; an den Rändern und in der Tiefe, wo die Reibung zunimmt, ist sie geringer als in der Mitte und an der Oberfläche; also hat der Gletscher einen Stromstrich. Die Fliessdistanz ist je nach Gletscher und Klimaverhältnissen unterschiedlich sichtbar, sie beträgt pro Jahr bis zu 180 Meter. Gletscherspalten Diese Erscheinung tritt bei unterschiedlichen Fliessgeschwindigkeiten oder bei starkem Gefälle auf. Es gibt: •Längsspalten: Der Eisstrom am Rand kann dem in der Mitte nicht folgen. Durch die unterschiedliche Fliessgeschwindigkeit entstehen Spannungen die zu Rissen und Spalten parallel zur Fliessrichtung führen. •Querspalten: Bei starker Gefällszunahme oder plötzlicher Verbreiterung des Durchflusstales reissen Querspalten senkrecht zur Fliessrichtung auf. So ist der Gletscher teilweise von einem Gewirr von Spalten durchzogen. Besonders ausgeprägte Spalten entstehen im Nährgebiet wo sich das Eis vom Fels löst. Durch die Gletscherspalten fliesst das Schmelzwasser dem Grund entgegen und frisst dabei unterirdische Tunnel und Gänge ins Eis. Diese Vielzahl von kleinen Bächen sammelt sich zum Gletscherbach der das Eis beim Gletschertor (Öffnung am Ende der Gletscherzunge) verlässt. Gletscher Dossier 2 Formen der glazialen Erosion Der Gletscher wirkt wie ein gigantischer Hobel, der alle felsigen Kanten und Vorsprünge glättet und rundet. Der Gletscherhobel bearbeitet sein Bett auf drei Arten: •Abschleifen des Gesteins. Das Eis das über den Stein gleitet schabt das grobe Gestein zu einer glatten Oberfläche. Das abgeschliffene Gesteinsmaterial vermischt sich mit dem Eis, und so verstärkt sich die abschleifende Wirkung. •Losbrechen von gelockerten Felspartien die sich dem Eisstrom entgegenstellen. •Schmelzwasserströme, die ebenfalls abschleifend wirken, leisten ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zur ganzen Gletschererosion. Das Kar Diese aushobelnde Wirkung beginnt bereits im Nährgebiet, dort schleift sich das Eis seine Mulde zu einem halbkugelförmigen Becken: Das Kar. Viele Berge haben ihre charakteristische Form durch Karre erhalten. Das wohl eindrücklichste Beispiel für einen Karling ist das Matterhorn. Dieser Berg, mit seinen gegen oben immer steiler werdenden Felswände, wurde einst gleichzeitig von drei Kargletschern bearbeitet. Findlinge Findlinge sind grosse ortsfremde Gesteinsblöcke die vom Gletscher über weite Distanz transportiert wurden. Meist bis in Gebiete in denen diese Steinart gar nicht vorkommt. So kommt es vor, dass in Norddeutschland Blöcke aus Skandinavien herumliegen. Da diese Steine über gewaltige Entfernungen mitgeschleppt wurden, sind sie abgeschliffen und durch Moränenmaterial geschrammt. Sie lassen sich von Fachleuten jedoch problemlos beheimaten. Gletschermühlen Gletschermühlen sind Strudellöcher die von Schmelzwasserströmen ausgehölt wurden. An Sommertagen fliesst eine grössere Menge Schmelzwasser von der Oberfläche hinunter und prallt mit meist hohen Geschwindigkeiten auf den felsigen Grund. Auch hier wird die Erosion verstärkt durch die vom Wasser mitgeführten Gesteinsmaterialien. Gletscher Dossier 3 V-Tal U-Tal (Trogtal) Seine volle Abschleifkraft entwickelt der Gletscher jedoch erst nachdem er das Kar verlassen hat und einem Tal in die Tiefen folgt. Er formt das vorhandene V-Tal in ein Trogtal und schliesslich in ein steilwandiges breites U-Tal um. In den nächsten Abbildungen lässt sich gut erkennen, wie der Gletscher auf die Täler gewirkt hat und was mit den Seitentälern geschieht wenn sich der Gletscher zurückgezogen hat. Es entsteht eine Abstufung, eine Trogschulter. Der darüber hinaus fliessende Fluss, frisst sich recht schnell ein und bildet so eine Schlucht – ein Hängetal. In drei Schritten vom V-Tal zum U-Tal Entstehung eines Hängtales Moränen Der Gletscher ist nicht nur ein Eisstrom, sondern auch ein Schuttstrom. Das Material das der Gletscher abhobelt, trägt er auch selber ab. Dort wo der Gletscher schmilzt, vor allem im Zungenbereich, lagert er diese Schuttmassen ab, sog. Moränen. Diese Moränen erkennt man noch heute sehr gut in der Landschaft. Ein weiteres Beispiel für die Einflüsse der Gletscher auf die Topografie. Es werden zwischen fünf Moränentypen unterschieden: Obermoränen Mittelmoränen Grundmoränen Seitenmoränen Endmoränen Gletscher Dossier 4 Gletscher geformte Landschaften Wir treffen noch heute immer wider auf Spuren der Gletscher die vor 10000 Jahren weite Teile unserer Landschaft bedeckten. Mehr als die Moränen fallen uns in manchen Gebieten ehemaliger Vergletscherungen die Seen auf (z.B. Finnische Seenplatte). Ein Gletscher bildet mannigfaltige Vertiefungen und Hohlformen in denen sich nach dem Rückzug des Gletschers Wasser zu Seen ansammeln kann. Beispielsweise: •Im Kar kann sich nach abschmelzen des Gletschers ein Karsee bilden. •Im Gletschermittellauf vertiefte der Gletscher das Tal. Hier bilden sich Talseen (z.B. Brienzer- und Thunersee). •In den ehemaligen Zungenbecken wird das Wasser von den Endmoränen gestaut, es bilden sich Zungenbeckenseen (z.B Bodensee). •Im Grundmoränengebiet können sich grosse Gletscherteile vom fliessenden Eis abspalten und unter dem liegenden Schutt begraben liegen bleiben. Dieses sogenannte Toteis kann unter dieser isolierenden Schicht sehr lange liegen bleiben. Später wenn das Eis schmilzt und die Schuttdecke darüber einsinkt kann sich ein Toteissee bilden. Der Seenreichtum Kanadas, Schwedens, Finnlands, und der Baltischen Seenplatte um die Ostsee ist ein Relikt der nordischen Vereisung; die Alpenvereisung hat den grössten Teil der Bergseen und den Alpenrandseen (Brienzer-, Thuner- und Genfersee usw.) geschaffen. Urstromtäler Durch die Schmelzgewässer der eiszeitlichen Gletscher geschaffene breite, flache Talungen. Urstromtäler verliefen parallel zum damaligen Eisrand. Die gewaltigen Wassermassen der Eisschmelze sammelten sich hinter der Endmoräne und dem Sander und bildeten diese breiten Eisrandtäler. Drumlins Im Ablagerungsbereich von Gletschern kommen, meist in Scharen, stromlinienförmige Hügel vor, die aus Lockermaterial bestehen (gewöhnlich aus Moränenmaterial). Doch können auch fluviale (vom Fluss) Schotter von Schmelzwasserflüssen beteiligt sein. Diese Hügel heissen Drumlins. Sie sind meist mehrere zehn Meter hoch und wenige 100 Meter lang, und ihre steilere Seite zeigt gegen die Fliessrichtung des Gletschers. Sie kommen nicht regelmässig auf der ganzen Breite der Gletscherzunge vor, nur dort wo die Fliessgeschwindigkeit des Gletschers und die Menge des Lockermaterials es zuliessen und begünstigten. Die Entstehung der Drumlins ist nur strömungsdynamisch zu erklären. Es mag komisch erscheinen dass die Drumlins die steilere Seite gegen den Strom aufweisen, doch diese Form erzeugt entgegen dem Augenschein, den geringsten Widerstand. Man nehme als Beispiel den Regentropfen der sich beim fallen so formt, dass er möglichst geringen Widerstand erzeugt – die stumpfe Seite ist vorne. Grosse Drumlinfelder liegen am Bodensee und Zürichsee. Rundhöcker Wo der Gletscher in der Talsohle liegende Felsblöcke nicht losbrechen konnte, hat er sie zu sogenannten Rundhöckern abgeschliffen. Sie sind gleich geformt wie die Drumlins, nur dass die höchste Seite in der Fliessrichtung des Eises steht. Sie werden oft verwechselt mit den Drumlins, die aus Moränenmaterial bestehen, aber eine sehr ähnliche Form haben. Gletscher Dossier 5 Rundhöcker Drumlin (Fliessrichtung ) Urstromtal Die glaziale Serie Unter der glazialen Serie versteht man die drei Ablagerungsgebiete die jeder Gletscher hinterlässt: im Zehrgebiet das Grund-moränengebiet, an dessen Begrenzung das Endmoränengebiet und jenseits der Endmoränen das Sandergebiet. Das Grundmoränengebiet Das ist eine wellige bis ebene Landschaft, die von einer zusammenhängenden, ein bis zehn Meter dicken Schicht überzogen ist. Das ist eine wasserundurchlässige Ablagerungs-schicht die sich zwischen dem Eis und dem Untergrund gebildet hat und die in feinstzermahlenen Gesteinsmehl gerundete, geschrammte Gesteinsbrocken enthält. Diese Gebiete sind reich an Findlingen, Drumlins und Seen. Die Endmoränenlandschaft In gestaffelten Bögen durchziehen End-moränenbogen die Landschaft. Jede Eiszeit hinterliess ihre eigenen Endmoränen, wobei die Moränen der älteren Eiszeiten bereits stark abgetragen sind. Jede Eiszeit hinterliess gleich mehrere solcher Endmoränen. Diese Gründen aus der Tatsache, dass sich nach dem Höhepunkt der Eiszeit nicht alle Gletscher gleichschnell zurückzogen, und einige, in wieder kälteren Perioden, wieder vorstiessen und eine zweite Endmoräne hinter die erste, schon bestehende aufschob. Das Sandergebiet Auch Gletschervorfeld genannt. Ausgedehnte flache Schmelzwasserablagerungen in Form von Schwemm- fächern vor den Gletscher. Die Landschaft ist karg und voll Schotter und Kies. An der Sanderwurzel (nahe beim Gletschertor) wird das grobe Material (Schotter) abgelagert. Je weiter weg vom Eisrand, desto feiner werden auch die Ablagerungen, es liegen nur noch Kies und Sand. Die Sander haben mehrere Flussläufe, die häufig ihren Weg durch die Ablagerungen ändern. Glaziale Serie Gletscher Dossier Permafrost 6 Permafrost Permanent gefrorene Böden (Permafrost) sind in den Alpen oberhalb von 2500 ü.M. weit verbreitet. Das Vorkommen des Permafrostes hängt stark von den klimatischen und topografischen Faktoren ab. Die Schneedecke spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie stark isolierend (schlechte Wärmeleitung) und stark reflektierend wirkt. Diese beiden Eigenschaften wirken sich zu unterschiedlicher Jahreszeit differenziert auf die Bodentemperatur aus: Bei genügend Schnee im Hochwinter verhindert die Schneedecke das Eindringen der kalten Luft zum Boden (wärmender Effekt). Bei lange liegen bleibendem Lawinenschnee im Sommer wird die starke sommerliche Sonnenein-strahlung an der Schneeoberfläche reflektiert (kühlende Wirkung). In hochgelegenen Gebieten gibt der Permafrost vielen Hängen die Stabilität. Man muss sich einen Berg von Kieselsteinen vorstellen der durch vereistes Wasser «zusammenklebt», wenn dieses Wasser auftaut, ist dieser Berg dann praktisch unbegehbar und instabil. Wenn dieses «ewige Eis» auftaut sind Bergstürze, Steinschläge oder Überschwemmungen vorprogrammiert. In der Schweiz sind etwa 300 Bergbahnen im Dauerfrost verankert. Sie stehen unter ständiger Überwachung. Doch das Eis droht zu schmelzen, und das nicht nur in der Schweiz! Der Einfluss des Klimas Der Rückzug der Gletscher ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts im Gang. Angesichts der Rekordtemperaturen der 1990er-Jahren in den Alpenländern ist mit einem weiteren dramatischen Gletscherrückgang in den nächsten Jahren zu rechnen, ein Vorgang der sich zunehmend beschleunigt. Die zeitlich verzögerte Reaktion der Alpen auf erhöhte Temperaturen führt dazu, dass wir heute die Gletscherschmelze beobachten können, die vor Jahr- zehnten verursacht wurde. Es wird auch angenommen, dass die Alpen in wenigen Jahrzehnten ganz gletscherfrei sein werden. Schmelzwasser Alpenregionen reagieren unterschiedlich auf die Klimaerwärmung. Eine entscheidende Rolle spielt der Anteil der Gletscher. Ist der Gletscheranteil in einem Gebiet gering, nimmt die Wasserabflussmenge proportional zur Klimaerwärmung ab. Ist jedoch der Gletscheranteil gross, kompensiert die Eismasse dies über einen gewissen Zeit- raum, danach nimmt die Abflussmenge sogar eher zu. Auch ein Problem ist, dass weniger Neuschnee fällt, der den Gletscher nährt und vor dem Abschmelzen schützt. Permafrost Die Permafrostgrenze hat sich in den letzten 100 Jahren um 150 – 200 Meter nach oben verschoben und ein weiterer Anstieg um 200 –750 Meter droht; bei einer Erwärmung um ein bis zwei Grad bis zum Jahr 2100. Gemeinsam mit dem Rückzug der Gletscher wird dieser Anstieg der Permafrostgrenze für die zunehmende Häufigkeit der Naturkatastrophen verantwortlich gemacht. Muren, Steinschlag, Erdrutsche und Hochwasser werden durch ein wärmeres Klima in den Alpen stark begünstigt und bedrohen zunehmend auch bisher ver- schonte Alpenregionen. Ökosystem Die alpinen Ökosysteme können durch den Klimawandel zersplittert werden und einzelne Arten wären vom Aus- sterben bedroht. So zeigen siche beispielsweise bei der Fichte erste Zeichen für ein baldiges grossflächiges Aussterben. Das Einwandern und vermehrte auftreten von Schädlingen, wie dem Buchdrucker, wird wahrscheinlicher. Die Pflanzen kommen in einen Klimastress, dies bewirkt eine Verschlechterung der Widerstands- kraft und sind dadurch zusätzlich gefährdet. Aber der Verlust der Gletscher schafft in den Alpen auch Ökonomische Probleme. Neben dem lebenswichtigen Wasserspeicher und der ganzen Flora und Fauna geht mit dem Gletschereis auch ein wichtiges land- schaftsästhetisches Element verloren, von dem vor allem der Alpentourismus 200 Jahre lang profitieren konnte. Fakten: Gletscher Dossier 7 •Seit dem Gletscherhochstand von 1850 sind in den schweizer Alpen rund 100 Gletscher vollständig geschmolzen! •In der Messperiode von 1850 bis 1973 nahm die Eismächtigkeit der Gletscher in der Schweiz um durchschnittlich 19 Meter ab. Das Eisvolumen wurde von 107 km 3 auf 74 km3 reduziert! •Europaweit verloren alpine Gletscher ca. die Hälfte ihres Eisvolumens und rund 30-40% ihrer ursprünglichen Oberflächen. •Die International Commission for Snow and Ice befürchtet, dass bei gleich bleibender Schmelzrate der Himalaya im Jahr 2035 Gletscherfrei sein könnte. Gletscherrückgang in den Alpen Der Aletschgletscher Das Gebiet um Eiger, Mönch und Jungfrau, des grossen Aletschgletschers und des Aletschwaldes, ist eine Schönheit und Faszination für sich. Das Aletsch-Bietschhorn-Gebiet wurde im Jahr 2001 zu Recht in die Liste der UNESCO-Weltnaturerbe aufgenommen. Der Grosse Aletschgletscher ist mit seinen gut 23 km Länge der grösste und längste Gletscher der Alpen. Er besteht aus rund 27 Milliarden Tonnen Eis. Gespiesen wird er durch drei mächtige Firnfelder: Das grosse Aletschfirn, das Junfraufirn, das Ewigschneefirn und zusätzlich von der viel kleineren Grüneckfirn. Sie fliessen im Bereich des Konkordiaplatzes zusammen, wo der Gletscher eine Eisdicke von rund 900 erreicht. Von dort fliesst der Gletscher in einer Geschwindigeit von ca. 180 pro Jahr in Richtung Rohnetal. Die Gletscherzunge liegt mit 1560 ü.M. weit unterhalb der lokalen Baumgrenze. In tausenden von Jahren hat der Gletscher eine einzigartige Landschaft geformt. Unter dem Druck des Eises fliesst der Gletscher talabwärts und gräbt sich so immer tiefer in die alpine Landschaft hinein. Unmassen von Geröll und Schutt schiebt er vor sich her, beim Abschmelzen des Eises hinterlässt er Rundhöcker und weitgehend unbewachsene Moränenflächen. Auf diesen zunächst unbewachsenen Flächen vollzieht sich in wenigen Jahrzehnten eine erstaunliche Entwicklung. Moose und erste Samenpflanzen besiedeln die scheinbar lebens- feindlichen Geröllhalden. Später gesellen sich weitere krautige Pflanzen hinzu, bis nach ca. 25 Jahren die ersten Bäume und Sträucher zu finden sind. Gletscher Dossier 8 Gletscher Dossier 9