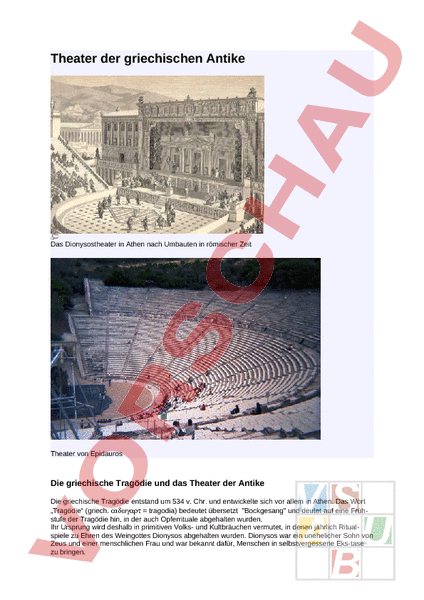Arbeitsblatt: Theater der griechischen Antike
Material-Details
Kurze Geschichte des Ursprungs des Theaters
Deutsch
Gemischte Themen
9. Schuljahr
5 Seiten
Statistik
94993
1392
12
26.02.2012
Autor/in
re (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Theater der griechischen Antike Das Dionysostheater in Athen nach Umbauten in römischer Zeit Theater von Epidauros Die griechische Tragödie und das Theater der Antike Die griechische Tragödie entstand um 534 v. Chr. und entwickelte sich vor allem in Athen. Das Wort „Tragödie (griech. tragodia) bedeutet übersetzt Bockgesang und deutet auf eine Frühstufe der Tragödie hin, in der auch Opferrituale abgehalten wurden. Ihr Ursprung wird deshalb in primitiven Volks- und Kultbräuchen vermutet, in denen jährlich Ritualspiele zu Ehren des Weingottes Dionysos abgehalten wurden. Dionysos war ein unehelicher Sohn von Zeus und einer menschlichen Frau und war bekannt dafür, Menschen in selbstvergessene Eks-tase zu bringen. Als Aufführung und Höhepunkt dieser Ritualspiele, die um 600 v. Chr. stattfanden, waren die Dithyramben vorgesehen. Das waren Lob- und Weihelieder, die von Chören in einem Chorwettbewerb vorgetragen wurden, um den Gott zu preisen. Später übernahm man auch Ausschnitte aus griechischen Heldensagen, womit die Vorform der griechischen Tragödie erreicht worden war. Etwa ein Jahrhundert später entstanden aus diesen einfachen Kultspielen und Tänzen auch die ersten richtigen Spielformen. Als sie einen festen Platz im Jahresablauf der Gemeinde erhielten, wurden auch erste bauliche Anlagen nötig. Als Spielorte für diese Prozessionen entstanden dann auf der Agora ( Markt) Athens die ersten Sitzgelegenheiten aus Holz. Das war die Geburt des Theaters. Nun war Dionysos nicht nur der Gott des Weines und des Wachstums, sondern wurde auch noch zum Gott des Theaters. Damit blieb das griechische Theater immer an den Dionysoskult gebunden. Als der eigentliche Schöpfer der Tragödie galt jedoch Thespis, ein Tragödiendichter aus dem 6. Jh. v. Chr. Da die Handlungen des Chors immer komplizierter wurden, ließ er ihm einen Schauspieler mit Sprechversen gegenübertreten. Später traten immer mehr Einzelsprecher hinzu und die Rolle des Chors wurde zunehmend unwichtiger. Zu seiner Zeit entstanden auch richtige Wettkämpfe (Dionysien), an denen Tragödienschreiber und Dichter aus ganz Griechenland teilnahmen. Es kam zu harter Konkurrenz und dies führte zur raschen Weiterentwicklung der Tragödie. 405 v.Chr. gewann sie dann schließlich ihre feste literarische Form. Die bekanntesten antiken Tragödienschreiber sind Äschylos, Sophokles und Euripides. Schon in der Antike galten sie als die großen Repräsentanten der griechischen Tragödie, denn ihre Dramen stellen ihr eigentliches Wesen und die entscheidenden Phasen ihrer Entwicklung dar. Tragödien setzten sich mit politischen Problemen auseinander, die mit Erzählungen von Mythen kombiniert wurden. Behandelte Themen waren dabei Gegensätze wie: Mensch und Götter Schuld und Sühne Ich und die Welt Charakter und Schicksal Typisch für die griechische Tragödie war auch der politische Konflikt bzw. die Krise, die vom Schicksal oder von den Göttern vorgesehen war und die betroffene Person in eine ausweglose Situation brachte, weil sie, egal was sie tat, immer schuldig wurde. Chor und Akteure Der Chor bestand zunächst aus freiwilligen Bürgern, die für ihr Auftreten bezahlt wurden. Später bildeten sich jedoch Spezialisten heraus. Der Chor war ein wichtiger Teil der Tragödie. Seine Aufgabe war das Geschehen zu deuten und zu analysieren. Er fungierte sozusagen als eine neutrale Person, die Ratschläge erteilen konnte, die Handlung zusammenfasste oder auch einen Rückblick gewährte. Als Schauspieler konnten nur Männer auftreten. Diese wurden ebenfalls vom Staat gefördert. Alle Darsteller konnten mehrere Rollen in einem Stück spielen. Aber mehr als drei Schauspieler, außer dem Chor, standen nie gleichzeitig auf der Bühne, so dass die Handlung leicht zu verfolgen war. Gleichzeitig waren sie verpflichtet, während ihres Auftretens Holzmasken zu tragen. Die Maske selbst verlieh ein starres und erschreckendes Aussehen. Somit wurde die Individualität des Schauspielers abgedeckt und es verhalf ihm das Rollenspiel zu vereinfachen (Frauenrollen konnten damit auch leichter gespielt werden). Dies war der Grund, warum lachende (Komödie) und weinende (Tragödie) Masken zum Symbol des Theaters wurden. Jeder Dichter konnte zum Teil selbst auswählen, was die Schauspieler trugen. Er konnte aber nicht allzu frei entscheiden, sondern musste sich an manche Regeln halten (z.B. mussten alle Gewänder bis zu den Knöcheln reichen). Weitere typische Elemente waren spezielle Bühnenschuhe mit erhöhten Absätzen, die man Kothurne nannte. Diese starke Verkleidung hatte ausserdem den Sinn, dass sich die Darsteller nun in andere, teils niedere, teils höhere Wesen verwandelten und im Dienste des Gottes ihr eigenes Ich aufgaben. Die Kostüme der Tragödien unterschieden sich generell von denen der Komödien. Über die Musik in den Stücken hat man keine festen Aufzeichnungen. Bei den griechischen Theatern handelte es sich um Freilufttheater, die in einen Hang hineingebaut wurden, meist in Nord-Süd-Ausrichtung. Weitgehend gesichert gelten für das fünfte Jahrhundert folgende Bauelemente: Theatron (zunächst aus Holz, später aus Stein), Skené (hölzernes Bühnenhaus, daher auch Szene), Orchestra und die zwei seitlichen Zugänge zur Orchestra, die Parodoi. Dazu kommen das ekkyklema, eine Plattform, die aus dem Haus gerollt wurde, um hinterszenische Szenen innerhalb des Hauses in einem Tableau zu vergegenwärtigen, und die mechane, ein Kran, mit dem der „deus ex machina (bezeichnet ursprünglich das Auftauchen einer Gottheit mit Hilfe einer Bühnenmaschinerie) auf die Szene herabstürzte und in das tragische Geschehen eingriff. Aufbau des Theaters von Epidauros Der bis zum Umgang reichende untere Teil wurde im frühen 3. Jh. v. Chr. von Polyklet dem Jüngeren erbaut. Im 2. Jh. v. Chr. folgte dann der obere Teil. Das Theatron (der Zuschauerraum) bestand ursprünglich aus 34 Sitzreihen und wurde auf 55 Sitzreihen erweitert, diese Sitzreihen erreicht man über 12 Treppenaufgänge. So haben insgesamt ca. 14.000 Zuschauer im Theater Platz. Die vordersten Reihen waren für Ehrengäste reserviert und hatten Sitze mit Lehnen und Polstern. Bei dem Bau des Theaters wurde bei der Architektur vor allem darauf geachtet, dass der Zuschauerraum in die Landschaft eingebettet ist. Das sieht man besonders schön, da der Zuschauerraum seinen tiefsten Punkt im Tal hat und am Hügel aufsteigt. Ziel der Architekten war es also, dass zwischen dem geometrischen Theatron und der umliegenden Landschaft ein harmonisches Gleichgewicht besteht. Das Theater Epidauros ist das besterhaltene Theater in Griechenland. Es ist besonders für seine sehr gute Akustik bekannt. Das Geschehen auf der Bühne (Orchestra) kann man bis in die oberste Reihe sehr gut verfolgen. Auch heute finden hier im Sommer noch Theaterfestspiele statt, bei denen Tragödien und Komödien in griechischer Sprache aufgeführt werden. 1 Theatron: Zuschauerraum: ursprünglich (350 v. Chr.) 34 Sitzreihen, später (2. Jh. v. Chr.) Erweiterung auf 55 Sitzreihen 2 Orchestra: Tanzplatz des Chores und Bühne (Durchmesser: 22 Meter), in der Mitte Dionysos-Altar (Sockel heute noch erkennbar) 3 Skene: Künstlergarderobe, Aufbewahrung der Requisiten; wurde oft in das Bühnengeschehen eingebunden 4 Proskenion: Vorbau der Skene, der auch als Kulisse diente 5 Parodoi: zwei seitliche Torbögen, durch die die Zuschauer das Theatron und der Chor die Orchestra betraten Die drei grossen griechischen Tragödiendichter Euripides 480 v. Chr. oder 485/484 v. Chr. in Salamis; † 406 v. Chr. in Pella Aeschylos 525 v. Chr. in Eleusis, Attika; † 456 v. Chr. in Gela, Sizilien Sophokles 496 v. Chr. in Colonus Hippius (Athen); † 406/405 v. Chr. in Athen